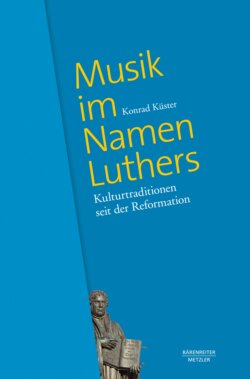Читать книгу Musik im Namen Luthers - Konrad Küster - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Organisten
ОглавлениеSo verbleibt noch die Rolle des Organisten: ein erstaunlich problematisches, in den lutherischen Regionen zudem uneinheitlich behandeltes Berufsbild. Einerseits war der Organist ein professioneller Musiker – im Gegensatz zum Kantor, der ein professioneller Theologe war und in seiner Ausbildung lediglich elementare musikalische Aspekte »mitgenommen« hatte. Denn mehr musikalische Einsicht als ein Adjuvant brauchte er eigentlich nicht zu haben – mit einer Ausnahme: Er musste in der Schule aktiv Musik unterrichten.
Der Unterschied zwischen spezifischer musikalischer Kompetenz und theologisch-wissenschaftlicher Bildung führte zumeist zu einer höheren Rangstellung des Kantors gegenüber dem Organisten. Und da der Kantor im Konzept der Lateinschule lediglich eine mittlere Position innehatte, wird erkennbar, wie weit nachgeordnet dann erst recht der Organistenstand war. Die ersten Belege dafür finden sich schon in den Kirchenordnungen Johannes Bugenhagens. Zwar lehnte er Orgeln nicht ab; eher lässt sich wohl von einer Duldung sprechen, wenn er 1525 in einer der frühen Wittenberger Kirchenordnungen formuliert39 »Organis (quando iam illic sunt) possunt, si voluerint, uti« – Orgeln, wo sie schon vorhanden sind, dürfen, wenn man will, benutzt werden. Und zwar, wie hinzugefügt wird, nur sonntags im Te Deum und dann, wenn man deutsche Lieder singe: »si quando germanica carmina cecinerint« (wie üblich, bleibt offen, welche Rolle die Orgel dann haben sollte und wer die Lieder sang). Bugenhagens Haltung zu den Standesfragen kommt aber darin zum Ausdruck, dass er in der Hamburger Kirchenordnung als Organistengehalt 50 Mark lübisch für angemessen erachtete (25 Reichstaler), ein Viertel eines Pastorengehalts (bzw. ein Sechstel des Superintendentengehalts).40
Für den mitteldeutschen Raum blieb diese Relation längerfristig gewahrt; im nördlicheren Deutschland aber explodierten die Organistengehälter. Johann Adam Reinken war als Hamburger Katharinenorganist der wohl unerreichbare Spitzenverdiener seines Standes, mit 1.200 Mark pro Jahr, die durch Zulagen und Unterrichtseinnahmen noch um ein Vielfaches gesteigert wurden. Und 1638 erhielt in Tönning, einer damals noch jungen Stadt an der Nordsee, der Organist ein Viertel der für Kirche und Schule vorgesehenen Personalmittel; den Rest teilten acht andere unter sich auf, darunter zwei Pastoren und die drei Lehrer der örtlichen Lateinschule.41 Fragen um den Vorrang eines Kantors stellten sich unter diesen Bedingungen naturgemäß nicht. Was es mit diesem Organistenstand auf sich hatte, bedarf also einer eigenen Klärung.