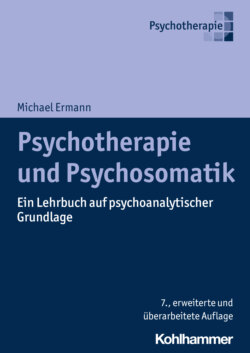Читать книгу Psychotherapie und Psychosomatik - Michael Ermann - Страница 192
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zur Geschichte der psychotherapeutischen Diagnostik
ОглавлениеDie psychotherapeutische Diagnostik galt über lange Zeit als eine Kunst, für die es keine festen Regeln gab. Besonders die Psychoanalyse wehrte sich dagegen, überhaupt Diagnosen zu stellen. Es reichte für die psychoanalytische Behandlung aus, die Persönlichkeit der Patienten zu ergründen und aus den Erkenntnissen über verdrängte Konflikte und unbewusste Phantasien einen Ansatz für die Einflussnahme auf die Persönlichkeit und für deren Veränderung zu entwickeln. Die notwendigen biografischen Daten und andere wichtige Informationen wurden im Verlauf der Behandlung gesammelt. Gegenüber einem medizinisch-diagnostischen Ansatz bestand erhebliche Skepsis.
Erst nach und nach entwickelte sich unter dem Einfluss einer zunehmenden Institutionalisierung und Medizinalisierung eine psychotherapeutische Fachdiagnostik ( Kap. 5.2.2), welche Regeln für die Befunderfassung sowie für die Indikations- und Prognosestellung aufstellte. Soweit sie auf Konzepte der Psychoanalyse bezogen war, blieb dabei die Erfassung des psychodynamischen Hintergrundes, vornehmlich die Verarbeitung und die Folgen unbewusster Konflikte und ihre Einbettung in den psychosozialen Kontext, das Zentrum der Untersuchungen. Die Systematisierung von klinischen Syndromen und ihre Klassifikation fanden nur am Rande Aufmerksamkeit.
Das änderte sich mit der Etablierung der Psychoanalyse in Institutionen und Polikliniken. Hier war der Untersucher nicht mehr zwangsläufig auch der zukünftige Behandler. Das Untersuchungsgespräch war damit nicht mehr unmittelbar Teil der Behandlung. Um die für die Diagnose und Indikationsstellung notwendigen Informationen zu erlangen, führte Harald Schultz-Hencke142 um 1950 im Berliner Institut für Psychogene Erkrankungen, einer psychoanalytischen Poliklinik, das Konzept der tiefenpsychologischen Anamnese ein ( Kap. 5.2.1). Es wurde später zur Grundlage für die Berichte an Kostenträger im Rahmen der Psychotherapierichtlinie.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich vor allem von Seiten der Psychiatrie das Interesse, psychische Störungen systematisch zu erfassen und damit wissenschaftlichen Studien zugänglich zu machen. Dahinter standen Forderungen nach Prozess- und Wirksamkeitsuntersuchungen in der Psychotherapie. Sie wurden vor allem mit der Finanzierung von Psychotherapien durch Krankenkassen und Versicherungen begründet. Damit gewannen Klassifikationssysteme143 an Bedeutung, für welche die individuelle Dynamik sowie biografische und psychosoziale Hintergründe wenig Belang hatten. Sie waren (und sind) vorrangig darauf ausgerichtet, Syndrome und Symptome zu kategorisieren und zu klassifizieren. Komplexe Zusammenhänge bilden sich darin meistens nicht ab. Stattdessen werden Mehrfachdiagnosen vergeben und eine Koexistenz von Phänomenen im Sinne einer Komorbidität angenommen.
In den 1990er Jahren wurde die »Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik« (OPD) entwickelt, die ein sehr umfassendes Instrument für die Befunderhebung und deren Dokumentation darstellt. Es trägt der Tatsache Rechnung, dass psychogene Störungen nicht mehr ausschließlich als Folge ungelöster intrapsychischer Konflikte zu betrachten sind (Konfliktpathologie), die sich in der Übertragung abbilden. Stattdessen werden zunehmend Störungen der Persönlichkeitsentwicklung aufgrund dysfunktionaler Beziehungen in der Kindheit in Betracht gezogen. Sie manifestieren sich in defizitären Funktionen der psychischen Struktur (Entwicklungspathologie) mit nachhaltigen Folgen für die Selbstregulation und Beziehungsgestaltung. Diese werden verständlicherweise in der Untersuchungssituation und in der Beziehung zum Untersucher deutlich, auch wenn sie nicht als »Übertragungen« im ursprünglichen Sinne betrachtet werden können.
Bevorzugt wird in der psychodynamischen Diagnostik ein mehrdimensionales Vorgehen, in dem die deskriptive Klassifikation nach ICD mit explizit psychodynamischen Kategorien wie Dynamik, Struktur, Beziehung u. a. verbunden wird ( Kap. 5.3.4). Um dem Dualismus von Konflikt- und Entwicklungspathologie diagnostisch gerecht zu werden, stellt die OPD die diagnostischen Dimensionen Konflikt und Struktur in das Zentrum. Daraus werden je unterschiedliche therapeutische Ziele und Strategien entwickelt.
Trotz dieser Entwicklungen halten sich viele dynamische Psychotherapeuten nach wie vor an die »Kunst« des Diagnostizierens, indem sie die Manifestation von unbewussten Konflikten und strukturellen Defiziten im szenischen Interview beobachten und die Klärung in der gezielten biografischen Anamnese vertiefen. Diagnostik wird dabei als interaktioneller Prozess aufgefasst, in dem wesentliche Beziehungsmuster und diagnostische Fokusse sich abbilden.