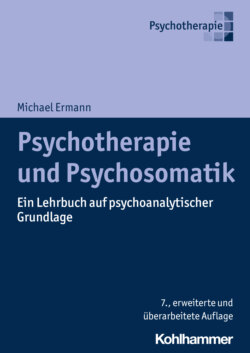Читать книгу Psychotherapie und Psychosomatik - Michael Ermann - Страница 194
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5.1.1 Die Untersuchung von Patienten mit psychogenen Störungen
ОглавлениеIm Zentrum der allgemeinen Diagnostik steht das Untersuchungsgespräch. Es hat die Aufgabe, die körperliche, seelische und soziale Gesamtsituation des Kranken zu erfassen, um das Gewicht möglicher Krankheitsfaktoren abzuschätzen. Die kompetente Diagnostik in allen medizinischen Fachgebieten enthält also auch psychosomatisch-psychotherapeutische Aspekte, d. h. sie berücksichtigt auch Aspekte des Erlebens und Verhaltens, der seelischen und der sozialen Situation.
Jede ätiologische Klärung schließt auch die Möglichkeit mit ein,
• dass jede Krankheit durch seelische Faktoren bedingt oder mitbedingt sein kann
• dass es sich um eine überwiegend seelisch bedingte Erkrankung handeln kann (psychogene Störung),
• dass eine körperliche Erkrankung neurotisch verarbeitet werden kann (neurotische Überlagerung einer primär somatischen Erkrankung),
• dass eine körperliche Erkrankung zum Auslösefaktor für eine neurotische Dekompensation werden kann (sekundäre psychogene Störung),
• dass Belastungen, die im Zusammenhang mit einer Erkrankung entstehen, nicht verarbeitet werden können (somatopsychische Anpassungsstörungen).
Angesichts der großen Bedeutung seelischer Krankheitsfaktoren besteht die Kunst der Diagnostik darin, seelische Leiden nicht durch eine einseitig somatische Abklärung zu chronifizieren und körperliche Erkrankungen nicht zu psychologisieren. Man muss bedenken:
30 Prozent der Patienten in der Sprechstunde des Hausarztes leiden unter psychogenen Störungen!
Die Frühdiagnose ist entscheidend für eine rechtzeitige Einleitung adäquater Behandlungen und oft auch entscheidend für den Behandlungserfolg. Wenn am Krankheitsbeginn eine psychosoziale Auslösesituation steht, die übermäßig belastend ist oder wegen spezifischer Vorerfahrungen nicht verarbeitet werden kann, dann ist der Verdacht berechtigt, dass psychische Faktoren an der Entstehung der Krankheit beteiligt sind. Dagegen reicht es nicht aus, dass keine symptomerklärenden körperlichen Befunde vorliegen.
• Relativ leicht zu erkennen sind reaktive und posttraumatische Störungen. Bei diesen kann die Ätiologie unmittelbar aus den Mitteilungen der Patienten erschlossen werden. Sie besteht in akuten oder chronischen psychosozialen Belastungen, z. B. im Rahmen von chronischen oder bedrohlichen Erkrankungen, oder in Traumaerfahrungen. Dabei sind die Dauer, Intensität und das Ausmaß der Belastung und die Begleitumstände für die Pathogenität maßgeblich. So rufen unverarbeitete Katastrophenereignisse, Unfallerlebnisse, unerwartete Trennungen oder chronische berufliche und Partnerschaftskonflikte reaktive funktionelle und vegetative Störungen, Schmerzzustände oder ängstlich-depressive Verstimmungen hervor.
• Bei neurotischen Störungen, Psychosomatosen und bei den Folgen von frühen Traumatisierungen, an die keine Erinnerung besteht, kann die Krankheitsentstehung schwerer zu durchschauen sein. Hier spielen neurotische Dispositionen mit aktuellen Auslösefaktoren zusammen. Anlass der Krankheitsmanifestation sind meistens lebensübliche Ereignisse, die verdrängte Konflikte oder Traumaerinnerungen wachrufen oder latente strukturelle Defizite der Persönlichkeitsorganisation offenlegen.
Oft genug werden solche Auslöser in ihrer Bedeutung von den Patienten nicht erkannt oder nicht bemerkt. Man kann sie erschließen, wenn man sich einen Eindruck davon verschafft, welche Art von Belastungen sie aufgrund ihrer Entwicklung nicht bewältigen können. Dazu betrachtet man die lebensgeschichtliche Entwicklung und die Lebensereignisse, die zeitparallel zur Krankheitsentstehung aufgetreten sind (Auslösesituation). Entscheidend für die pathogene Wirksamkeit von Belastungssituationen ist das Kriterium, ob sie von den Betroffenen bewältigt werden können – und nicht, ob sie im Allgemeinen häufig oder selten vorkommen und insofern »normal« oder »nicht normal« sind.