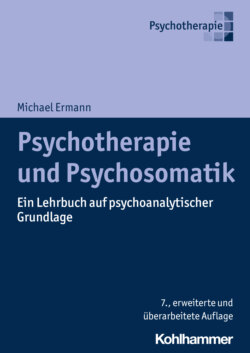Читать книгу Psychotherapie und Psychosomatik - Michael Ermann - Страница 83
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Häufige Affekte
Оглавление| Kulturübergreifende Primäraffekte65 | Weitere Affekte (Beispiele) | |
| • Fröhlichkeit, Freude• Wut• Trauer• Furcht• Ekel• Verachtung• Überraschung | • Liebe• Hass• Hoffnung• Glück• Lust• Begierde• Neid | • Eifersucht• Angst• Scham• Schuld• Stolz• Interesse |
Affekte sind in ihrer Grundstruktur schon bei der Geburt vorhanden und bilden den Kern der Beziehungsrepräsentanzen, die das Selbst mit den anderen verbinden. Sie werden in der Interaktion mit den Pflegepersonen zu kommunikativen Systemen weiterentwickelt.66 Sie sind eng mit körperlichen Reaktionen (z. B. Erröten und Blutdruckanstieg bei Ärger) verbunden und mit dem Erleben von Bedürfnissen und Beziehungen verknüpft. Sie können durch entsprechende Auslösereize aktiviert werden. So entstehen Schmerz und Sehnsucht nach Trennungen, während Verletzungen Hass und Wut hervorrufen.
Affekte dienen der Kommunikation und der Beziehungsregulation. Zu den positiven Affekten gehören Freude, Zuneigung und Leidenschaft. Ekel und Abneigung stellen eine aversive Reaktion dar. Diese Reaktionen entstehen spontan und werden zur Beziehungsregulation eingesetzt. Unter dem Eindruck der Beziehungserfahrungen werden sie modifiziert und weiterentwickelt, so dass Menschen später über ein breites Spektrum verfügen, in denen sich Beziehungserfahrungen abbilden.
Zunächst ist ein Affekt ein körperliches Erleben (»embodied emotion«). Es drückt sich averbal durch sprachloses Empfinden aus. Dieses geht als Körpererinnerung in die frühe Entwicklung des Selbst mit ein. Erst im Verlaufe einer gelingenden Entwicklung werden die »verkörperten« Wahrnehmungen mentalisiert, d. h. es werden Begriffe und Sprachsymbole für das affektive Empfinden gebildet. Diese Entwicklung wird durch Spiegelerfahrungen in den Primärbeziehungen gefördert, indem die Bezugspersonen kontingent (passend) auf die Affektäußerungen antworten. So kann ein Schmerzempfinden durch Berührung (Streicheln) oder tröstende Worte beantwortet werden. Dabei haben die Inhalte weniger Bedeutung als der Stimmklang, die Gestik und der begleitende tröstende Blick.
Auf diese Weise bilden sich Erinnerungen an die vorsprachlichen Interaktionen. Sie werden als affektiv-sensorische Beziehungsrepräsentanzen verinnerlicht, als prozedurale Erfahrungen codiert und bilden Elemente im verkörperten Selbst und der Körpererinnerung (Embodiment). Wenn diese Prozesse sich wiederholen und die kognitiven Strukturen im Gehirn ausreifen, bilden sich im Psychischen äquivalente Begriffe für die Affekte, die Affektrepräsentanzen. Die Affekte werden »symbolisiert«. Sie können »gelesen« oder »begriffen« und sprachlich mitgeteilt werden. Defizite in dieser Entwicklung führen zur Alexithymie. Der Begriff beschreibt die Beeinträchtigung oder Unfähigkeit, die eigenen Affekte (und die anderer) zu »lesen«, und in die Emotionsregulation einzubeziehen. Sie wurde zuerst von der französichen psychoaomatischen Schule bei Psychosomatosen beschrieben67 ( Kap. 12).
Ein bedeutender Entwicklungsschritt ist die Verknüpfung zunächst unverbundener gegensätzlicher Affekte zu einem realitätsnahen Gesamterleben. So ist die innere Welt in der intentionalen Entwicklungsphase, der schizoid-paranoiden Position68 der Frühentwicklung durch die Aufteilung in »nur-gute« und »nur-böse« Beziehungsrepräsentanzen geprägt. Die Überwindung dieser Spaltung ist mit der Entwicklung der Fähigkeit verbunden, ambivalente Gefühle gegenüber sich selbst und anderen zu ertragen und ein realistisches Bild von ihnen zu entwickeln.
Für das Verständnis der psychogenen Störungen ist die Angstentwicklung besonders wichtig, die mit den typischen Entwicklungskrisen entsteht:
• Die basalen, d .h. entwicklungsdynamisch »frühen«, »unreifen« Ängste sind Verlassenheits-, Verschmelzungs- und Verfolgungsängste sowie die Angst um das Selbst (Desintegrations- und Fragmentierungsangst). Man kann sie als paranoide Ängste zusammenfassen.
• In den mittleren Phasen der Kindheitsentwicklung dominieren Ängste vor Trennungen und Objektverlust, d. h. die depressiven Ängste .
• Die späten Phasen der Kindheitsentwicklung werden von Angst vor Liebesverlust, Straf- und Gewissensangst begleitet, den typischen neurotischen Ängsten der psychoanalytischen Krankheitslehre.