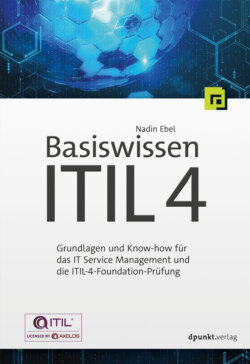Читать книгу Basiswissen ITIL 4 - Nadin Ebel - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2.1.1Wertschöpfungskonfiguration
ОглавлениеDas Vorhandensein von Ressourcen, also den im vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Leistungspotenzialen, in der Organisation alleine ist nicht ausreichend, damit ein Unternehmen Wettbewerbsvorteile erzielt. Es ist notwendig, dass Ressourcen so gestaltet und organisiert (»konfiguriert«) werden, dass diese ihre Potenziale entfalten können (vgl. Barney 2007). Dies bildet dann die Basis für die Vorteile des Service Provider und seiner Kunden und entspricht der Ausgestaltung der Strategie. So kann die Wettbewerbs- und Überlebensfähigkeit auf dem Markt sichergestellt werden. Auf Basis der Stärken und Schwächen werden Chancen genutzt und es wird Bedrohungen begegnet. Dies ist auch eine Basis für die Resilience (Widerstandsfähigkeit) der Organisation.
Die Ausgestaltung und Umsetzung der Wettbewerbsvorteile zeigt sich in der sogenannten Wertschöpfungskonfiguration. Wertschöpfungskonfigurationen skizzieren, in welcher Art und Weise im Rahmen der Leistungserstellung Wert generiert wird bzw. welche Aktivitäten zentral für die Wertschöpfung sind (vgl. Fließ 2009, Stadtelmann et al. 2015). Grundsätzlich wird zwischen Wertkette, Wertshop und Wertnetzwerk unterschieden (vgl. Stabell/Fjeldstad 1998). Einige Veröffentlichungen im IT-Service-Management-Kontext haben das Thema der Wertschöpfungskonfiguration bereits lange vor ITIL aufgegriffen (siehe Abschnitt 2.3). ITIL 4 beschreibt nun explizit die Idee der »Value Chain« und nutzt sie als eine ITIL-4-Komponente des Frameworks (siehe Abschnitt 1.4).
Die Wertkette nach Porter (1985) stellt das Ursprungskonzept der Wertschöpfungskonfiguration dar. Wettbewerbsvorteile ergeben sich aus den Wertaktivitäten, die die Wertkette skizziert (vgl. Porter 1985). Sie wird insbesondere für die Abbildung der Wertschöpfung der Güterproduktion genutzt, findet aber auch für Dienstleistungsunternehmen Anwendung, wenn es um die Transformation von Inputs in Dienstleistungen geht (vgl. Benkenstein et al. 2007). Die Aktivitäten der Wertkette sind nach dem Durchlaufprinzip angeordnet: »Jedes Unternehmen ist eine Ansammlung von Tätigkeiten, durch die sein Produkt entworfen, hergestellt, vertrieben, ausgeliefert und unterstützt wird. All diese Tätigkeiten lassen sich in einer Wertkette darstellen.« Die Wertkette teilt die Tätigkeiten in Bezug auf ihren Beitrag zur Wertschöpfung auf. Es wird nach den Primäraktivitäten und Sekundäraktivitäten bzw. unterstützenden Aktivitäten unterschieden: Die Primäraktivitäten sind Aktivitäten, die der unmittelbaren Herstellung einer Dienstleistung oder eines Produktes dienen (siehe Abb. 1–4). Sie schaffen einen Mehrwert. Die Sekundäraktivitäten unterstützen die Primäraktivitäten bei der Erstellung der Leistung und tragen indirekt zur Wertschöpfung bei. Sie schaffen damit wichtige Voraussetzungen für die Ausführung der primären Aktivitäten (vgl. Schafmeister 2004).Durch Optimierung der strategisch relevanten Aktivitäten zielt das Unternehmen darauf ab, einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen (vgl. Porter 1985).Das Wertkettenmodell stellt eine allgemeine Vorlage zur Skizzierung der Wertschöpfungsaktivitäten dar, die an die Besonderheiten des jeweiligen Unternehmens anzupassen ist (vgl. Porter 2000). Dies ist auch für Dienstleistungsunternehmen möglich (vgl. Volck 1997, Volz/Marti 2001, Dreyer/Oehler 2002). Da bei Dienstleistungen die Vermarktung einer Leistung häufig vor deren Erstellung stattfindet, werden bspw. das Marketing und der Vertrieb der Eingangslogistik vorgeschaltet (vgl. Fantapié Altobelli/Bouncken 1998), die die Beteiligung des Kunden (als externer Faktor) berücksichtigt. Die Ausgangslogistik kann meist aufgrund der Gleichzeitigkeit von Produktion und Konsum der Dienstleistung entfallen (vgl. Fließ 2009).
Abb. 1–4 Modell der Wertkette von Porter (in Anlehnung an Porter 2000)
Wertshop:Die Konfiguration des Wertshops berücksichtigt die individuelle Lösung von Kundenproblemen. Im Zentrum steht hier nicht die Produktion, sondern der Problemlösungsprozess, der durch die primären Aktivitäten abgebildet wird. Diese verlaufen nicht sequenziell, sondern iterativ, zyklisch und häufig interaktiv mit dem Kunden (Akquise und Problemfindung, individuelle Lösungsermittlung, Entscheidung, Ausführung und Evaluation, siehe Abb. 1–5). Falls sich bei der Evaluation zeigt, dass die durchgeführte Maßnahme keine zufriedenstellenden Ergebnisse lieferte, erfolgen die Schritte von der Problemfindung bis hin zur Evaluation erneut. Die Wertschöpfung beruht nicht auf den einzelnen Aktivitäten im Wertshop, sondern auf der der Problemlösung. Sie beruht auf der Problemlösungskompetenz des Service Provider.
Abb. 1–5 Wertshop (in Anlehnung an Woratschek et al. 2002, dort in Anlehnung an Stabell/Fjeldstad 1998)
Wertnetzwerk:Das Wertnetzwerk (vgl. Stabell/Fjeldstad 1998) bildet die Verbindung von Kunden über die Konfiguration der Wertschöpfungsaktivitäten ab. Die zentrale Unternehmensaktivität besteht darin, Kunden bzw. andere Stakeholder zusammenzubringen (»Intermediär«), also Beziehungen und Interaktionen zwischen dem Intermediär und den Kunden sowie zwischen den Kunden untereinander zu etablieren, zu ermöglichen, zu verwalten, zu überwachen und zu beenden. Wichtig sind dabei v.a. die »verbindenden Technologien« (Thompson 1967), die in standardisierter Form für alle Netzwerkteilnehmer bereitgestellt werden und diese verbinden.Als Beispiele für Unternehmen, die der Logik des Wertnetzwerks folgen, können Banken (Zugang zum Ressourcenpool für Geldanleger und Kreditnehmer), Telefongesellschaften (Telefonverbindung zwischen zwei Nachfragern) oder unterschiedlichste Online-Plattformen (z.B. eBay, Facebook, Amazon) angeführt werden. Der Mehrwert für den Nachfrager ergibt sich aus der (simultanen) Beteiligung der anderen Nachfrager am Netzwerk und den Netzwerk-Services.
Abb. 1–6 Wertnetzwerk (in Anlehnung an Woratschek et al. 2002, dort in Anlehnung an Stabell/Fjeldstad 1998)
Während die sekundären Aktivitäten als solche immer unterstützend bereitgestellt werden müssen, gilt es die primären Aktivitäten, die die zentralen Funktionen des Dienstleistungsunternehmens abbilden, genauer zu analysieren, um weitere Wertschöpfungspotenziale zu identifizieren und zu heben. Hierfür ist die kritische Betrachtung der eigenen Dienstleistungsqualität essenziell (vgl. Woratschek et al. 2017).
Auch vor dem Hintergrund der Value Co-Creation (Integrativität, vgl. Prahalad/Ramaswamy 2004) gilt es die weiter zunehmende Bedeutung des Kunden für die Wertschöpfung zu berücksichtigen. Die Wertschöpfungskonfigurationen sollten sich nicht nur auf die unternehmensseitige, autonome Schaffung von Wert fokussieren. Die Konzepte zu den Wertschöpfungskonfigurationen erleichtern Ihnen (bspw. als Mitarbeiter einer IT-Organisation) sowohl den analytischen Blick und das Verständnis für die eigene Organisation als auch für die Kunden Ihrer Organisation und deren Wertschöpfungsaktivitäten. Wo setzt Ihre IT mit Ihren IT Services an? Welche Geschäftsprozesse und -aktivitäten werden dabei unterstützt oder ermöglicht (siehe Abschnitt 1.1)? Die vermeintlich praxisferne Theorie kann Ihnen so dabei helfen, zur Kundenorientierung beizutragen und zu einem geschätzten Unterstützer und Berater für Ihre Kunden zu werden. Dies ist die Grundlage für die sogenannte Wertorientierung, eines der ITIL-4-Grundprinzipien (siehe Kapitel 6).
Der Gedanke der Value Co-Creation wurde auch in ITIL 4 aufgegriffen, explizit herausgestellt und ist Bestandteil des Service-Begriffs geworden (siehe Abschnitt 3.1). Co-Creation steht für kreative Zusammenarbeit und bezeichnet die aktive Teilhabe von Kunden an der Entwicklung neuer Produkte und Services, steht aber auch für die interdisziplinäre Kollaboration in einem Innovations- oder Entwicklungsprozess. Tom Peters und Robert Waterman, ehemals Berater bei McKinsey, empfahlen in ihrem Bestseller »In Search of Excellence« (1982), »nah am Kunden« zu sein und diesen ins Zentrum der Überlegungen im Unternehmen zu stellen. Doch seit ihrem Artikel »Co-Opting Customer Competence« (Harvard Business Review 2000) gelten Coimbatore K. Prahalad und Venkat Ramaswamy als Vorreiter zum Thema »Co-Creation«. Sie betonen die Rolle des Internets, das eine aktive Partizipation von Kunden an der Wertschöpfung unterstützt. Stephan Vargo und Robert F. Lusch forderten 2004 in ihrem Artikel »Evolving to a New Dominant Logic for Marketing« (Journal of Marketing) den Wechsel von einer güterdominierten hin zu einer servicedominierten Logik (»Service-Dominant Logic«) der Wirtschaft. Sie sehen Dienstleistungen als Treiber der Wertschöpfung, an der der Kunde aktiv als »Coproducer« von Produkten und Dienstleistungen beteiligt ist.
Wer Kunden und Nutzer bereits früh an der Service- und Produktentwicklung beteiligt, reduziert mögliche Fehler und falsche Entscheidungen aufgrund von Fehlannahmen. Ansätze und Ideen werden so frühzeitig überprüft, bevor sich die Auswirkungen verstärken und die Revidierung von Fehlentscheidung aufwendig und kostenintensiv wird. Diese Überlegungen spielen nicht nur bei den Grundprinzipien von ITIL 4 eine Rolle, sondern haben auch in die zwölf Gebote agilen Projektmanagements (vgl. Preußig 2018) oder in Inhalte anderer ITSM-Ansätze wie USMBOK Eingang gefunden.