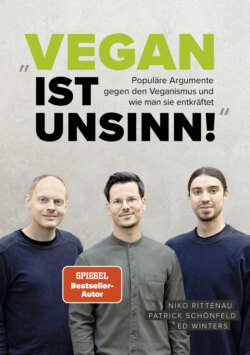Читать книгу Vegan ist Unsinn! - Niko Rittenau - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Moral versus Ethik
ОглавлениеZuvor wurde die Ethik eine Wissenschaft genannt. Zur Verdeutlichung, was die Ethik als Wissenschaft auszeichnet, ist es hilfreich, sie im Kontrast zum Begriff Moral zu betrachten. Diese – auch in der Philosophie oft nicht vorgenommene – Differenzierung kann auf etwas Bedeutsames hinweisen. Denn jeder Mensch vertritt Werte oder hat moralische Haltungen, aber nicht jeder Mensch hat eine ethische Position.
Unter Moral kann die Gesamtheit der normativen Überzeugungen verstanden werden, die in einer Gesellschaft oder einer Teilgruppe von ihr existieren, selbst wenn diese eventuell nicht ausdrücklich artikuliert werden. Auf der individuellen Ebene ließen sich dementsprechend die verschiedenen normativen Ansichten einer Person als die moralischen Überzeugungen bezeichnen. Betrachtet man die moralischen Normensysteme von Gesellschaften, Gruppen oder Einzelpersonen, so fällt schnell auf, dass sie grundlegende Minimalanforderungen der Wissenschaftlichkeit nicht oder nur unvollständig erfüllen. Was die Ethik also von der Moral trennt, ist das Einhalten der Mindestanforderungen der Wissenschaftlichkeit – oder wenigstens der Anspruch sie einzuhalten. Im Kern geht es dabei um drei Minimalanforderungen:43
Konsistenz: Von einer Wissenschaft wird verlangt, dass ihre normativen und/oder deskriptiven Sätze konsistent sind, sich also nicht logisch widersprechen. Einem Beitrag, der zugleich behauptet, dass Rauchen das Lungenkrebsrisiko erhöht und dass einzig und allein die Genetik darüber entscheidet, ob ein Mensch an Lungenkrebs erkrankt, wird man zu Recht Wissenschaftlichkeit absprechen. Unsere Alltagsmoral erfüllt diesen Anspruch oft nicht. Wir halten es beispielsweise für wichtig, leidensfähigen Tieren kein unnötiges Leid zuzufügen, während wir als Gesellschaft gleichzeitig Dutzende Zuchtrassen von Hunden und Katzen für vertretbar halten, bei denen kein Zweifel besteht, dass sie einzig und allein für unsere ästhetischen Präferenzen so gezüchtet wurden, wie sie heute aussehen, und dabei körperlich unter ihrer Zucht leiden.
Abb. 2: Abbildung eines Mopses vor und nach der selektiven Züchtung (1802 vs. 2012)
Der Mops im 19. Jahrhundert unterscheidet sich deutlich von dem aktuell in Deutschland gültigen Rassestandard. Im Vergleich zum heutigen Mops mit rundem Kopf und stumpfem Körper war er früher deutlich hochbeiniger, besaß eine längere Schnauze und tiefliegendere Augen. Bei Tieren mit gekürzter Nase wie dem Mops lassen die feinen Lamellen der Nasenmuscheln kaum noch Luft durchströmen und aufgrund ihrer hervorquellenden Augen neigen sie vermehrt zu Hornhautentzündungen.
Kohärenz: Von einer Wissenschaft wird gefordert, dass ihre normativen und/oder deskriptiven Sätze ein kohärentes Ganzes ergeben, also in einem sachlichen Zusammenhang zueinander stehen bzw. einen »roten Faden« erkennen lassen, und nicht einfach nur zusammenhanglose Einzelelemente darstellen. Unsere Alltagsmoral wird auch dieser Minimalanforderung oft nicht gerecht, denn unsere moralischen Überzeugungen folgen keineswegs immer einem grundlegenden Prinzip und existieren häufig nebeneinander ohne sachliche Verbindung. Wir haben moralische Haltungen zu unterschiedlichsten Themen, ohne dass sie eine Ableitung aus einem leitenden normativen Ansatz wären. Vielfach wird nicht einmal die Frage gestellt, ob die eigenen Wertvorstellungen in irgendeiner inhaltlichen Verbindung zueinander stehen könnten oder sollten. In der Ethik werden einzelne Handlungen bzw. Sichtweisen hingegen nicht einfach völlig losgelöst voneinander betrachtet: Es wird ein ethisches Modell zugrunde gelegt (z. B. eine Vertragstheorie, eine Mitleidsethik oder ein utilitaristischer Ansatz),44 von dem aus eine Einschätzung gegenüber den einzelnen ethischen Fragestellungen erfolgen kann.
Luzidität: Von einer Wissenschaft wird erwartet, dass von ihr verwendete Begriffe luzide, also verständlich, klar und eindeutig sind. Begriffe müssen demnach, wo nötig, definiert werden. Einige Grundbegriffe unserer Alltagsmoral werden diesem Anspruch ebenfalls nicht gerecht. Der Versuch, Menschen um eine Erklärung zu bitten, was sie beispielsweise damit meinen, wenn sie von »Würde« oder »Ehre« sprechen, offenbart sehr schnell, dass unsere im Alltag verwendeten Begriffe oft nicht luzide sind.
Zusätzlich zu diesen drei allgemein akzeptierten Mindestanforderungen ließe sich darüber hinaus noch einwerfen, dass der Anspruch an Wissenschaftlichkeit eine empirische Überprüfbarkeit voraussetzt. Das bedeutet, dass Aussagen, die das Bestehen eines Sachverhaltes behaupten, zumindest prinzipiell überprüfbar sein sollten. Dies ist in den Naturwissenschaften eine Selbstverständlichkeit. In der Ethik existieren allerdings zahlreiche Ansätze, deren Grundsätze sich einer Überprüfung entziehen. Ein klassisches Beispiel, das hier angeführt werden kann, stellt Arthur Schopenhauers berühmte Preisschrift über die Grundlage der Moral dar, in der er schrieb, dass die »Abwesenheit aller egoistischen Motivation […] das Kriterium einer Handlung von moralischem Wert« sei.45 Gesetzt, dass überhaupt davon ausgegangen wird, dass es gänzlich unegoistische Handlungen geben kann: Es ist in der Praxis nicht möglich festzustellen, ob die Handlung einer Person aus egoistischen oder selbstlosen Gründen erfolgt ist. Es handelt sich also um ein Kriterium ohne praktischen Wert. Als vierte Minimalforderung könnte daher formuliert werden, dass auch in den normativen Wissenschaften nur die (An-) Sätze zulässig sein sollten, die sich wenigstens nicht grundsätzlich einer Überprüfbarkeit entziehen. Aus Konsistenzgründen abgeleitete Schlussfolgerungen können hier eine Ausnahme bilden.
Die Erläuterung dieser wissenschaftlichen Minimalstandards sollte eine grobe Vorstellung davon erzeugt haben, was die Ethik ganz allgemein von unseren moralischen Vorstellungen trennt: Ethik ist die systematische, sich an wissenschaftliche Grundregeln haltende Analyse, die unsere Handlungen und die Organisation unserer Gesellschaft zum Gegenstand hat. Vereinfacht gesagt beschäftigt sich die Ethik mit der Theorie der Moral. Somit ist Ethik sozusagen die Wissenschaft über die Moral. Während also »Moralen« koexistieren können, kann es nur eine Ethik als wissenschaftliche Disziplin geben. Wenn »Don’t go Veggie«-Autor Udo Pollmer also sagt, Moral würde immer dann vorgeschoben, wenn man keine Argumente mehr für eine Position habe,46 dann ist das zwar grundsätzlich nicht falsch, und tatsächlich kann man in sich widersprüchliche und damit irrationale moralische Werte als »Ausrede« für fehlende stichhaltige Argumente vorschieben, die einem Konsistenztest nicht standhalten und damit nicht geeignet sind, eine Handlung (oder die Unterlassung einer Handlung) zu rechtfertigen. Aber wenn es um die Tierethik als wissenschaftliche Disziplin sowie stringent formulierte ethische Kritik an einem System wie der Tierhaltung geht, dann kann man diese nicht ohne stichhaltige Gegenargumente einfach abtun, als wären das rein subjektive Pseudoargumente oder willkürlich erfundene Ausreden. Somit ist das moralische Argument für den Veganismus auf Basis der Tierethik ganz und gar nicht ein vorgeschobenes Argument, weil es an anderen gewichtigen Argumenten fehlt. Es ist im Gegenteil der Kern des Veganismus als soziale Gerechtigkeitsbewegung. Die Kritik am Speziesismus ist ebenso wie Kritik an Rassismus und Sexismus solide ethisch begründbar und bedarf keines ökologischen oder gesundheitlichen Zusatznutzens, um legitimiert zu werden. Frauenrechte existieren in der Gesellschaft nicht deshalb, weil sich Männer davon Vorteile erhoffen. Es geht dabei um das Wohl der Frauen. Ebenso müssen Tierrechte nicht darauf fußen, dass sich Menschen davon persönliche Vorteile erhoffen, sondern es geht ausschließlich um das Wohl der Tiere. Aber warum sollte man Tieren gegenüber eigentlich gerecht sein?