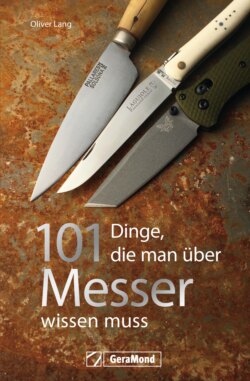Читать книгу Handbuch Messer: 101 Dinge, die Sie schon immer über Messer wissen wollten. - Oliver Lang - Страница 12
7 Sicher im Handling Halte- und Arretierungsmechanismen
ОглавлениеWer seine Finger schätzt – und wer tut das nicht? –, sollte beim Hantieren mit dem Messer vorsichtig sein. Immer schön kontrolliert arbeiten, vom Körper wegschnitzen … Der Arbeitssicherheit besonders zuträglich sind Mechanismen, um die Klinge an einem versehentlichen Einklappen zu hindern. Und da gibt es zahlreiche. Die wichtigsten erklären wir hier.
Aufreibend einfach – Friction Folder Die Klingen der ersten Klappmesser wurden vor allem durch ihre Reibung an den Griffschalen am Einklappen gehemmt. Sie werden deshalb international als Friction Folder, also Reibungs-Klappmesser bezeichnet. Für das einfachste aller Klappmesser braucht es nur drei Bauteile: Klinge, Achsniet und Griff. Mit dem Griff ist die Klinge per Niet verbunden. Eingeklappt liegen Klinge und Spitze in einem Griffausschnitt. Herausgeklappt stößt das Klingenende am Griff an oder schlägt, sofern der Klingenrücken zu einem Hebel verlängert wurde, auf dem Griff auf. Bei manchen Konstruktionen liegt das Klingenrückenende auch auf einem separaten Anschlag. Bis heute ist dieser einfache Messertyp in vielen Ländern populär, etwa in Frankreich (Piemontais), Spanien oder Japan (Higonokami). Wer mit einem solchen Messer nur schneidet, ist also auf der ziemlich sicheren Seite. Ziemlich deshalb, weil sich eine Klinge auch mal im Schneidgut verklemmen kann oder man beim Hantieren mit dem Klingenrücken gegen etwas stößt.
Unter Druck gesetzt – Slipjoints Als Mitte des 17. Jahrhunderts konstant reproduzier- und belastbarer Federstahl entwickelt wurde, konnten Klappmesser mit einem Rückenfeder-Haltemechanismus ausgestattet werden. Dabei drückt eine entlang des Griffrückens liegende Feder auf einen stufenförmigen Ausschnitt in der Klingenwurzel. Diese Federkraft hält die ausgeklappte Klinge – ohne sie zu arretieren – in Arbeitsposition und verhindert bei eingeklappter Klinge ein versehentliches Aufgehen. Ein typisches Beispiel dafür ist das Schweizer Offiziersmesser.
Bei französischen Slipjoints wie dem Laguiole sieht man häufig auch eine stärker haltende Abwandlung dieser einfachen Konstruktion. Dabei ist das Ende der Feder nicht glatt, sondern zu einem »Hammerköpfchen« verfügt, das in eine speziell geformte Kerbe in der Klingenwurzel greift. Das erhöht zunächst den Widerstand beim Einklappen der Klinge – und damit die Arbeitssicherheit. Ist die Klingenwurzel zudem mit Stufen oder kantig geformt, rastet die Klinge während des Klappvorgangs ein. Rastet die Klinge bei 90 Grad ein, spricht man von einem Half-Stop.
Beim Slip-Joint hält eine zähelastische Rückenfeder die Klinge in Arbeitsposition, arretiert diese aber nicht.
Den Dreh raus – Drehmanschetten-Sicherung Bei dieser Klingensicherung kommt auf den runden Griffabschluss zunächst eine Blechmanschette. Der Achsniet, meist ein einfacher Stahlstift, reicht durch diese Manschette hindurch. Seine beiden Enden laufen in der rundum reichenden Schiene einer weiteren Manschette, die drehbar ist. Dreht man diese äußere Manschette, schiebt sich deren Oberkante vor den Schlitz des Griffes und verhindert so ein versehentliches Einklappen der Klinge. Opinel nennt diese Sicherung Virobloc. Auch Nontron, einer der ältesten Messerhersteller Frankreichs, setzt bereits seit Mitte des 17. Jahrhunderts auf einen ähnlichen Drehringmechanismus. Das macht diese Methode zu einem der ältesten Verriegelungsmechanismen für Klappmesser überhaupt.
Hammerhart – Back-Lock Wann genau der Back-Lock (auch als Lock-back bekannt) erfunden wurde, ist unklar, vermutlich jedoch bereits im 19. Jahrhundert. Populär wurde er mit einer Stilikone: dem 110 Folding Hunter des US-amerikanischen Herstellers Buck Knives. Das kam 1964 auf den Markt (s. auch Kapitel 22). Entlang des Griffrückens liegt ein um einen Achsniet schwenkbarer Arretierhebel. Das Ende dieses Verschlussstücks ist zu einem Hammerkopf geformt. Eine entsprechend geformte Nut befindet sich in der Wurzel der Klinge. Von der Griffinnenseite her drückt eine Feder das Ende des Arretierhebels nach oben – und damit den Hammer in die Nut. Zum Lösen der Arretierung muss man den Hammerkopf »hochwippen«, indem man das Ende des Arretierhebels gegen die Federkraft in den Griff drückt. Bei eingeklappter Klinge drückt der Hammer (wiederum durch die Kraft der Feder) auf eine Kante an der Unterseite der Klingenwurzel. Dadurch klappt die Klinge nicht versehentlich von alleine aus dem Griff. Bei der belastbaren Lock-Variante »Tri-Ad Lock« von Andrew Demko schlägt die ausgeklappte Klinge nicht direkt auf den Arretierhebel auf, sondern auf einen separaten Anschlagniet.
Bei den Back-Lock-Varianten wird der Hammerkopf des Arretierhebels über eine Feder in die Aussparung der Klingenstufe gedrückt.
Back-Lock: Der japanische Hersteller Moki ist bekannt für die präzise Anpassung seiner Back-Lock-Arretierungen, bei denen der Übergang zwischen Arretierhebel und Klingenrücken nahezu unsichtbar ist.
Durchgang gesperrt – Liner-Lock Hinter dem Liner-Lock steckt ein bewährter Mechanismus, der so funktioniert: Im Inneren des Griffes – entlang des Griffschlitzes – befindet sich eine Stahlplatine, die so geformt ist, dass sie in Richtung der anderen Griffinnenseite federt. Ist die Klinge ganz ausgeklappt, tut diese Sperrfeder das auch und legt sich dabei hinter die Klingenwurzel. Das Einklappen der Klinge ist erst möglich, wenn man die Sperrfeder wieder zur Seite schiebt. Als Klingenanschlag und um die eingeklappte Klinge im Griff zu halten, wird eine herkömmliche Rückenfeder eingesetzt. Dieser immer noch benutzte Mechanismus (etwa bei den 111er-Modellen von Victorinox) ist zwar zuverlässig, aber nicht so präzise und spielfrei ausgeführt wie der Liner-Lock, den Michael Walker 1981 entwickelte. Dabei schlägt die Sperrfeder (der Locking Liner) direkt an der schräg geformten Klingenwurzel an und drückt die Klinge gegen den Anschlag-Bolzen (auch Stopp-Pin). Eine Rückenfeder ist nicht mehr nötig, was offene Griffgestaltungen ermöglicht und Gewicht spart. Damit das Ganze zuverlässig funktioniert und die Sperrfeder nicht alleine durch Druck oder Schlagbelastungen zur Seite rutscht, muss der Mechanismus sauber gearbeitet sein.
Vorläufer des Liner-Locks: Bei diesem Elektrikermesser von Klein Tools blockiert eine Metallplatine die Klinge.
Um ein versehentliches Ausklappen der eingeklappten Klinge zu verhindern, nutzt man üblicherweise einen Detentball. Das ist eine kleine Stahlkugel, die fix mit dem Ende der Sperrfeder verankert ist und durch die Federkraft in eine entsprechend geformte Mulde in der Klingenwurzel gedrückt wird. Mittlerweile gibt es auch Slipjoints (siehe Beginn des Kapitels), die anstelle einer Rückenfeder auf Detentballs setzen, um die Klinge am allzu leichten Einklappen zu hindern.
Harte Tür – Frame-Lock Der Frame-Lock wurde 1987 erstmals vom südafrikanischen Messermacher Chris Reeve eingeführt und wird auch Integral Lock oder Mono-Lock genannt. Im Gegensatz zur Sperrplatine des Liner-Locks federt hier der nach innen federnde Ausschnitt einer der Griffhälften hinter die Klingenwurzel. Das Ende schlägt an der Schräge der Klingenachse an und drückt die Klinge gegen den Stopp-Pin. Zum Einklappen der Klinge drückt man die Arretierfeder gegen ihre Federkraft nach außen. Besteht der arretierende Griffausschnitt aus einem weicheren Metall als die Klinge, wie etwa Aluminium oder Titan, ist die Feder im Bereich des Anschlags oft mit einem Metalleinsatz aufgerüstet, was Verschleiß entgegenwirkt.