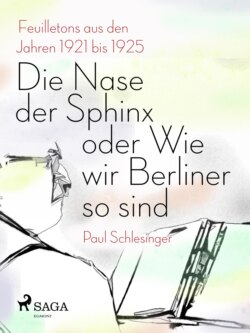Читать книгу Die Nase der Sphinx oder Wie wir Berliner so sind - Paul Schlesinger - Страница 3
Wie wir Berliner so sind
ОглавлениеVon einer sehr unbeliebten Nation kann man wohl behaupten, daß sie eines nicht sei: kokett. Unter den Deutschen sind wir Berliner die unbeliebtesten. Wir gehen allen anderen auf die Nerven. Wir wissen das, ändern aber nichts an unserem Betragen. Denn wir haben keine Lust, uns zu verstellen. Das ist unsere Tugend.
Wir sind immerhin stolz und bewußt genug, um darüber unterrichtet zu sein, daß wir eine Reihe ausgezeichneter Eigenschaften haben. Aber wir tragen sie nicht wie Sandwichmen auf Brust und Rücken. Wir überlassen es den anderen, unsere Tugenden zu finden. Daß diese sie nicht einmal suchen, spricht nur gegen die Intelligenz der anderen. Wären diese Leute wirklich klug, würden sie lieber mit angenehmen als mit unangenehmen Menschen zusammensein. Sowie sie aber unseren guten Eigenschaften auf die Spur kommen, wenden sie sich ab, sie können es nicht vertragen, daß wir (neben allem anderen) auch noch liebenswürdig sind.
Eines unserer Hauptverdienste ist, daß wir Berlin bewohnen. Das ist sozusagen eine Last, die wir für die ganze Nation auf uns genommen haben. Anstatt uns dafür auf den Knien zu danken, sagt man uns ins Gesicht, Berlin sei scheußlich, und wir seien daran schuld.
Der Berliner aber ist bis zu dem Grade wahrheitsliebend, daß er ebenfalls behauptet, Berlin sei scheußlich – was wiederum nur auf seinen Mangel an Koketterie zurückzuführen ist. Jeder Einwohner von Neustadt an der Knatter oder ähnlichen Metropolen ist überzeugter von den Schönheiten seiner Heimat als der Berliner von den Vorzügen seiner Vaterstadt. Deshalb wurde auch nichts aus Neustadt, wohingegen Berlin – ich würde es loben, wenn ich nicht Berliner wäre.
Den äußersten Mangel an Koketterie zeigt der Berliner in seiner Behandlung der deutschen Sprache. Man beachte nicht nur Gespräche von Müllkutschern, sondern etwa das Frühlingsgezwitscher der Berliner Schulmädel. Mit dem Ausdruck einer gewissen Übelkeit werden die Worte herausgequetscht und auf das Straßenpflaster geworfen, von den Straßenfegern zusammengekehrt. Ein unerhörtes Temperament tut sich kund, das kein anderes Objekt hat als die deutsche Sprache. Die Beinchen sind krumm vom Asphalt, die Augen stumpf von den hohen Häuser, die armen Händchen greifen in die dicke, von Industrie geschwängerte Luft. Jedes Rasenplätzchen eingezäunt – und meist zu weit entfernt für die spärliche Freistunde. Das Kleidchen muß geschont werden, die Stiefel nicht minder, und sogar die Schürzen haben die Aufgabe, sauber zu sein. Was nicht immer gelingt. Das einzige, womit das Berliner Kind machen kann, was es will, ist die deutsche Sprache. Wir kennen die Folge.
Das Wahrzeichen unseres Mangels an Koketterie ist die Berliner Droschke. In anderen Städten und Ländern ist es etwas Feines, Droschke zu fahren. Kutscher, Pferd und Gast und Wagen haben ein Bewußtsein davon. Die kunsthistorische Bildung des Florentiner Kutschers, der beißende Witz des Parisers, die unnachahmliche Eleganz des Wiener Fiakers findet in Berlin kein Gegenstück. Sogar der Münchner Kutscher hat einen Ehrgeiz, er tut so, als sei er zugleich der Diener auf dem Bock und springt ab, um dem Fahrgast den Schlag zu öffnen. Der Berliner steht zu dem Fahrgast in gar keinem Verhältnis. Am Ende des Krieges gab es eine Zeit, in der er wenigstens versuchte, ihn zu betrügen. Auch das hat aufgehört. Er ist sachlich, und er rechnet auf kein Trinkgeld. Er ist nicht von dem Gefühl durchdrungen, einer Equipage vorzustehen, oder der Fahrgast sei etwas Feineres als er selbst, und er trägt den zweiundzwanzigmal geflickten blauen Mantel mit demselben Gleichmut, mit dem der Fahrgast sich auf das zerschlissene Polster niedersetzt. Auch er hat nicht das Gefühl, der Welt Bewunderung dadurch abzuringen, daß er Droschke fährt.
Der Berliner liebt es, zuzeiten ein gut geführtes, wohlausgestattetes Restaurant aufzusuchen. Dort haben die Kellner eine gewisse Haltung, die eine Mischung von Hochmut und Bedientenhaftigkeit ist. Unter diesen vornehmen Kellnern befinden sich selten Berliner. Der Eingeborene unterliegt zuweilen den Reizen der Vornehmheit. Er ist leicht befangen, und wenn er mehr zahlt, als er eigentlich mußte, so ist es aus Schüchternheit. Aber es gibt auch Berliner, die nicht schüchtern sind, und die machen Krach, wenn ihnen eine zu hohe Rechnung vorgelegt wird. Niemals zahlt der Berliner, weil er das für vornehm hält. Immer läßt er seinen Gefühlen freien Lauf: entweder es kracht, oder er ist eben schüchtern.
Wenn der schüchterne Typ sich auf die Reise begibt, hält ihn niemand für einen Berliner. Der krachmachende Typ ist außerordentlich unbeliebt – besonders bei den Kellnern.
Im Grunde haben wir alle ein bißchen von Michael Kohlhaas. Ich erinnere mich an eine Fahrt über den Bodensee vor einigen Monaten. Ich stand oben auf dem Verdeck neben der Kommandobrücke, als ein rot angelaufener Herr dahergestürmt kam und den Kapitän zu sprechen wünschte. Dies war der Tatbestand: Der Herr reiste mit zwei Damen. Während er und seine Frau sich noch um das Gepäck kümmerten, war die zweite Dame in die Kajüte gegangen, hatte sich bei dem Kellner ein Schnitzel bestellt. Bevor dieser Befehl noch ausgeführt war, kam der Herr mit seiner Frau dazu und bestellte (in Unkenntnis des bereits verlangten Schnitzels) deren drei. Infolgedessen brachte der Kellner vier. Der Kellner verlangte dafür auch Bezahlung. Jeder andere hätte das vierte Schnitzel (so überwältigend groß war es ja nicht) gegessen und bezahlt. Der Herr war aber aus Berlin. Infolgedessen machte er einen unerhörten Krach, der Kellner kam ihm nachgelaufen und krachte mit. Wer sich in der Nähe des Zankenden zeigte, wurde angezapft: »Mein Herr, wollen Sie Schiedsrichter sein.«
Als wir auf der Schweizer Seite ankamen, ließ man den Berliner nicht vom Schiff, ehe er bezahlt hatte. Das Schnitzel aß später der Kellner. Dieser Berliner hatte sich sehr lächerlich gemacht, aber ich liebe ihn gerade, weil er so gar nicht kokett war, sondern seine Lächerlichkeit mitten auf dem Bodensee angesichts der Schweizer Alpen und einiger mitreisender Ententediplomaten ausbreitete. Die anwesenden Süddeutschen und Schweizer lächelten vergnügt vor sich hin und sagten: »Ein Berliner.« Niemand ist auf den Gedanken gekommen, daß der Restaurateur des Schiffes kulanterweise hätte sagen können: »Verzeihen Sie den Irrtum, ich nehme das Schnitzel mit Vergnügen zurück – die Schnitzel, die Sie gegessen haben, sind ja auch von gestern.« Daß er das nicht gesagt hat, hätte man ihm nur verübelt, wenn sich die Szene nicht auf dem Bodensee, sondern auf dem Wannsee abgespielt hätte. Die Bewohner von Nichtberliner Gegenden können eben noch auf ganz anderen Gebieten machen, was sie wollen, wie wir, die eben nur die deutsche Sprache zur Verfügung haben.
März 1921