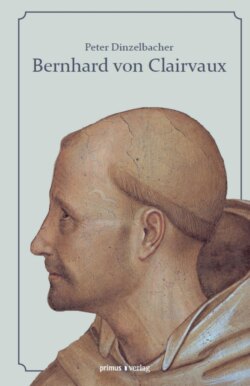Читать книгу Bernhard von Clairvaux - Peter Dinzelbacher - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
„Über die Stufen der Demut und des Stolzes“ (1124)269a
ОглавлениеWahrscheinlich im Jahre 1124 verfaßte Bernhard seinen ersten Traktat.270 Thema: die Stufen der Demut und des Stolzes, De gradibus humilitatis et superbiae.271 Es ist ein ganz auf Probleme des mönchischen Lebens konzentriertes Werk, das teilweise in den Handschriften sogar als Kommentar zur Benediktusregel eingeordnet wurde, von der es in der Tat ausgeht. Obschon Bernhard selbst am Beginn manche Unsicherheit erkennen läßt und auch die eine oder andere seiner Überlegungen später korrigieren mußte, sind typische Charakteristika seiner Weise, Theologie zu betreiben, seiner auf Erfahrung gegründeten Religiosität und seiner mitreißenden schriftstellerischen Begabung sehr deutlich ausgeprägt. Auch die für ihn typische dichte Folge von expliziten und angedeuteten Schriftzitaten, die Bernhard zum Bibeltheologen macht, durchwebt diesen Text. Seine persönliche Erfahrung formte er vermittels der biblischen Bilder, die sein Denken überfluteten.272
Das fiel schon Zeitgenossen auf, und Johannes von Salisbury (1115–1180), selbst einer der fruchtbarsten Autoren der Epoche, fügte eine Lobrede auf Bernhards hervorragenden Bibelstil in seine Papstgeschichte ein.273 Es gehörte freilich einfach zum Wesen eines führenden Theologen der Zeit, „Scripturae divinae plenissimus“, „ganz gefüllt mit der Heiligen Schrift,“ zu sein, um die Worte von Sugers Biograph zu gebrauchen.274 Sehr zu Recht formulieren Verger und Jolivet: „Die Mystik und Spiritualität Bernhards würden sich nicht in unbiblische Formeln übertragen lassen, ohne nicht nur ihre Originalität und ihr Fluidum zu verlieren, sondern ihre raison d’être selbst“.275 Bernhard las die Schrift oft der Reihe nach durch.276 Sein Lieblingsbuch neben dem Hohenlied waren die Psalmen, natürlich auswendig gewußt schon seit den Schultagen und durch die klösterliche Liturgie täglich ins Gedächtnis gerufen, dann die anderen Weisheitsbücher des Alten Testaments und danach die Evangelien und die Paulusbriefe.277
Das „opusculum“ antwortet auf eine Bitte seines Vetters Gottfried von La Roche, der seinerzeit zugleich mit ihm die Welt verlassen hatte und den wir bereits als Gründungsabt von Fontenay kennengelernt haben. Grundlage der Schrift ist das 7. Kapitel der Benediktusregel, das Bernhard beim Empfänger und allen Lesern, an die er dachte, natürlich als auswendig gewußt voraussetzen konnte. Der Aufstieg zu Gott ist dort im Bild einer Leiter gezeichnet, auf der der Mönch „Tugend um Tugend“ hinansteigt. Die Metapher ist Genesis 28, 12 entnommen, wo der Traum Jakobs von der Himmelsleiter mit ihren auf- und absteigenden Engeln beschrieben ist, und sie paßte besonders gut auf das Leben der Mönche, die ja eine engelgleiche Existenz auf Erden anstrebten.278
Wie alle anderen Bücher Bernhards ist auch dieses trotz des von der Regula monasteriorum vorgegebenen Gerüstes nicht streng systematisch, gibt es doch den einzelnen Stufen der Tugendleiter nicht gleich viel Raum, enthält es größere und kleinere Digressionen. Dabei ist Bernhard offensichtlich von einer Predigt279 des Augustinus angeregt, die von den sieben Gnadengaben nach Isaias handelt, die als Abstieg vom Höheren zum Niedereren vorgeführt werden.280 Dieser Kirchenvater wird auch einmal als „quidam sanctus“,281 als ein gewisser Heiliger verdeckt zitiert (wie es Bernhard und seine Zeitgenossen gern machten); er zählt neben Gregor dem Großen ohnehin zur Lieblingslektüre Bernhards,282 wenn man von der Bibel absieht.
In manchen Passagen ist De gradibus vielleicht eine seiner lebendigsten Schriften, ein engagierter Protreptikos zu Demut, Gehorsam und Selbsterkenntnis. Den Eindruck der „Lebhaftigkeit“ erweckt der Text einerseits durch den teilweise dialogähnlichen Aufbau: Bernhard spielt hier die Rolle des Lehrers, der seine Interpretationen entwickelt, als ob er auf die Fragen und Einwände seines Schülers zu antworten hätte, ein Procedere, das in der didaktischen Literatur des Mittelalters ungemein beliebt war und letztlich auf die platonischen Dialoge zurückgeht. Die Wissensliteratur des Mittelalters ist voll von (allerdings strenger durchgeführten) Lehrschriften dialogischer Struktur; von Zeitgenossen Bernhards seien nur Anselm von Canterbury (Cur Deus homo), Wilhelm von Conches (Dragmaticon philosophiae), Abaelard (Dialogus inter philosophum, iudaeum et christianum) und Honorius Augustodunensis (Elucidarium) genannt.283 Bernhard jedoch spricht außerdem mehrfach Gestalten der Bibel an, als ob sie vor ihm ständen: Dina, die Tochter Jakobs und Leas, die ihre Jungfräulichkeit verlor, Eva, die erste Sünderin, und Luzifer, den gefallenen Engel.284 An Eva etwa wendet er sich angelegentlich des Bisses in den Apfel so: „Du schlürfst, dem Untergang geweiht, das Gift und wirst dem Untergang Geweihte gebären. Zugrunde geht das Heil, das Gebären geht weiter …“ Es lohnt sich, diese Stelle mit ihrem unnachahmlichen Spiel mit Futurpartizipien im Original zu lesen: „Hauris virus peritura, et perituros paritura. Perit salus, non destitit partus. Nascimur, morimur: ideoque nascimur morituri, quia prius morimur nascituri „285 Der letzte Satz zeigt auch, daß Bernhard sich bisweilen seiner überpointierten Sprache286 wegen an die Grenze des theologisch exakt Verständlichen begibt, auch wenn er inhaltlich offenbar Augustinus folgt.287 Natürlich „sterben wir, ehe wir daran sind, geboren zu werden“, weil wir von Eva die Erbsünde geerbt haben, aber sind wir nicht auch durch Christus vom Tode erlöst?
In seinem Traktat läßt Bernhard seinen Vetter Gottfried de La Roche zunächst an seinem Zögern teilhaben, ob er das bisher nur mündlich Vorgetragene wirklich dem Pergament anvertrauen solle – ein passender Demuts-Topos am Beginn eines Werkes über diese Tugend, aber vielleicht mehr als das, hatte sich Bernhard doch noch nicht in größerem Maße als Schriftsteller betätigt (später sollte man von ihm dann „um die Wette“288 Lehr- und Erbauungsschriften erbitten und ihm solche auch mit dem Ersuchen um Korrektur widmen289).
Bald aber ist er mitten im Thema: der Aufstieg von Tugend zu Tugend bis zum Gipfel der Demut, von dem aus man, wie vom Berge Sion, die Wahrheit erblickt.290 Der erste Teil (1,1–9,27) reflektiert besonders über die Definition von Demut, über das Vorbild Christi und seine Inkarnation. Eine christologische Abschweifung zeigt den Erlöser, der „uns näher geworden ist“ durch sein Leiden,291 eines der neuen Frömmigkeitsmotive der Epoche.292 Auch das Thema der Liebe, über das Bernhard später so eindrucksvoll und folgenreich schreiben wird, klingt schon verhalten an, im Preis des Mitleidens mit fremdem Elend.293 Ganz wichtig ist dem Abt Selbsterkenntnis als Basis des Aufstiegs – ebenfalls ein Motiv, das in der Zisterzienserschule des 12. Jahrhunderts von vielen Autoren mit Ausführlichkeit behandelt werden sollte (wobei anscheinend die Ambrosius-Rezeption wichtig war) und das eines der Zeugnisse für die mentalitätsgeschichtlich neue Orientierung jener Epoche auf das Individuum darstellt.294 In der Tat kann Bernhard als „Theologe der religiösen Subjektivität“295 bezeichnet werden. Ohne sich zu erkennen, so Bernhard, kann niemand selig werden.296
Zitieren wir dazu eine kurze Stelle, die die Konsequenz der Selbsterkenntnis vorführt, nämlich den Abscheu vor der eigenen Sündhaftigkeit, woraus Demut resultiert, um an diesem beliebig herausgegriffenen Beispiel die typisch Bernhardische Formulierungskunst wenigstens andeutungsweise zu illustrieren: „Quos itaque Veritas sibi iam innotescere, ac per hoc vilescere fecit, necesse est, ut cuncta, quae amare solebant, et ipsi sibi amarescant. Statuentes nimirum se ante se, tales se videre cogunt, quales vel a se videri erubescunt“.297 „Für die also die Wahrheit bewirkt hat, daß sie sich selbst bekannt und dadurch gering werden, ist es nötig, daß ihnen alles, was sie zu lieben pflegten, und sie sich selbst bitter zu werden beginnen. Sich selbst gegenübergestellt, zwingen sie [sich], sich so zu sehen, daß sie erröten, sogar [bloß] von sich selbst gesehen zu werden.“ Besonders liebt Bernhard Parallelen, wie sie hier die Homoioteleuta (Worte mit gleicher Endung) „innotescere“ und „vilescere“ verkörpern. Und er liebt auch Spiele mit ähnlich lautenden Worten: „amare“ und „amarescere“, sowie mit verschiedenen Formen desselben Wortes: „videre“ und „videri“. Sicher hätte ein Römer aus der Zeit der klassischen Latinität den ersten Satz nicht so konstruiert, aber für das 12. Jahrhundert ist der zeugmatische Gebrauch eines Verbs als transitiv auf ein Objekt („cuncta“) gerichtet und zugleich intransitiv mit dem reflexiven „sibi“ verbunden kaum befremdlich.
Es ist in diesem Prozeß der Betrachtung des eigenen Innenzustandes die von Bernhard keineswegs verachtete Vernunft, die Christus dem Menschen gleichsam als seine Stellvertreterin gegeben hat, „ipsa sui accusatrix, testis et iudex“,298 als Anklägerin ihrer selbst, als Zeugin und Richterin. Das Ergebnis der Vereinigung von Vernunft und Wort (Gott) ist Demut. Die von der Vernunft empfohlenen Mühsale der Demut führen zum Affekt des Mitleids mit anderen, Zeugnis der Liebe; es folgt, von der Reinheit bewirkt, die Entrückung in der Kontemplation.299 Damit ist eines der großen Themen der christlichen Mystik angesprochen, die ekstatische Schau. Bernhard deutet hier nur kurz an, was er später vor allem in seinen Hohelied-Predigten ausführlich entwickeln sollte. Aber schon jetzt wird diese alttestamentliche Liebesdichtung zur Umschreibung der Unio mystica zitiert: im Himmel „schläft die in den ersehnten Umarmungen süß ruhende Seele, während ihr Herz wacht … Dort schaut sie Unschaubares, hört sie Unaussprechliches …“.300
Bernhard bringt seine eigene Situation mit ein: Was durcheile ich geschwätzig die oberen Himmel, „der ich mich, noch hier auf Händen und Füßen kriechend, unter dem Niedrigsten abmühe?“301 Erst wenn der Herr die Gnade schenkt, mit voller Demut den Fuß auf die Leiter zu setzen, dann werde ich zur Liebe in ihrer Weite gelangen …302 Selbstkritisch, aber nicht ohne Koketterie, meint er am Schluß, er habe sein Werk deshalb als Abstieg, nicht als Aufstieg, konzipiert, denn er könne nur lehren, worauf er sich verstünde, und das sei nun einmal der Abstieg.303
Im zweiten Teil werden darauf die 12 Stufen – nicht der Demut, sondern des Stolzes erörtert. Durch das, was zu meiden ist, entsteht so quasi ein Negativbild der Benediktinischen Himmelsleiter. Die erste, mildeste Stufe, aus der sich freilich alle anderen Laster entwickeln, ist die „curiositas“, die Neugierde. Bernhard spricht über sie allein etwa genauso lange, wie über alle weiteren elf Stufen zusammen, sie hat ihn also ganz außerordentlich beschäftigt. Warum? Wir können hier nur eine wahrscheinliche Erklärung verfolgen: Neugierde, mehr wissen zu wollen, als die Tradition vorgab, die Autoritäten durch eigenes „ingenium“ – Genie – hinter sich lassen zu wollen, war genau das Verhalten, das Bernhard später an Abaelard so aufregen sollte.304 Aber dieser war nicht der Einzige: Der in Chartres wirkende Magister Wilhelm von Conches (t 1154), ein Altersgenosse Bernhards, bietet ebenso ein Beispiel für diese Haltung, zielte er doch tatsächlich auf eine Ergänzung der Schriften der „antiqui“ durch das „naturale ingenium, quo aliquid novi perspicimus“, das natürliche Denkvermögen, mit dem wir etwas Neues durchschauen.305 In der Tat war damit ein Ansatz zum Aufbrechen des eher statischen Weltbilds des Frühmittelalters gegeben.
Für Bernhard wirkt die „curiositas“ deshalb so bedenklich, weil sie sich nicht nach innen, in die Seele, sondern nach außen wendet, „um die Böcke zu weiden“.306 Diese Anspielung auf das Hohelied (1, 7) ist gleichzeitig ein gutes Beispiel für die von Bernhard durchgehend gebrauchte allegorische Deutung der Schrift. Sie war der absolut alltägliche Modus des mittelalterlichen Bibelverständnisses und konnte nicht nur den Ketzer Origenes, sondern vor allem den heiligen Kirchenvater Papst Gregor d. Gr. als ihren Ahnherrn und Garanten nennen.307 So selbstverständlich war es im 12. Jahrhundert, die Bibel nicht dem Wortsinn nach zu lesen, daß Bernhard diejenigen, die sie nur buchstäblich verstehen können oder wollen, als Narren und Tölpel verunglimpft.308
Im alttestamentlichen Liebeslied rät der Bräutigam der Braut, einem Landmädchen, ganz konkret und schlicht, sie solle ihre Herde nur bei den Hütten der Hirten weiden, um ihn zu finden. Dieser ‘sensus litteralis’, buchstäbliche Sinn, war speziell in diesem Text für Theologen natürlich aus vielen Gründen unbrauchbar und wurde immer symbolisch ausgelegt. Bernhard interpretiert die Böcke als Sünden bzw. als Augen und Ohren, durch die der Tod in die Seele eintritt.309 Diese Tiere stehen also für das zum ewigen Tod, zur Hölle, führende Interesse an den materiellen Dingen der Welt. Sie auf die Weide zu führen heißt, sich neugierig mit der bösen Welt zu beschäftigen und die innere Erforschung zu vernachlässigen. – Oder: Wenn Luzifer nach Isaias 14, 13 seinen Thron im Norden aufstellt, dann sind mit jenem Bereich des Himmels die verworfenen Menschen gemeint, mit dem Thron seine Herrschaft über sie,310 etc.
In das Kapitel über die „curiositas“ ist ein langer Exkurs über den Fall Luzifers eingeschoben. Das kommt etwas unerwartet, denn die Dämonologie beschäftigte ansonsten weder Bernhard noch allgemein die Theologie seiner Zeit besonders – in krassem Unterschied zum Spätmittelalter. Jedenfalls dient Bernhard in leicht gezwungener Argumentation auch der Höllenfürst dazu, ihn als Opfer der Neugierde darzustellen. Wesentlich weniger Seiten wendet er dann für die übrigen Stufen des Stolzes auf: oberflächliche Gesinnung, grundlose Heiterkeit, die sich an grundlosem Lachen erweist, Prahlsucht, Eigenbrödlerei, Arroganz, Anmaßung, Verteidigung der Sünden, heuchlerische Beichte, Rebellion … Damit sind die innerklösterlichen Verfehlungen ausgeschöpft, denn nach der Rebellion wird der Mönch, wenn er nicht ohnehin von selbst geht, aus dem Kloster ausgestoßen. Die restlichen zwei Stufen betreffen sein Leben in der Welt: angenommene Sündenfreiheit und die Gewohnheit zu sündigen. Der Leser soll freilich in diesem Abstieg die Schritte des Aufstiegs wiedererkennen. „Von denen wirst Du aber besser im Emporsteigen in Deinem Herzen als in unserem Kodex lesen. „311
Namentlich dieser zweite Teil enthält zahlreiche Skizzen aus dem Klosterleben, Aussagen zur monastischen Mentalität, Hinweise auf strukturelle und alltägliche Schwierigkeiten. Dabei sollte man sich vor Augen halten, daß das Werkchen aktuell für die Zisterzienser jener Zeit geschrieben war, weshalb viele sonstige im gleichzeitigen Mönchtum existente Probleme überhaupt nicht berührt sind. Das weniger, weil sie von der Grundlage des Benediktinischen Regel-Textes weggeführt hätten – das hätte Bernhard nicht gestört („curiositas“ kommt dort z.B. gar nicht vor) –, sondern weil sie augenscheinlich die damaligen Zisterzienser noch nicht betrafen: etwa die Verflechtung in die Herrschafts- und Wirtschaftsstrukturen der Welt oder die Homosexualität.
Viel problematischer war Bernhard da der fast karikierend gezeichnete Mönch, der sich zu Gelächter hinreißen ließ, ohne sich beherrschen zu können, so daß er noch durch die Nase prusten muß, selbst wenn er sich mit zusammengebissenen Zähnen die Hand vor den Mund hält.312 Impulsives Lachen („hilaritas dissoluta“ im Gegensatz zur „laeta“) war ja im Kloster streng verpönt.313 Oder der eingebildete Gelehrte: „ … es fliegen die Argumente, es schwirren hochtrabende Formulierungen. Er kommt dem Fragenden zuvor, antwortet dem, der gar nicht nachforscht. Selbst stellt er das Problem, selbst löst er es, und die Worte des Gesprächspartners schneidet er diesem im Munde ab. „314 Oder die Sucht nach Gesichten und Zeichen: „Wenn es um den Ordensstand geht, werden sofort Vsionen und Träume angeführt. „315 Oder der Sonderling, der fürchte, jemand könne ihn an asketischen Leistungen überflügeln, weswegen er genau die Blässe seines Antlitzes, die Magerkeit seiner Glieder kontrolliert und, demonstrativ allein in der Kirche zurückbleibend, wenn die anderen Brüder nach der Mette ruhen, sie durch Räuspern und Husten, Stöhnen und Seufzen stört.316
Lange erörtert wird am Ende ein weiteres typisch monastisches Problem: darf man für einen, der aus dem Kloster ausgetreten ist oder ausgestoßen wurde, noch beten? Bernhard kommt zu dem mitleidsvollen Schluß, man dürfe es zwar nicht öffentlich tun, aber im Herzen nicht unterlassen. „Wenn sie sich nämlich auch von den gemeinsamen Gebeten selbst ausschließen, so können sie sich doch von [unseren] Gefühlen nicht gänzlich ausschließen.“317
Schon bald kursierten einige Abschriften des Traktats, er wurde sogar in nur wenige Jahre jüngeren kirchenrechtlichen Abhandlungen angeführt.318 Irgendwann merkte Bernhard, daß er eine Schriftstelle falsch zitiert und darauf seine Argumentation aufgebaut hatte, weshalb er sich entschloß, dem Text eine „retractatio“ voranzustellen, eine Richtigstellung. Auch dies hatte er von Augustinus gelernt, der unter diesem Titel einige Jahre vor seinem Tode einen Korrekturband (Retractationes) zu seiner umfangreichen schriftstellerischen Produktion herausgegeben hatte.319 Hieran wird (wie freilich auch aus den Texten selbst) etwas von der Praxis des Umgangs Bernhards mit der Bibel sichtbar: er zitierte in der Regel nach dem Gedächtnis, nicht aus einer Handschrift. Dieses Vorgehen erlaubte manche leise Änderung der jeweiligen Vulgata-Stelle, die sich so unversehens der Intention des Autors anpassen konnte. Bernhard glaubte nicht, sich darob ein besonders schlechtes Gewissen machen zu müssen, war er doch selbst „mehr irregeführt, als absichtlich täuschend“.320