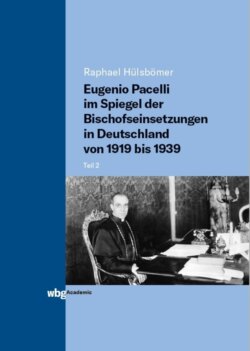Читать книгу Eugenio Pacelli im Spiegel der Bischofseinsetzungen in Deutschland von 1919 bis 1939 - Raphael Hülsbömer - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Von Ludwig Kaas zu Christian Schreiber und die Bestellung eines Administrators
ОглавлениеBertrams Eingabe erreichte ihren Zweck. Pius XI. kam zu der Ansicht, „dass nicht bis zur absoluten Dringlichkeit zu warten ist, sondern dass die aktuelle Notwendigkeit ausreicht, um für das geistliche Wohl der Katholiken Berlins zu sorgen“64, wie Gasparri am 2. Juni an die Berliner Nuntiatur telegraphierte. Der kürzeste Weg für Pacelli bestehe nach Ansicht des Papstes darin, sich direkt mit Bertram zu verständigen, um eine der Situation gerechte Lösung zu erzielen, insbesondere, „wenn man eine vorläufige Maßnahme finden kann, um den Weg frei zu halten für die Wahl von Kaas, wenn sie in ziemlich naher Zukunft absehbar ist“65. Man freundete sich also in der Kurie mit Pacellis Favoriten an, wenngleich der Nuntius keinen Geistlichen als völlig opportun deklariert und man zunächst für alle vorgetragenen Kandidaten das Plazet des Heiligen Offiziums besorgt hatte. Von der angedachten provisorischen Lösung, um Kaas zu einem späteren Zeitpunkt auf den bischöflichen Stuhl zu transferieren, erfuhr Bertram nichts. Ihm gegenüber versicherte der Kardinalstaatssekretär am nächsten Tag lediglich, dass die Verzögerung einzig aus der Langwierigkeit der preußischen Konkordatsverhandlungen resultiere und er wünsche, dass die fragliche Besetzung bald erledigt werden könne.66 Auf Anweisung des Heiligen Vaters habe er das Bittschreiben an Pacelli weitergereicht.
Dieser war gerade dabei, die Konkordatsverhandlungen endgültig abzuschließen. Am 14. Juni erfolgte bereits die Unterzeichnung des neuen Kirchenvertrags zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Preußen, die endgültige Abstimmung im Landtag stand am 9. Juli auf dem Programm.67 Doch entgegen der Vorgabe Pius’ XI. korrespondierte Pacelli zunächst nicht mit Bertram. Erst wollte er die Personalfrage zu einer definitiven Entscheidung führen. Um also „auf beste Art“ die römischen Anordnungen auszuführen – so versicherte er dem Kardinalstaatssekretär am 18. Juni –, habe er sich vergewissert, ob eine „ziemlich kurzfristige“68 Ernennung des Zentrumsvorsitzenden möglich sei. Leider sei festzustellen, dass dessen angeschlagene Gesundheit es nicht erlaube, in naher Zukunft ein so bedeutendes und mühseliges Amt zu übernehmen. Obwohl man daher von seiner Wahl absehen müsse, glaubte Pacelli, dass nicht nur eine provisorische Übergangslösung, sondern sogar eine endgültige Regelung der Angelegenheit machbar war. Dabei dachte er aber keineswegs an die Kandidatentrias Bertrams, nicht einmal an Steinmann, den er im März noch als im Allgemeinen akzeptabel hingestellt hatte. Stattdessen nominierte er den Bischof von Meißen, Christian Schreiber:
„Als ehemaliger Alumne des Kollegiums Germanicum-Hungaricum, von gesunder Lehre und anhänglich an den Heiligen Stuhl kann man nicht zweifeln, dass er jede Zuverlässigkeit im Hauptpunkt der Klerusausbildung bietet. Er ist außerdem von tadellosem Leben, sehr angesehen, kultiviert, energisch, aktiv und eifrig, wenn er auch manchmal den Eindruck macht, dass er ein bisschen zu viel von sich selbst denkt.“69
Ein Problem darin, dass Schreiber von einem amtierenden Diözesanbischof zu einem Weihbischof „degradiert“ werden würde, sah Pacelli nicht, weil nach der Veröffentlichung des Konkordats die baldige Errichtung der Berliner Diözese publik und die Übergangszeit nur kurz andauern werde. Seine abschließende Bitte um diesbezügliche Instruktionen wurde Anfang Juli erhört: Gasparri meldete knapp, dass der Papst bereit sei, Schreiber zum Weihbischof von Berlin zu ernennen.70 Pacelli sollte dafür das opportune Prozedere vorgeben.
Plötzlich jedoch schien das Bild, das Pacelli von Schreiber gezeichnet hatte, Kratzer zu bekommen. Gerade hinsichtlich des wesentlichen Kriteriums, das er für die Eignung eines Geistlichen zur Bischofswürde veranschlagte, erhielt er am 2. Juli – einen Tag bevor ihn die kurze telegraphische Nachricht von der Bereitschaft des Papstes zur Ernennung Schreibers erreichte – ernüchternde Neuigkeiten. Damit diese in die päpstliche Entscheidung noch einfließen konnten, legte Pacelli sie am 4. des Monats in einem erneuten Bericht für Gasparri schriftlich nieder.71 Darin lenkte der Nuntius die Sprache auf das Jesuitenkolleg St. Georgen in Frankfurt, von dem Gasparri wisse, wie wichtig es für den Papst sei. Es bestehe die Hoffnung, dass von dort die in Deutschland so dringend benötigten Geistlichen ausgingen, die fest in der gesunden katholischen Lehre ausgebildet wurden.72 Der Meißener Bischof sende seine Alumnen jedoch nicht in das genannte Jesuitenkolleg, sondern in das Seminar nach Fulda. Das war für Pacelli freilich noch nicht die bedenkliche Novität, er wusste davon bereits aus der jungen Gründungsgeschichte St. Georgens.73 Nicht ohne Grund hatte er in seiner Berichterstattung vom März die bischöflichen Seminare in Trier und Fulda als zwar auf unterster Stufe stehende, aber nichtsdestotrotz akzeptable Ausbildungsstätten für Priesteranwärter bezeichnet. Weil Schreiber vor seiner Erhebung zum Meißener Diözesanbischof Rektor des dortigen Seminars gewesen sei, könne man – so Pacelli weiter – diese Ausrichtung auf Fulda „bis zu einem gewissen Punkt auch verstehen, obwohl die Studien dort, jenen, die man in Frankfurt absolviert, weit unterlegen sind“74. Doch das eigentlich Prekäre war für ihn etwas anderes:
„Aber der Ehrwürdige Monsignore Schreiber, und das ist weniger verständlich, scheint sogar noch weiter zu gehen, nämlich, wie ich aus sicherer Quelle erfahren habe, sendet er selbst die Jugendlichen nicht nur nicht in das genannte Institut, sondern hat sogar einem Studenten verboten dort hinzugehen, der darum gebeten hatte.“75
So unzweifelhaft war die Zuverlässigkeit Schreibers hinsichtlich der Klerusausbildung also gar nicht, wie Pacelli Mitte Juni noch behauptet hatte. Logischerweise befürchtete der Nuntius, dass Schreiber diesen – seiner Ansicht nach – schädlichen Weg auch in Berlin weiterverfolgen könnte. Daher hielt er es für angemessen, dieses Thema vor der Ernennung vertraulich mit dem Kandidaten zu erörtern, um dessen Ansichten diesbezüglich besser kennen zu lernen und eventuell die Vorstellungen des Heiligen Stuhls klarzustellen.
Merkwürdig ist aber nun, dass Pacelli diesen Bericht mit dem für ihn fundamental wichtigen Inhalt nicht nach Rom abschickte. Der Grund dafür kann nicht in dem tags zuvor erhaltenen Telegramm Gasparris liegen. Man könnte ja denken, dass er nach der erklärten päpstlichen Ernennungsabsicht nicht noch einmal einen Kandidaten zurückziehen wollte. Aber warum sollte er dann diesen Bericht – den er am 4. Juli verfasste – überhaupt noch schreiben, wenn die Weisung – die er am 3. Juli erhielt – ihn von der Absendung abgehalten hätte? Eine kurze Anmerkung, die Pacelli am 5. des Monats auf seinem Bericht notierte, gibt Aufschluss, dass dem Nuntius noch ein weiteres Mal aus anonymer Quelle76 Informationen zugetragen wurden, die das schlechte Licht, in das Schreiber gerückt worden war, relativierten und ein günstigeres Bild zeichneten.77 Pacelli schien demnach überzeugt, dass die frühere distanzierte Haltung Schreibers gegenüber der Frankfurter Jesuitenhochschule überwunden war oder zumindest leicht überwunden werden konnte. Vor diesem Hintergrund konnte der Nuntius knapp ein halbes Jahr später in seiner Finalrelation folgende ungetrübte Hoffnung ausdrücken:
„Es ist zu wünschen, dass Bischof Schreiber, der die Mängel der theologischen Fakultäten gut kennt, als Ordinarius von Berlin die Kraft haben möge, nach und nach, wenn auch mit der notwendigen Umsicht, seine Theologieschüler von der Universität Breslau zu entfernen und sie anderen philosophisch-theologischen Instituten mit einer sichereren und solideren Ausbildung zuzuführen.“78
Ungeachtet der kurzen Phase des Zweifels befürwortete Pacelli also Anfang Juli 1929 unverändert, Schreiber zum Weihbischof und künftigen Diözesanbischof von Berlin zu ernennen. In verspäteter Umsetzung der päpstlichen Instruktion kommunizierte er diesen Plan schließlich auch dem Breslauer Oberhirten und zwar noch am selben Tag, an dem er sich entschloss, seinen letzten Bericht nicht nach Rom zu übermitteln.79 Bertram zeigte sich von der Personalie hocherfreut: „Den Katholiken des Bistums Berlin kann man innig gratulieren zu einem so musterhaften Oberhirten, dessen Manneskraft, Vielseitigkeit, Schaffensfreude und geziemendes Auftreten zu den besten Hoffnungen berechtigt.“80 Direkt im Anschluss an dieses zustimmende Urteil bat der Nuntius den Meißener Diözesanbischof, ihn „zwecks einer wichtigen Mitteilung“81 in Berlin aufzusuchen. Pacelli präferierte das Vier-Augen-Gespräch, um die binnenkirchlich wie kirchenextern weittragende Entscheidung zu kommunizieren und möglicherweise auf besondere persönliche Empfehlungen und Schwerpunkte hinzuweisen – zu denken ist hier an die von Pacelli selbst angekündigte Diskussion über die Ausbildung der Priesteramtskandidaten. Doch darüber bemerkte Pacelli nichts, als er knapp eine Woche nach der Audienz, die am 12. Juli stattfand,82 Gasparri informierte.83 Stattdessen berichtete er, seinem Gesprächspartner verdeutlicht zu haben, dass die päpstliche Anordnung, als Bischof nach Berlin zu gehen, angesichts der exponierten Wichtigkeit des dortigen Bischofsstuhls für Schreiber als „ein Beweis des besonderen Vertrauens und Wohlwollens von Seiten Seiner Heiligkeit“84 gelten könne. Schreiber sei sofort bereit gewesen, dem Willen des Papstes Folge zu leisten, habe aber auch die Nachteile angesprochen, die sich aus seinem Transfer für die Diözese Meißen ergäben. Dort habe er verschiedene Projekte initiiert, die seine Gegenwart noch für einige Jahre erfordern würden. Laut eigener Darstellung entgegnete Pacelli, dass der Heilige Stuhl gewiss für einen Nachfolger sorgen werde, der die begonnenen Unternehmungen vollende. Daraufhin habe Schreiber seiner Nomination zugestimmt.85
Dieser Punkt war damit geklärt. Pacelli überlegte weiter, welche Vorgehensweise bei der konkreten Einsetzung am praktikabelsten sei. Nach dem einmütigen Urteil „von sachkundigen Personen“86, die er vertraulich befragt habe – wiederum mündlich ohne schriftliche Belege im Nuntiaturarchiv –, sei es klug, bis nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden am 13. August und damit bis zum letzten Akt der Verabschiedung des Preußenkonkordats zu warten. Auf diese Weise würden irgendwelche verhängnisvollen Auswirkungen und Polemiken in letzter Sekunde zulasten des Vertrags ausgeschlossen. Weil allerdings in Berlin noch kein Domkapitel existiere, sei eine Bischofswahl, wie im Preußenkonkordat vorgesehen,87 nicht möglich. Vielmehr müsse die Einsetzung Gegenstand einer „besonderen Vereinbarung“88 werden. Deshalb schlug Pacelli vor, die Regierung direkt nach der Übergabe der Ratifikationsdokumente von der Absicht des Heiligen Stuhls in Kenntnis zu setzen, Schreiber an die Spitze des neuen Bistums zu stellen und ihr umgehend die Möglichkeit zu geben, Einwände politischer Natur gegen den Erwählten vorzubringen. Es sei allerdings nicht davon auszugehen, dass sie Einspruch erheben werde. Da jedoch die Diözese nicht ohne dazugehörige Zirkumskriptionsbulle kanonisch errichtet werden könne, sei es wiederum nicht möglich, den Bischof sofort zu ernennen. Daher schwebte Pacelli als Lösung vor, dass Schreiber in der Zeit zwischen der Mitteilung an die Regierung und der Promulgation der Bulle provisorisch das Amt eines Apostolischen Administrators des Gebiets der aktuellen Delegatur von Berlin mit allen Vollmachten eines Diözesanbischofs übernehmen könnte. In diesem Fall würde bereits in angemessener Weise für die geistlichen Bedürfnisse der Gläubigen in diesem Gebiet gesorgt.
Wie bisher war Gasparri mit den Überlegungen des Nuntius zufrieden. Auf Pacellis Bericht notierte er lapidar: „Sta bene“. Am 31. Juli bekannte er Pacelli, besonders gerne die – ihm ebenfalls von Pacelli referierte – wohlgesonnene Einschätzung Bertrams zur Kenntnis genommen zu haben.89 Der Papst sei vollkommen mit dem empfohlenen Besetzungsmodus einverstanden, insbesondere mit der Variante, die geistliche Führung des Delegaturbezirks Schreiber als Administrator mit den Rechten eines Diözesanbischofs zu übertragen. Die Ernennung desselben werde vorgenommen, sobald der Kirchenvertrag mit Preußen durch die reziproke Übergabe der ratifizierten Urkunden in Kraft getreten sei und Pacelli mitgeteilt habe, dass von Regierungsseite keine politischen Einwände gegen Schreiber vorgebracht würden. Damit ruhte die Besetzungsfrage für die kommenden zwei Wochen.