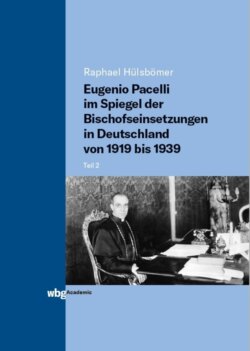Читать книгу Eugenio Pacelli im Spiegel der Bischofseinsetzungen in Deutschland von 1919 bis 1939 - Raphael Hülsbömer - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ergebnis
Оглавление1. Den zentralen Fokus bei der Kandidatenwahl legte Pacelli auf die Frankfurter Jesuitenhochschule St. Georgen, näherhin darauf, dass der neue Limburger Oberhirte dieser Institution „keine Schwierigkeiten“ bereiten durfte, sodass die dortige römisch-scholastische Ausbildung der Priesteramtskandidaten reibungslos weitergehen konnte. Hochinteressant ist, dass Pacelli mit Wolf zunächst dezidiert einen Nicht-Germaniker für die Nachfolge Kilians in Betracht zog. Zwar war er überzeugt, dass jemand, der an der päpstlichen Gregoriana seine theologischen Studien absolviert hatte, die Notwendigkeit des entsprechenden Studienbetriebs in St. Georgen verstanden habe. Aber dieses Verständnis war für Pacelli nicht zwingend an eine eigene, jesuitisch-römische Ausbildung gebunden – außerdem hatte Wolf „immerhin“ an dem für Pacelli noch akzeptablen Fuldaer Priesterseminar studiert. Mit anderen Worten: Pacelli hatte keine Schwierigkeiten, die durch die Jesuitenhochschule für ihn vehement an Bedeutung gewonnene Diözese Limburg mit einem Nicht-Germaniker zu besetzen. Er suchte jemanden, der „trotzdem“ den dortigen Lehrbetrieb nicht stören, sondern fördern und unterstützen würde. Derjenige durfte in dieser zentralen Angelegenheit keinesfalls nachgiebig oder „schwach“ sein – wie er es Fendel unterstellte.
Indem Pacelli zunächst bewusst von einem Germaniker und damit seinem Ideal absah, folgte er einer „äußeren“ Motivation: Er wollte dem „Verdacht“ auf Seiten des preußischen Staats und der Öffentlichkeit vorbeugen, dass der Heilige Stuhl die Freiheiten des neuen Konkordats nur noch nutzen würde, um ausschließlich in Rom ausgebildeten und stringent nach Rom ausgerichteten Geistlichen die bischöfliche Mitra aufzusetzen. Erst nachdem Pacelli davon überzeugt war, dass Wolf, den er selbst zuvor nicht gekannt hatte, für den „scholastischen Studienbetrieb … kaum einen Sinn“ habe und die Zukunft St. Georgens bei seiner Ernennung ungewiss sei, griff er mit Hilfrich auf einen Germaniker zurück – jedoch nur, weil es seiner Ansicht nach keinen tauglichen Nicht-Germaniker unter dem Limburger Klerus gab. Die politische Opportunität stellte er also vor diesem Hintergrund zurück, sorgte sich jedoch um eine vorsichtige Umsetzung des Plans (vgl. Nr. 2). Ein wesentlicher Grund für Pacellis Fixierung auf einen Limburger Geistlichen bestand sicherlich darin, dass Kilian der Regierung schwerlich suggerieren konnte, einen externen Kandidaten zu seiner Unterstützung ausersehen zu haben.
Dem Wiesbadener Pfarrer schrieb Pacelli abgesehen von einer Affinität gegenüber St. Georgen und der Societas Iesu eine gesunde Theologie zu, eine „außergewöhnliche Begabung“, eine enge Anhänglichkeit an den Heiligen Stuhl, ein hohes Ansehen innerhalb der Diözese, einen gewandten Umgang mit den weltlichen Behörden und eine absolut integre Lebensführung. Wenngleich es Pacelli also gelang, einen Koadjutor zu installieren, der haargenau in sein Profil passte, so war Hilfrich doch in gewisser Weise eine Notlösung, insofern er ihn eigentlich für die Nachfolge Schreibers in Meißen in Aussicht genommen hatte. Andererseits gehörte Hilfrich für Pacelli schon seit langem zur Gruppe episkopabler Kandidaten. Seit 1920 hatte er ihn im Auge behalten: Bereits damals war er von den skizzierten Qualitäten des Pfarrers überzeugt gewesen, sodass er ihn für den Posten des Koadjutors in Mainz und kurz darauf für die Erstbesetzung der neuen Meißener Diözese ins Auge gefasst hatte. Wenngleich dies jeweils nicht realisiert wurde, so hielt ihn Pacelli doch in der Hinterhand, um bei späterer Gelegenheit – wie im aktuellen Fall – auf ihn zurückzugreifen.
2. Der Grund für Pacellis Intention, einen Koadjutor cum iure successionis entsprechend Artikel 7 des neuen Konkordats zu installieren, ist schnell einsichtig: Auf diese Weise hatte der Heilige Stuhl die Besetzung vollständig in der Hand und konnte „im Hinblick auf die Lage der dortigen Lehranstalt“ einen Geistlichen ernennen, ohne dass der Unsicherheitsfaktor einer Domkapitelswahl gemäß Artikel 6 des Konkordats in Kauf genommen werden musste. Insofern kam dem Nuntius Kilians Bitte um einen Weihbischof sehr gelegen. Diesen Vorschlag „modifizierte“ Pacelli zur Koadjutorvariante, wodurch er dem Oberhirten zwar die gewünschte Unterstützung gewährte, allerdings ohne das spezifische Interesse Kilians zu berücksichtigen. Auch als dieser anschließend einen gewissen Widerstand gegen die Koadjutoridee leistete, rückte Pacelli nicht von seinem angestrebten Modus ab. Entsprechend seiner Zielrichtung konnte er einen Weihbischof auch gar nicht befürworten: Ihm ging es nämlich überhaupt nicht um die Einsetzung eines Koadjutors – im Wortsinn als Unterstützung Kilians –, sondern einzig um das iure successionis, nämlich den künftigen Diözesanbischof. Er wollte die Gelegenheit, für die Zukunft St. Georgens mit einem passenden Oberhirten zu sorgen, nicht ungenutzt verstreichen lassen. Das eigentliche Anliegen Kilians war Pacelli zweitrangig, wobei nicht übersehen werden darf, dass er mit Hilfrich schlussendlich einen Kandidaten fand, der dem Limburger Bischof absolut genehm war.
Zur Frage nach dem Besetzungsmodus gehört auch die praktische Umsetzung des Plans, an der man ausgezeichnet Pacellis Bemühen ablesen kann, die theoretisch-ideelle Seite – den Germaniker Hilfrich einzusetzen – mit den praktischen Begebenheiten – den erwarteten Widerstand Preußens gegen einen weiteren „Römer“ – in Einklang zu bringen. Seine Lösung des Problems folgte der Leitlinie: den Heiligen Stuhl als handelnden Akteur nach außen hin nicht sichtbar werden zu lassen, denn wenn schon – wie zuvor in Berlin – ein „römischer“ Theologe den Limburger Bischofsstuhl besteigen sollte, dann durfte dies nicht auch noch von Rom aus gesteuert sein. Wenn ein deutscher Oberhirte einen solchen Wunsch äußerte, war mit weniger Gegenwind preußischer Provenienz zu rechnen. Dann zog der Vorwurf nicht, Rom würde die neuen konkordatären Freiheiten knallhart in seinem Sinne ausnutzen. Deshalb gab Pacelli Kilian die genaue Instruktion, „wie von sich aus und ohne jede Erwähnung des bisher in der Angelegenheit geschehenen Briefwechsels in offizieller Form eine Bittschrift an den Heiligen Vater“ zu senden. Dadurch entstand – wie von Pacelli beabsichtigt – nach außen hin und vor allem im preußischen Kultusministerium, dem das Schreiben anschließend vorgelegt wurde, der Eindruck, eigentliche Triebfeder hinter dem Ganzen sei Kilian gewesen. Verständlicherweise ist die Forschung bisher von dieser Annahme ausgegangen.230 Die vatikanischen Quellen dokumentieren das Gegenteil. Folgerichtig war es auch Kilians Aufgabe, Hilfrich von der bevorstehenden Nomination zu unterrichten. Nach politischen Bedenken der preußischen Staatsregierung musste laut Artikel 7 des Konkordats dann aber doch der Heilige Stuhl fragen. Angesichts seiner Leitlinie kam es Pacelli gewiss nicht ungelegen, dass es zu diesem Zeitpunkt in Berlin keinen Nuntius gab und er diese Aufgabe an den formal wenig bedeutenden Geschäftsträger delegieren konnte – dies suggerierte, der Heilige Stuhl messe der Koadjutoreinsetzung nur geringfügige Bedeutung bei.
3. In formal-rechtlicher Hinsicht war der preußische Staat nur vermittelst des politischen Bedenkenrechts gemäß der Vorgabe des Konkordats an der Einsetzung des Koadjutors beteiligt. Interessant ist, dass Pacelli in gleichsam vorauseilender Nachgiebigkeit die vorausgeahnte Reaktion der Regierung und der Öffentlichkeit auf einen neuen Germaniker-Bischof in seine Kandidatenüberlegungen mit einbezog. Zwar war das Preußenkonkordat bereits abgeschlossen, dennoch war der Diplomat weiterhin um ein gutes Verhältnis des Heiligen Stuhls zu Preußen, genauer: um ein gutes Bild des Heiligen Stuhls in Preußen, bemüht. Er glaubte, dass Regierung und Öffentlichkeit besonders sensibel auf die ersten Anwendungen des neuen Kontrakts achten würden und wollte den „Romanisierungs“-Vorwürfen der Konkordatsgegner keine Nahrung geben.231 Daher war Pacelli so vorsichtig, zunächst von seinem Ideal eines in Rom ausgebildeten Geistlichen abzusehen, später dann die Situation durch die suggerierte Teilnahmslosigkeit des Heiligen Stuhls zu entschärfen. Ob die letztgenannte Strategie letztlich die tatsächliche, positive Reaktion des Kultusministeriums beeinflusste, kann auf Basis der vatikanischen Quellen nicht gesagt werden. Fakt ist zumindest, dass die präzisen Anweisungen Pacellis für Centoz zur Frage nach dem Residenzort überflüssig waren. Schlussendlich wird man festhalten müssen, dass Pacelli aus diplomatischem Beweggrund der Regierung implizit mehr Einfluss auf den Besetzungsfall gewährte, als ihr rechtlich zustand.
4. Als zentrale Informanten Pacellis treten im Limburger Fall die beiden Jesuiten Klein und Kösters in Erscheinung, das heißt der Rektor und Ex-Rektor von St. Georgen. Angesichts der klaren Ausrichtung, einen Bischof zu finden, welcher der Jesuitenhochschule vollkommen gewogen war, ist diese Wahl des Nuntius evident und folgerichtig. Da Klein erst wenige Monate im Amt war, drängte Pacelli darauf, dass jener sich mit seinem Vorgänger über die Kandidaten- und Modusfrage verständigte. Kösters kannte er gut, hatte er doch mit ihm im Kontext der Neugründung St. Georgens an einem Strang gezogen.232 Dass Pacelli den beiden Jesuiten vorbehaltlos vertraute, lässt sich nicht nur daran ablesen, dass er ihnen seinen Koadjutor-Plan offenbarte, sondern ihnen sogar das vertraulich-intime Bittschreiben Kilians übersandte, was dieser gewiss nicht gutgeheißen hätte. Auf der anderen Seite verlor der Nuntius aber in keiner Weise sein eigenständiges Urteil, insofern er ihr Votum für den Subregens Pappert ablehnte und sich für Wolf entschied. Die Jesuiten hatten offenbar überhaupt nicht mit einer solchen Entscheidung des Nuntius gerechnet und versuchten schleunigst nachzubessern. Der sich anschließende doppelte Rückzieher – zum einen hielten sie Wolf plötzlich doch nicht mehr für geeignet, zum anderen war der bisherige Favorit Pappert auf einmal ebenso non grata – demonstriert, dass sie nur partiell qualifiziert waren, ein inhaltliches Urteil über die Kandidaten abzugeben. Ob Pacellis Vertrauen durch das alles andere als geradlinige zweite Gutachten der beiden Jesuiten erschüttert wurde, sei dahingestellt. Was wäre passiert, wenn er darauf verzichtet hätte, ergänzende Informationen über Wolf einzuholen und den Jesuiten damit keine Gelegenheit geboten hätte, ihr früheres Urteil zu revidieren? Wortwörtlich auf einem Spaziergang entschied sich ihr Eintreten für Hilfrich und damit in gewisser Weise der gesamte Besetzungsfall.
Allerdings verließ sich Pacelli nicht nur auf das Urteil der beiden Jesuiten, wenngleich er anschließend – soweit quellenmäßig verifizierbar – keine weiteren Informanten mehr kontaktierte. Denn abgesehen davon, dass er Hilfrich bereits seit 1920 kannte, hatte er zuvor im Kontext der Wiederbesetzung des Meißener Bischofsstuhls bei Kilian als dessen Ordinarius bereits ein Gutachten eingeholt. Darüber hinaus hatte er sich im gleichen Zuge beim scheidenden Meißener Oberhirten Schreiber der hohen Wertschätzung für den vermeintlichen Nachfolger an der Spitze des sächsischen Bistums versichert. Beide Diözesanbischöfe sind somit als weitere Informanten zu rechnen. Auf dieser Basis hielt Pacelli weitere Voten nicht mehr für erforderlich.
5. Pacelli war die vollumfänglich maßgebliche Instanz für den Verlauf und den Ausgang der causa Limburg: Er entschied nicht nur über den Koadjutor-Modus, sondern wählte auch den Kandidaten aus. Erst nachdem er beides fixiert hatte, berichtete er dem Kardinalstaatssekretär und zwar in stringent-argumentativer Ausrichtung auf seinen Plan. Das Bittschreiben Kilians an den Papst hielt er bis dahin zurück, immerhin über einen Zeitraum von fünf Wochen! Damit war dessen Bitte um einen Weihbischof bereits obsolet, bevor das Schreiben seinen Adressaten überhaupt erreichte: Pacelli nahm ihm damit bewusste jede Chance, in Rom unkommentiert und damit frei wirken zu können. Er wollte nicht, dass Pius XI. und Gasparri der Bitte entsprachen und sorgte dafür, dass sie es praktisch nicht konnten, indem er dieselbe mit der Thematik St. Georgen verknüpfte und damit gänzlich neu gewichtete.
Von der römischen Kirchenleitung erhielt der Nuntius völlig freie Hand, nicht einmal einer Rückfrage oder kritischen Anmerkung musste er sich stellen. Aufschlussreich für das Amtsverständnis Pacellis ist die Mitteilung der „kurialen“ Entscheidung der causa an den Limburger Bischof: Es „glaubt der Heilige Vater, dessen weisem Ermessen Euer Bischöflichen Gnaden die Art der Lösung … überlassen haben …“. Möchte man diese Formulierung nicht als reine Rhetorik abtun, so muss man zur Kenntnis nehmen, dass Pacelli hier seine eigene und völlig selbständig angefertigte – obgleich von Pius XI. approbierte – Lösung ziemlich exponiert als die „weise“ Entscheidung des Papstes hinstellte. Damit signalisierte er nichts weniger, als dass er als Stellvertreter des Pontifex in Einheit mit diesem, ja praktisch in Personalunion handelte. Das hohe Selbstbewusstsein, dass sich in Pacellis Lenkung des Falls – auch gegenüber der Kurie – widerspiegelt, speiste sich also keineswegs „nur“ aus dem Bewusstsein um die persönlichen Fähigkeiten, sondern dezidiert aus dem Wissen um die eigene Sendung in der Vollmacht des Papstes.
Ein besonderes Kennzeichen des Limburger Falls bestand schließlich darin, dass Pacelli noch vor dessen Abschluss als Berliner Nuntius abgezogen und an die Spitze des römischen Staatssekretariats beordert wurde. In der Zwischenzeit – zwischen der offiziellen Abberufung am 9. Dezember 1929 und dem offiziellen Amtsantritt am 7. Februar 1930 – war Pacelli streng genommen weder Nuntius noch Staatssekretär. Dennoch führte er den Fall informell von Rom aus ununterbrochen weiter und zwar mit voller Aufmerksamkeit, wie seine detaillierte Lösung zur Unterhalts- und Unterkunftsfrage des neuen Koadjutors zeigt. Nach seinem offiziellen Amtsantritt kam es für Pacelli zudem nicht infrage, auf den neuen Berliner Nuntius zu warten. Abgesehen davon, dass dies die Einsetzung des Koadjutors gefährdet hätte – was wäre, wenn Kilian unterdessen starb? –, wollte Pacelli die Angelegenheit wohl zügig in seinem Sinne zum Abschluss bringen. Zwischen seiner Tätigkeit als Nuntius und als Staatssekretär lässt sich kein Unterschied feststellen. In gleicher Manier gab er Kilian ganz präzise Instruktionen für das verlangte offizielle Bittschreiben und instruierte Centoz für eine eventuelle Auseinandersetzung mit der preußischen Regierung. Es war also gewissermaßen der Staatssekretär, der jetzt agierte wie der Nuntius, wie vorher der Nuntius mit der gleichen Entschiedenheit des Staatssekretärs aufgetreten war. Das Staatssekretariat war die einzig maßgebende kuriale Instanz, während man etwa in der Konsistorialkongregation im April 1930 die gravierenden rechtlichen Änderungen durch das Preußenkonkordat noch nicht zur Kenntnis genommen hatte.
138 Vgl. zur Besetzung des bischöflichen Stuhls von Limburg 1929/30 nur die knappen Hinweise bei GATZ, Besetzung, S. 213; KAMPE u.a. (Hg.), Weg, S. 23; PAPPERT, Hilfrich, S. 352f.; SCHATZ, Limburg, S. 224f.; SPECKNER, Wächter, S. 173.
139 Vgl. Art. 2, Nr. 5 des Preußenkonkordats, HUBER/HUBER (Hg.), Staat und Kirche IV, S. 323. Vgl. auch den Vollzug in der Nr. II der Apostolischen Konstitution Pastoralis officii nostri vom 13. August 1930, ebd., S. 340. Das 1821 in der Bulle Provida solersque umschriebene und 1827 aufgerichtete Bistum Limburg gehörte politisch ursprünglich zum Herzogtum Nassau und zur Freien Stadt Frankfurt. 1866 fiel das Gebiet an Preußen. Vgl. zur Geschichte des Bistums BURKARD/LEUNINGER/SCHATZ, Bistum Limburg; SCHATZ, Limburg.
140 Vgl. Kilian an Pius XI. vom 25. September 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 7r–9r (nur r).
141 Vgl.: „Quare conscientiae meae esse duco, Sanctitatem Vestram rogare, ut necessitatibus dioecesis meae provideat, eo modo, quem meliorem esse duxerit …“ Kilian an Pius XI. vom 25. September 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 7r.
142 Einen Weihbischof gab es zu dieser Zeit in Limburg nicht. Auch der Art. 2, Nr. 10 des Preußenkonkordats sah lediglich vor, dass für die (Erz-) Diözesen Köln, Breslau, Paderborn, Trier, Münster und Aachen ein Weihbischof bestellt werden sollte. Freilich bestimmte er auch die Möglichkeit, dass den genannten und ebenfalls den übrigen preußischen Bistümern weitere Weihbischöfe zugeteilt würden. Vgl. HUBER/HUBER (Hg.), Staat und Kirche IV, S. 324. Den ersten Weihbischof für Limburg ernannte Pius XII. allerdings erst 1952 in der Person Walther Kampes. Vgl. SCHATZ, Limburg, S. 315.
143 Vgl. die Dotation, ihre Verteilung auf die Diözesen und die Gehälter des höheren Klerus in der „Regierungsbegründung zu dem Entwurf eines Gesetzes zu dem Vertrag des Freistaates Preußen mit dem Heiligen Stuhle“ vom 28. Juni 1929, in: HUBER/HUBER (Hg.), Staat und Kirche IV, S. 328–336 (Nr. 184), hier 336. Vgl. auch ASCHOFF, Staatsleistungen, S. 178f., 184.
144 Vgl.: „1. Henricus Fendel, natus die 17. februarii 1878 Laureaci in diocesi Limburgensi, sacerdotio initiatus die 21. novembris 1901, qui sequentia officia successive explevit: a. vicarii cooperatis in paroecia oppidi Limburgi a die 1. decembris 1901, b. vicarii capituli ecclesiae cathedralis Limburgensis a die 19. junii 1905 ad diem 30. septembris 1914, c. cancellarii episcopalis a die 10. decembris 1909 ad diem 30. septembris 1914, d. parochi oppidi Bad Homburg v. d. H. a die 1. octobris 1914 ad diem 31. octobris 1916, e. canonici ecclesiae cathedralis et oppidi Limburgi parochi, necnon consiliarii Episcopi a die 16. novembris 1916, quod munu adhuc retinet. 2. Bertholdus Merkel, natus die 31. maii 1888 Aquis Mattiacis, sacerdotio initiatus die 22. februarii 1912, qui sequentia officia successive explevit: a. vicarii cooperatis in Flörsheim a die 1. martii 1912, b. vicarii cooperatoris Altae Villae a die 16. augusti 1913, c. vicarii cooperatoris ad ecclesiam principalem in urbe Francofurto a die 16. aprilis 1917, d. rectoris ecclesiae hospitalis maioris publici Francofurtensis a die 1. octobris 1919, e. parochi ad S. Mariam in Biebrich a die 1. martii 1926, f. canonici ecclesiae cathedralis et consiliarii Episcopi a die 1. septembris 1928, quod munus adhuc retinet.“ Kilian an Pius XI. vom 25. September 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 8r–9r. Hervorhebungen im Original.
145 Vgl.: „Sanctitas Vestra vero eligat, quem maluerit ex his vel etiam alium, vel alio modo, quo maluerit, necessitatibus dioecesis provideat …“ Kilian an Pius XI. vom 25. September 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 9r.
146 Vgl.: „Zum Praelatus nullius und zum Koadjutor eines Diözesanbischofs mit dem Rechte der Nachfolge wird der Heilige Stuhl niemand ernennen, ohne vorher durch Anfrage bei der Preußischen Staatsregierung festgestellt zu haben, daß Bedenken politischer Art gegen den Kandidaten nicht bestehen.“ HUBER/HUBER (Hg.), Staat und Kirche IV, S. 325. Hervorhebung im Original.
147 Pacelli an Klein vom 5. Oktober 1929 (Entwurf), ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 6r.
148 Vgl. zur Jesuitenhochschule St. Georgen SCHATZ, Limburg, S. 236–244; DERS., Gründungsgeschichte. Die Rolle Pacellis bei der Genese und seine Haltung zur Lehranstalt beleuchtet etwa UNTERBURGER, Lehramt, S. 354–362.
149 Vgl. Pacelli an Klein vom 5. Oktober 1929 (Entwurf), ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 6r.
150 Pacelli an Klein vom 5. Oktober 1929 (Entwurf), ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 6r.
151 Vgl. Klein an Pacelli vom 10. Oktober 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 7r–9r.
152 Klein an Pacelli vom 10. Oktober 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 7r.
153 Klein an Pacelli vom 10. Oktober 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 7r.
154 Pacelli an Klein vom 5. Oktober 1929 (Entwurf), ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 6r.
155 Klein an Pacelli vom 10. Oktober 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 8r.
156 Klein an Pacelli vom 10. Oktober 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 8r. Bei der genannten „Vertrauensstelle“ handelte es sich wohl um die Präfektur der Philosophenkammer, der auch der Meißener beziehungsweise Berliner Bischof Schreiber vorgestanden hatte. Vgl. STREHLER, Schreiber, S. 15.
157 Klein an Pacelli vom 10. Oktober 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 8r.
158 Klein an Pacelli vom 10. Oktober 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 8v.
159 Klein an Pacelli vom 10. Oktober 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 8v.
160 Klein an Pacelli vom 10. Oktober 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 9r.
161 Pacelli an Klein vom 18. Oktober 1929 (Entwurf), ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 10r.
162 Vgl. zu dem hier angesprochenen Bericht das Folgende.
163 Anlässlich seiner Einsetzung zum Bischof von Berlin sorgte es zumindest kurzzeitig auf Seiten der preußischen Regierung für Missfallen, dass Schreiber seine Studien in Rom absolviert hatte. Vgl. dazu Bd. 2, Kap. II.1.7 (Die Kontroverse um das staatliche Plazet).
164 Pacelli vermutete, dass der Kandidat im Fuldaer Priesterseminar studiert haben könnte, was sich für ihn wohl daraus ergab, dass die Limburger Alumnen für gewöhnlich dort hingingen. Vgl. SCHATZ, Limburg, S. 238. Dabei hielt der Nuntius das Fuldaer Seminar noch für eine einigermaßen solide Ausbildungsstätte. Vgl. dazu seine Aussage in Bd. 2, Kap. II.1.7 (Pacellis Überlegungen zur Wiederbesetzung der Berliner Delegatur).
165 Vgl. Klein an Pacelli vom 23. Oktober 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 11r–13r. Wobei zu ergänzen ist, dass Klein die Hierarchie der vier Kandidaten nicht streng nach Wertung sortierte, denn obwohl Pappert der Wunschkandidat war, stand er nur auf Rang zwei. Von daher macht das Argument mehr den Eindruck einer nachträglich konstruierten Entschuldigung.
166 Klein an Pacelli vom 23. Oktober 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 11r.
167 Klein an Pacelli vom 23. Oktober 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 11v.
168 Der Freiburger Dogmatiker, obwohl dezidierter Antimodernist, geriet nicht zuletzt deshalb in den Verdacht einer grundsätzlichen Opposition zur (Neu-) Scholastik, weil er gegenüber der aristotelisch-thomistischen Tradition den Platonismus priorisierte. Vgl. dazu LEIDLMAIR, Braig.
169 Klein an Pacelli vom 23. Oktober 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 11v.
170 Regierungspräsident in Wiesbaden war in der Zeit von 1925 bis 1933 der Sozialdemokrat Fritz Ehrler. Über ihn: Ehrler, Fritz, in: Akten der Reichskanzlei; MÜLLER, Adler, S. 417 u. ö.
171 Klein an Pacelli vom 23. Oktober 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 12r.
172 Klein an Pacelli vom 23. Oktober 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 12v.
173 Klein an Pacelli vom 23. Oktober 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 12v.
174 Abschließend überlegte der Jesuit, dass „vielleicht dann am Ende doch Herr Fendel“ noch besser als Wolf geeignet sei, wenn „die Wahl eines ehemaligen Germanikers bedenklich scheinen sollte“ und von Hilfrich aufgrund dieser Prämisse abgesehen werden müsse. Klein an Pacelli vom 23. Oktober 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 12v.
175 Vgl. Pacelli an Gasparri vom 1. November 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 4r–6r.
176 Damit Kilian nichts von der Verzögerung erfuhr, schrieb Pacelli später ihm gegenüber in unbestimmter Diktion: „Seinerzeit habe ich nicht verfehlt, das dem verehrten Schreiben Euer Bischöflichen Gnaden … vom 25. September d[es] J[ahres] beigelegte Bittgesuch an den Heiligen Vater weiterzuleiten.“ Pacelli an Kilian vom 17. November 1929 (Entwurf), ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 17rv, hier 17r. Hervorhebung R.H.
177 „… quod constitutio novi episcopi auxiliaris etiam in dioecesi minori, sicut Limburgensi, non inopportuna videatur propter parvum numerum Episcoporum in Germania existentium.“ Kilian an Pius XI. vom 25. September 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 9r.
178 „… parrebbe quindi necessario che il futuro Vescovo sia tale da non creare difficoltà all’ Istituto medesimo, da cui tanto bene si attende per una miglior formazione del clero in Germania.“ Pacelli an Gasparri vom 1. November 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 4v.
179 „… perchè sembra che non abbia doti eccezionali e sia alquanto debole.“ Pacelli an Gasparri vom 1. November 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 5r.
180 „… indubbiamente di eccellenti qualità …“ Pacelli an Gasparri vom 1. November 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 5r.
181 Sowohl in Mainz als auch in Meißen jeweils 1920/21.
182 Vgl. dazu Bd. 4, Kap. II.4.2 (Pacellis Vorausschau: Antonius Hilfrich für den Meißener Bischofsstuhl?). Den seiner Ansicht nach zentralen Passus übersetzte Pacelli ins Italienische: „Il Rev. Dr. Antonio Hilfrich, attualmente parroco di S. Bonifazio in Wiesbaden, è un sacerdote dotato di vasta cultura filosofica e teologica, di condotta esemplare; ha anche interesse e chiaro discernimento per gli affari pubblici ed è capace di prender parte a discussioni su questi argomenti, senza che debba temersi che egli si arrischi in modo imprudente e si perda eccessivamente nella politica. Posso quindi in tutta coscienza raccomandarlo per l’ufficio di Vescovo di Meissen … Mi sia lecito tuttavia di aggiungere che la perdita di un tale ecclesiastico proprio ora colpirebbe assai gravemente la mia diocesi.“ Pacelli an Gasparri vom 1. November 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 5r-v.
183 „.. sarebbe nondimeno forse utile di procedere in maniera da evitare, in quanto sia possibile, che si muova dalla pubblica opinione la critica – dopochè già per Berlino è stato eletto un ex-alunno del Collegio Germanico-Ungarico – che la S. Sede intenda ora, concluso il Concordato colla Prussia di scegliere tutti i futuri Vescovi fra gli ecclesiastici, i quali hanno studiato in Roma.“ Pacelli an Gasparri vom 1. November 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 5v.
184 „Potrebbe quindi forse suggerirsi delicatamente al Rev.mo Mons. Kilian con ogni cautela ed in via strettamente riservata di proporre egli stesso alla S. Sede in una nuova istanza l’Hilfrich come Coadiutore con futura successione, indicando eziandio in qual guisa convenga di regolare la questione dell’assegno; in tal modo l’anzidetto inconveniente rimarrebbe, se non erro, eliminato od almeno assai diminuito.“ Pacelli an Gasparri vom 1. November 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 5v–6r.
185 Vgl. Gasparri an Pacelli vom 10. November 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 16r.
186 Vgl. Pacelli an Kilian vom 17. November 1929 (Entwurf), ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 17rv.
187 Pacelli an Kilian vom 17. November 1929 (Entwurf), ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 17r.
188 Pacelli an Kilian vom 17. November 1929 (Entwurf), ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 17r.
189 Pacelli an Kilian vom 17. November 1929 (Entwurf), ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 17r.
190 Vgl. Göbel an Pacelli vom 21. November 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 18r.
191 Vgl. Kilian an Pacelli vom 25. November 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 21rv.
192 Die Weltwirtschaftskrisen der 1920er Jahre (und danach) mit den gravierenden Folgen der Geldentwertung führten in Limburg zum Beispiel dazu, dass der von Bischof Karl Klein 1896 eingerichtete Fonds für das Priesterseminar verloren ging. Vgl. SCHATZ, Limburg, S. 242.
193 Kilian an Pacelli vom 25. November 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 21v.
194 Attest des Chefarztes des Herz-Jesu-Krankenhauses Dernbach, Dr. Lorenz Fiedler, über Kilians gesundheitliche Verfassung vom 23. November 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 20rv, hier 20v.
195 Rendant der Bistumshauptkasse war zu dieser Zeit August Dommermuth. Vgl. Schematismus der Diözese Limburg 1927, S. 4.
196 Vgl. Pacelli an Kilian vom 3. Dezember 1929 (Entwurf), ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 22r. Wiederum vermittelte der Generalvikar den Brief an Kilian weiter. Vgl. Göbel an Pacelli vom 8. Dezember 1929, ebd., Fol. 23r.
197 Pacelli an Kilian vom 3. Dezember 1929 (Entwurf), ASV, ANB 49, Fasz. 3, Fol. 22r.
198 Vgl. Kilian an Pius XI. vom 3. Januar 1930, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 12r–14r (nur r).
199 Vgl. das von Pius XI. unterzeichnete Ernennungsdekret vom 7. Februar 1930, in: AAS 22 (1930), S. 98.
200 Daraus resultiert auch, dass mit dem Schreiben Göbels an Pacelli vom 8. Dezember 1929 die Unterlagen zu diesem Besetzungsfall im Nuntiaturarchiv enden. Zwar sprach der Geschäftsträger der Nuntiatur, Luigi Centoz, später davon, dass er Kopien von Dokumenten aus Rom für das Nuntiaturarchiv angefertigt habe. Da jedoch diese Unterlagen nicht aufzufinden waren, ist man auf die Akten des Staatssekretariats angewiesen. Diese Einschränkung fällt jedoch nicht ins Gewicht, weil die Berliner Nuntiatur von nun an ohnehin nur noch spärlich in die Geschehnisse um die Nachfolge Kilians involviert war.
201 Vgl. Pacelli an Kilian vom 29. Januar 1930 (Entwurf), S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 16r–17r (nur r). Ob letztlich der Name Pacellis als Absender unter dem Schreiben stand, geht aus dem Entwurf nicht hervor. Fakt ist, dass das lateinische Skriptum zuallererst eine italienische Urfassung hatte, die aus der Feder Pacellis stammte (Fol. 15rv) und anschließend ins Lateinische übersetzt wurde (Fol. 18rv). Vgl. auch den Hinweis bei PAGANO/CHAPPIN/COCO (Hg.), fogli, S. 124. Das Schriftstück ließ Pacelli diskret übersenden, indem er einen Umschlag für Kilian mit der Aufschrift „Streng persönlich“, der den eigentlichen Text enthielt, in einen zweiten Umschlag steckte, der an Generalvikar Göbel adressiert war.
202 „… eum monens, ut voluntati Summi Pontificis obtemperet.“ Kilian an Pacelli vom 7. Februar 1930, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 19r.
203 Hilfrich an Pacelli vom 11. Februar 1930, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 21r–22v, hier 21r.
204 Hilfrich rechnete die Zahl auf Basis des Schematismus von 1927 zusammen. Vgl. Schematismus der Diözese Limburg 1927, S. 121.
205 Zum Beleg legte Hilfrich seiner Korrespondenz ein Foto der St. Bonifatiuskirche bei. Vgl. Hilfrich an Pacelli vom 11. Februar 1930, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 22v.
206 Das secretum Sancti Officii, unter dem alle wesentlichen Korrespondenzen von Pacelli respektive vom Heiligen Stuhl standen, stellte insbesondere für den kranken Augustin Kilian ein nicht unbedeutendes Problem dar. Denn er war auf die Absprachen mit dem Domkapitel, seinem Generalvikar und auch seinem Sekretär angewiesen, was ihm das Geheimnis aber verwehrte. Die Strafe für die Verletzung des secretums bestand in der Exkommunikation latae sententiae, woran eine häufig auf den entsprechenden Schreiben befindliche Formel erinnerte: „Sub secreto S. Officii. Violatio huius secreti, quolibet modo, etiam indirecte, commissa plectitur excommunicatione latae sententiae, a quo nemo, nisi Romanus Pontifex, praeterquam in mortis articulo, absolvere potest.“ Z.B. bei Pacelli an Kilian vom 16. März 1930 (Entwurf), S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 30r. Aus Angst vor dieser schweren Strafe richtete Kilian wenig später ein Gesuch an den Papst, in dem er schilderte, dass ein paar Mitarbeiter unter den gegebenen Umständen einige Kenntnisse von dem Inhalt der verhandelten Materie erhalten hätten. Unter anderem könne er – so Kilian – die Briefe nicht selbst verfassen, sondern diktiere sie seinem Sekretär. Auch sei er nicht in der Lage gewesen, sämtliche Schriftstücke nach der Lektüre zu Verbrennen, wie es stets gefordert war. Daher kam er zu dem Ergebnis: „Ita violavi secretum S. Officii, non vero ex levitate aut contemptu, sed optima fide, ita ut etiam hodie persuasum mihi sit, me peccatum non commisisse.“ Kilian an Pius XI. vom 4. März 1930, ebd., Fol. 28r–29r (nur r), hier 29r. Zwar glaubte der Limburger Oberhirte also trotz der Vergehen nicht, gesündigt zu haben, bat aber dennoch – für den Fall, dass er doch die schwere Sünde begangen habe – um die päpstliche Absolution, „propter gravissimam minationem excommunicationis die noctuque anxietatibus me afficiunt“ (Fol. 29r). Pius XI. kam seiner Bitte nach und absolvierte ihn zur Vorsicht von jeder Strafe, freilich mit der mahnenden Gewissheit, dass Kilian zukünftig umsichtiger handeln werde. Darüber hinaus wurde er verpflichtet, alle Mitwisser davon in Kenntnis zu setzen, dass sie auch das genannte secretum einzuhalten hätten. Vgl. Pacelli an Kilian vom 16. März 1930 (Entwurf), ebd., Fol. 30r. Dieses Schreiben des Kardinalstaatssekretärs stand übrigens ebenfalls unter dem Geheimnis und enthielt erneut die Aufforderung, das Dokument nach dem Lesen zu verbrennen.
207 Pacelli an Kilian vom 18. Februar 1930 (Entwurf), S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 23rv, hier 23r. Hervorhebung im Original.
208 Vgl. Pizzardo an Canali vom 11. Februar 1930, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 20r und Canali an Pizzardo vom 15. Februar 1930, ebd., Fol. 24r.
209 Vgl. Kilian an Pius XI. vom 25. Februar 1930, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 25r.
210 Vgl. Pacelli an Centoz vom 16. März 1930 (Entwurf), S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 26rv.
211 Vgl. Art. 2, Nr. 10 des Preußenkonkordats, HUBER/HUBER (Hg.), Staat und Kirche IV, S. 324.
212 „Dopo vive insistenze …“ Centoz an Pacelli vom 29. März 1930, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 34r.
213 Vgl. Centoz an Pacelli vom 29. März 1930, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 37r–38r.
214 „… Sig. Ministro, gentilissimo …“ Centoz an Pacelli vom 29. März 1930, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 37v.
215 Vgl. Pacelli an Centoz vom 28. März 1930 (Entwurf), S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 33r.
216 Vgl. Pacelli an Centoz vom 2. April 1930 (Entwurf), S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 39r.
217 Vgl. Centoz an Pacelli vom 10. April 1930, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 46rv.
218 Vgl. Pacelli an Centoz vom 17. April 1930 (Entwurf), S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 47r.
219 Vgl. Pacelli an Kilian ohne Datum (Entwurf), S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 35r. Vgl. auch AAS 22 (1930), S. 243. Kilian bedankte sich anschließend, dass seine Bitte um Unterstützung bei seinen oberhirtlichen Aufgaben erhört worden war. Vgl. Kilian an Pacelli vom 2. April 1930, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 42r.
220 Vgl. den Textentwurf Pacellis vom 31. März 1930, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 40r. Vgl. auch die Bekanntmachung im „Osservatore Romano“ Nr. 75 vom 31. März–1. April 1930.
221 Vgl. die Anweisung Pacellis zur Ausfertigung der Schriftstücke an den Assessor, Raffaello Rossi, vom 31. März 1930 (Entwurf), S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 36rv und die Antwort Rossis vom 2. April 1930, ebd., Fol. 41r.
222 Vgl. Rossi an Pizzardo vom 10. April 1930, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 43r. Vgl. zur Wahl Kilians 1913 HIRSCHFELD, Bischofswahlen, S. 306–316.
223 In der Ernennungsbulle Schultes wurde auf das Metropolitankapitel keinen Bezug genommen, sondern der Transfer des Paderborner Oberhirten nach Köln einzig als Akt des Papstes dargestellt. Vgl. Bulla apostolica, qua Illmus ac Rvssmus Dmnus Archieppus ad Sedem Archiepiscopalem Coloniensem transfertur, in: Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Cöln Nr. 12 vom 15. Mai 1920.
224 Vgl. Pizzardo an Rossi vom 11. April 1930 (Entwurf), S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1930, Pos. 587 P.O., Fasz. 95, Fol. 44r–45r (nur r). Das erste Exemplar der Ernennungsbulle musste dann auch noch nachgebessert werden, weil es die Anordnung enthielt, dass mit der Erhebung Hilfrichs seine Wiesbadener Pfarrei ipso facto vakant werde. Das gehörte zur Standardprozedur, aber widersprach in diesem Fall der vereinbarten Lösung des Unterhaltproblems. Daher wandte sich Kilian vor der Publikation des Dokuments noch ein weiteres Mal an Pacelli und trug erneut die schon mehrfach ausgebreiteten Argumente für den Verbleib des Pfarrbenefiziums in den Händen des neuen Koadjutors vor. Doch bei der Anordnung handelte es sich wohl lediglich um einen Fehler der Konsistorialkongregation, den Pacelli umgehend korrigieren ließ. Vgl. Kilian an Pacelli vom 20. April 1930, ebd., Fol. 48rv und Pacelli an Kilian ohne Datum (Entwurf), ebd., Fol. 47bisr.
225 Vgl. Ernennungsbulle Hilfrichs zum Koadjtuor cum iure successionis vom 31. März 1930, in: Amtsblatt des Bistums Limburg Nr. 6 vom 13. Mai 1930. Die Rechtfertigung für die Nomination lautete: „Meine lieben Diözesanen! Seit fast zwei Jahren bin ich krank, und noch immer ist es mir nicht möglich, den Verpflichtungen meines Amtes in ihrem vollen Umfange gerecht zu werden. Daher habe ich den Heiligen Vater unter Darlegung meiner Gesundheitsverhältnisse gebeten, mir einen Koadjutor zu geben, der die mit großer körperlicher Anstrengung verbundenen Pontifikalhandlungen mir abnähme. Der Heilige Vater ist huldvollst auf meine Bitte eingegangen und hat den derzeitigen Stadtpfarrer von Wiesbaden, wie nachstehende Urkunde beweist, zu meinem Koadjutor mit dem Rechte der Nachfolge ernannt. Ich bitte euch, liebe Diözesanen, den Klerus wie das Volk, die Liebe und Anhänglichkeit, die ihr mir in reichem Maße allezeit erwiesen habt, auch auf ihn zu übertragen.“ Ernennung eines bischöflichen Koadjutors von Augustin Kilian vom 12. Mai 1930, in: ebd.
226 Vgl. „Konsekration des Hochwürdigsten Herrn Bischöflichen Koadjutors“, in: Amtsblatt des Bistums Limburg Nr. 7 vom 24. Mai 1930.
227 Vgl. „Ableben des Hochwürdigsten Herrn Bischofs Augustinus“, in: Amtsblatt des Bistums Limburg Nr. 13 vom 30. Oktober 1930.
228 Zu diesem Anlass erhielt er am 25. November ein Gratulationsschreiben von Kardinalstaatssekretär Pacelli im Auftrag des Papstes, in: Amtsblatt des Bistums Limburg Nr. 17 vom 29. Dezember 1930.
229 Vgl. „Feier der Inthronisation Seiner Bischöflichen Gnaden“, in: Amtsblatt des Bistums Limburg Nr. 15 vom 29. November 1930.
230 Vgl. zum Beispiel: „Für seinen Nachfolger hatte Bischof Augustinus noch selbst gesorgt.“ KAMPE u.a. (Hg.), Weg, S. 22. Vgl. ebenso SCHATZ, Limburg, S. 224.
231 Insbesondere von protestantischer Seite war bereits die Errichtung des Bistums Berlin äußerst kritisch beäugt worden. Der Generalsekretär des „Evangelischen Bundes“ in Berlin etwa, Georg Arndt, bezichtigte den Heiligen Stuhl, dasselbe als römisches Propagandainstrument zu verwenden. Vgl. ARNDT, Vordringen. Vgl. auch HÖHLE, Gründung, S. 176–184; MAY, Kaas 2, S. 431–433. Nachdem er dort bereits einen Germaniker als Oberhirten installiert hatte, befürchtete Pacelli umso mehr Invektiven, wenn diese Praxis bei den folgenden Besetzungen unvermindert weiterging.
232 Vgl. UNTERBURGER, Lehramt, S. 358–362.