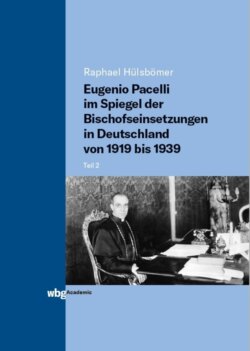Читать книгу Eugenio Pacelli im Spiegel der Bischofseinsetzungen in Deutschland von 1919 bis 1939 - Raphael Hülsbömer - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ergebnis
Оглавление1. Hinsichtlich des Profils des Berliner Diözesanbischofs hatte Pacelli eine klare Vorstellung. Er hielt die von Bertram herausgestellte, auf Innerlichkeit und Administration zielende Leitlinie zwar durchaus für „essentiell wichtig“, doch maß er ihr nicht den Status einer hinreichenden Bedingung zu.128 Der künftige Oberhirte sollte auch in der Lage sein, sich auf diplomatischem Parkett zu bewegen und die „Feinheiten der Umgangsformen“ zu beherrschen: Anders als der Breslauer Fürstbischof beurteilte er diese nicht nur als „sekundäre Dekoration“, sondern als bedeutenden Bestandteil, um die deutsche Kirche in der politischen Schaltzentrale Preußens und des Reichs zu vertreten.
Ein weiteres, noch darüber gelagertes Kriterium, den „punto capitale“, sah Pacelli in der Frage der Priesterausbildung: Seiner Überzeugung nach musste der künftige Oberhirte unbedingt den Missstand abstellen, dass die Alumnen der Berliner Delegatur beziehungsweise des neuen Bistums ihre philosophisch-theologischen Studien an der seiner Meinung nach defizitären und häresieverdächtigen staatlichen Katholisch-Theologischen Fakultät Breslau absolvierten. Stattdessen müssten die Studenten zu den Jesuiten an die päpstliche Gregoriana oder nach St. Georgen entsandt werden, notfalls auch in die Priesterseminare von Trier oder Fulda. An diesen Orten sah Pacelli die römischen Anweisungen, wie sie der Erlass der Studienkongregation von 1921 an die deutschen Bischöfe formuliert hatte, am ehesten umgesetzt: den Unterricht der – wie Pacelli sagte – „gesunden“ Lehre, der scholastisch-spekulativ durchformten Philosophie und Theologie. Der neue Bischof hatte die Notwendigkeit einer solchen Prägung des jungen Klerus zu erkennen und sich als Handlungsdirektive aufzuerlegen. Als Indikator, der die Hoffnung rechtfertigte, dass der in Aussicht genommene Geistliche diese Sicht teilte, galt dem Nuntius vorzugsweise das Faktum, dass jener selbst eine solche Ausbildung, zum Beispiel als Alumne des Germanicums, erhalten hatte (so Kaas und Schreiber) oder aber treu und anhänglich dem Heiligen Stuhl – und damit dessen Anweisungen – ergeben war (so bei Steinmann, Schreiber und Kaas). Notfalls hielt Pacelli dafür, „auf geheimen Wege Zusicherungen“ von den potentiellen Kandidaten einzuholen – diese sollten also im Vorhinein ein entsprechendes Regierungsprogramm gewissermaßen als Wahlkapitulation unterzeichnen.
In das skizzierte Profil passte nach Ansicht des Nuntius zunächst und vor allem sein langjähriger Vertrauter Kaas. Als Ex-Alumne des Germanicums, als „ein Mann von hohen und außergewöhnlichen“ sowie überall anerkannten Qualitäten, insbesondere im Bereich der Kanonistik, gehorsam gegenüber den kirchlichen Autoritäten, erkannte er in ihm eine personifizierte Synthese aller Anforderungen eines Oberhirten der Reichshauptstadt. Man kann sich die Frage stellen, warum Pacelli nun auf einmal den Prälaten, den er seit bereits immerhin zehn Jahren kannte und schätzte, als Bischofskandidaten in Erwägung zog und nicht schon anlässlich früherer Sedisvakanzen. Die Antwort liegt auf der Hand: Bislang wollte Pacelli dessen kanonistische Beratung, insbesondere in den Konkordatsangelegenheiten, nicht missen. Nun stand das Preußenkonkordat kurz vor seinem Abschluss und Pacelli wusste, dass sich seine Zeit in Deutschland dem Ende zuneigte. Er benötigte daher die Dienste des Prälaten in der bisherigen Form nicht mehr und wollte womöglich die Zusammenarbeit unter geändertem Vorzeichen – nämlich vom Kurialen in Rom zum Bischof der Reichshauptstadt – fortsetzen.129
Auch der Ersatzkandidat für Kaas, Schreiber, entsprang nach Lage der Quellen Pacellis eigener Überlegung. Der ehemalige Germaniker fügte sich haargenau in sein veranschlagtes Profil, wobei allgemeine Attribute wie „tadelloses Leben“ sowie energisches, aktives und eifriges Wirken das Bild komplettierten. Wie Pacelli letztlich darauf kam, ihn nach Berlin zu berufen, beantworten die Quellen nicht. Wenn die Berufung von Kaas schon nicht möglich war, so suchte Pacelli offenbar nach einem bereits erfahrenen Oberhirten, der seinen Sinn für die Priestererziehung bereits unter Beweis gestellt hatte. Genau dies attestierte der Nuntius dem Meißener Bischof in seiner Abschlussbeurteilung der deutschen Kirche, die er wenige Wochen nach dessen interimistischer Einsetzung zum Berliner Administrator verfasste:
„In der Leitung der Diözese Meißen, Diasporagebiet, hat er eine große Arbeitsamkeit entwickelt. Die Priesteramtskandidaten, die vorher in Prag ausgebildet wurden, erfüllen nun die ersten vier Jahre der philosophischen und theologischen Ausbildung in Fulda (einige auch in Innsbruck oder am Collegium Germanicum und Hungaricum in Rom) und die letzten zwei Jahre im Priesterseminar, das von Bischof Schreiber in Schmochtitz bei Bautzen errichtet wurde.“130
Darüber hinaus war Schreiber gerade für Berlin auch durch seine Erfahrungen in der Diaspora und an der Spitze eines ostdeutschen Bistums prädestiniert. Anzunehmen ist also, dass Pacelli ihn als adäquatesten Amtsanwärter ausmachte, als er kurz vor seiner Rückbeorderung aus Deutschland über den Episkopat Bilanz zog.131 Obwohl sich also sein ursprünglicher Plan, seinen engen Vertrauten Kaas an die Spitze der Berliner Hierarchie zu transferieren, nicht realisieren ließ, gelang Pacelli durch die Ernennung Schreibers ein seiner Auffassung nach erfolgreicher Abschluss des Besetzungsfalls.
2. Der Besetzungsmodus stand ganz im Zeichen des kurz vor dem Abschluss stehenden Preußenkonkordats und der damit verbundenen „Aufwertung“ der Berliner Delegatur zum Bistum. Dadurch bekam für Pacelli das Propst- und Delegatenamt eine völlig neue Bedeutung, insofern der Inhaber das Format des künftigen Diözesanbischofs besitzen musste. Zwar unterlag die Ernennung des Propstes von St. Hedwig rechtlich einer Konvention zwischen preußischer Staatsregierung und Breslauer Fürstbischof, der sogar die Bereitschaft signalisierte, die Personalentscheidung mit dem Heiligen Stuhl abzustimmen. Doch Pacelli wollte die Einsetzung des Propstes und damit des fürstbischöflichen Delegaten von Rom vornehmen lassen, Bertram die Verwaltungsbefugnis entziehen und dafür notfalls den Can. 1435 anwenden.
Anders als Bertram trieb den Nuntius keine Eile in der Kandidatenwahl, denn wichtiger als eine schnelle Amtsbesetzung schien ihm „eine wahrhaft gute Wahl“. Während Bertram und Interimsdelegat Cortain die Dringlichkeit der Besetzung am geistlichen und administrativen Wohl der Delegatur festmachten, ordnete Pacelli diese unmittelbare pastorale Notwendigkeit einer seinem Ideal entsprechenden Personenwahl und dem Preußenkonkordat unter. Denn er sorgte sich darum, dass eine Besetzung kurz vor Konkordatsabschluss sich in letzter Sekunde noch negativ auf den Kontrakt auswirken konnte – insbesondere wenn ein in Rom geschulter Theologe erster Bischof der preußischen Hauptstadt werden sollte. Daher terminierte Pacelli die römische Ernennung Schreibers auf den Zeitpunkt unmittelbar nach Austausch der ratifizierten Urkunden. Andererseits war es auch nicht in seinem Interesse, dass der neue Oberhirte gemäß dem in diesem Augenblick an sich rechtlich gültigen Konkordatsmodus bestellt würde. Ein Aufschub der Besetzung bis zur kanonischen Errichtung des Bistums Berlin und der Einrichtung des Domkapitels, wodurch eine Kapitelswahl unumgänglich geworden wäre, kam für ihn nicht in Frage. Dies hätte die Besetzung nicht nur weiter wesentlich verzögert, sondern auch die gewünschte Einsetzung Schreibers gefährdet – wer konnte voraussagen, wie die Kapitelswahl ausging? Stattdessen plädierte Pacelli für eine „besondere Vereinbarung“ mit der preußischen Regierung: Diese sah eine römische Nomination Schreibers zum provisorischen Administrator ad nutum Sanctae Sedis des Berliner Delegaturbezirks mit allen Vollmachten eines Diözesanbischofs vor. Ein ordentlicher Diözesanbischof konnte erst nach der kanonischen Zirkumskription der Diözese bestellt werden. Durch dieses rechtliche Konstrukt sicherte Pacelli also sowohl einen ungefährdeten Konkordatsabschluss als auch – gewissermaßen durch ein erstes „Aussetzen“ des soeben geschlossenen Vertrags – eine ungefährdete, das heißt durch keine Kapitelswahl bedingte Einsetzung seines idealen Kandidaten.
3. Pacelli sprach der preußischen Staatsregierung bei der Nomination Schreibers zum provisorischen Administrator von Berlin das politische Bedenkenrecht zu, das faktisch identisch mit der Klausel war, die ihr das Preußenkonkordat zugestand. Zu weitergehenden Konzessionen an den Staat war der Nuntius nicht bereit. Nachvollziehbarerweise wünschte der Kultusminister eine möglichst getreue Umsetzung des im Konkordat vereinbarten Besetzungsmodus: Zwar sah er ein, dass eine Bischofswahl ohne Domkapitel nicht möglich war, doch zumindest das Listenverfahren sollte seiner Ansicht nach Anwendung finden. Nach einer Auseinandersetzung mit Professor Heyer, einer kurzen Bedenkzeit und einer Rücksprache mit Bertram blieb Pacelli hart und lehnte die Idee der „engstirnigen Bürokraten“, den preußischen Episkopat Kandidaten vorschlagen zu lassen, obwohl der electus bereits feststand, als „unwürdige Farce“ ab. Diplomatisch geschickt holte er zum Gegenschlag aus und erklärte, dass bei einer so weit als möglichen Umsetzung des Konkordatsmodus die Anfrage nach politischen Bedenken entfallen müsse: Das dafür zuständige Domkapitel existierte nämlich noch nicht. Diese Argumentation war von den Staatsbeamten nicht zu widerlegen, die auf keinen Fall auf ihre einzige und zentrale Einflussoption bei der Besetzung der Bischofsstühle verzichten wollten und konnten. Sie hatten versäumt, sich im Konkordat für die Erstbesetzung der neuzuumschreibenden Diözesen Zusicherungen geben zu lassen. Somit setzte sich der Nuntius mit seinen Vorstellungen zum Modus genauso gegen die staatliche Seite durch wie mit seinem Kandidaten – ganz gleich, ob die Vorbehalte Beckers gegen Schreiber real oder nur strategisch waren. Hatte Pacelli im Hildesheimer Besetzungsfall wenige Monate zuvor noch aus verhandlungstaktischen Gründen auf die Einsetzung eines Germanikers verzichtet, so wiederholte er diese Rücksichtnahme an dieser Stelle nicht. Das lag gewiss daran, dass das Konkordat soeben erfolgreich ratifiziert worden war, demonstriert aber gleichzeitig, welche Bedeutung Pacelli der Besetzung des Berliner Bistums zumaß. Nach diesen wesentlichen Erfolgen zeigte er sich dann wieder nachgiebig, indem er versprach, sich bei der Besetzung des ebenfalls neuen Bistums Aachen für die Umsetzung des 6. Konkordatsartikels einzusetzen. Dies war jedoch zunächst einmal ein Versprechen auf Zukunft. Auf diese Weise wollte der geschulte Diplomat den Fall offensichtlich in einem versöhnlichen Klima zum Abschluss bringen, ohne substantielle Konzessionen zu machen.
4. Nicht weniger als an vier Stellen des Falls tauchen anonyme Informanten Pacellis auf, was deutlich zeigt, welch begrenztes Bild die vatikanischen Quellen vom skizzierten Fall zeichnen.132 Die Identitäten dieser Anonymitäten lassen sich wohl nicht vorbehaltlos aufdecken, zumal man nicht einmal klären kann, ob es sich jeweils um verschiedene Informationsquellen oder vielleicht sogar jeweils um dieselbe handelte. Sicherlich muss man davon ausgehen, dass einer dieser Informanten Kaas war, der nicht nur ex professo als kanonistischer Berater des Nuntius am Besetzungsfall interessiert sein musste – immerhin hatte dieser erhebliche konkordatäre Relevanz –, sondern darüber hinaus eo ipso als Bischofskandidat beteiligt war. Daher wird man nicht fehlgehen in der Annahme, dass Pacelli sowohl Modus als auch Kandidatenfrage mit dem Prälaten erörterte. Darüber hinaus gilt die Überlegung, dass das Fehlen von schriftlichen Zeugnissen innerhalb des sehr vollständigen Nuntiaturarchivs es zumindest wahrscheinlich macht, dass Pacelli die anonymen Personen mündlich und das heißt (wenn nicht telefonisch) vor Ort befragte. Daher kommen vor allem Berliner Geistliche in Betracht, wo sicher an den Jesuitenpater Franz Rauterkus zu denken ist, der als Superior und Kurat von St. Clemens seit vielen Jahren in der Hauptstadt weilte. Pacelli betrachtete ihn als absolut vertrauenswürdig und suchte bei ihm häufiger Rat, wenn es um ostdeutsche Besetzungen ging.133 Von daher wäre es zumindest nicht überraschend, wenn der Nuntius den Berlinkenner Rauterkus auch im Berliner Besetzungsfall konsultiert und etwa über Schreiber und die aufgeworfene Problematik der Priesterausbildung befragt hätte.134
Sieht man von Kaas ab, so war Bertram der einzige, mit dem sich Pacelli hinsichtlich des Besetzungsmodus nachweislich auseinandersetzte. Michael Höhle vermutete, dass Bertram erst in die Ernennung des Administrators mit einbezogen wurde, als mit Schreiber der Kandidat feststand und der Streit um das staatliche Plazet entbrannte.135 Diese Vermutung ist teils richtig, teils falsch: richtig, insofern Pacelli sich erst zu dem angesprochenen Zeitpunkt an den Breslauer Kardinal wandte, und falsch, insofern dieser zuvor schon mehrfach beim Nuntius in dieser Angelegenheit brieflich und mündlich (nämlich anlässlich der Exequien Deitmers) vorstellig geworden war. Hatte ihn der Nuntius zuvor zwar nicht befragt, so kam er mit ihm zumindest in der grundlegenden Perspektive überein, dass die Besetzung der Propstei und der Delegatur bereits auf die künftige Bistumserhebung gemünzt sein musste. Alle anderen Vorstellungen Bertrams lehnte Pacelli in seiner Berichterstattung gegenüber Gasparri ab: die (mit Rom abgestimmte) Bestellung des Delegaten und damit künftigen Oberhirten durch den Fürstbischof, den Rat einer zügigen Wiederbesetzung des vakanten Amtes, die Relativierung der repräsentativen Fähigkeiten des Kandidaten und nicht zuletzt die drei Kandidatenvorschläge, woran auch Pacellis differenziertere Sicht auf Steinmann nichts änderte. Hatte Bertram in Meißen 1921, wo er Schreiber für den neu errichteten Bischofsstuhl vorgeschlagen hatte, noch Einfluss auf die Personalentscheidung gehabt, war dies jetzt wie schon in Hildesheim 1928/29 anders. Nach Lage der Quellen trat Pacelli von seiner Seite aus mit Bertram erst in Kontakt, als er dazu die Anweisung aus Rom erhielt. Als das preußische Kultusministerium die Kandidatenlisten einforderte, besprach sich Pacelli ebenfalls mit Bertram, konnte sich allerdings in diesem Fall dessen Zustimmung sicher sein. Überblickt man die Meinungsverschiedenheiten, wie auch die Tatsache, dass Pacelli nicht auf Bertrams Eingaben reagierte, so lässt sich der Eindruck nicht leugnen, dass der Nuntius den Breslauer Kardinal bewusst so weit als möglich aus dem Entscheidungsprozess heraushielt. Das gespannte Verhältnis zwischen den beiden Kirchenfürsten, das sich im Laufe der 1920er Jahre entwickelt hatte, wird hier offenkundig.136
Zu konstatieren ist schließlich, dass Pacelli sich aktiv keine Kandidatenvorschläge einholte, sondern lediglich Beurteilungen über von ihm vorgegebene Geistliche einforderte. Obwohl er Kaas sehr gut kannte, ließ er sich von dessen Diözesanbischof Bornewasser ein Gutachten anfertigen. Nach dem Gesagten ist es wenig überraschend, dass Pacelli diese Ordinarius-Diözesanpriester-Beziehung bei dem von Bertram proponierten Steinmann nicht genügte. Zwar hatte der Fürstbischof dem Nuntius keine längere Beurteilung des Genannten geliefert, sodass es nachvollziehbar erscheint, wenn Pacelli noch ein genaueres Votum wünschte. Darum hätte er Bertram jedoch nachträglich noch bitten können. Stattdessen befragte er Schreiber über den Breslauer Domkapitular und zwar aus dem einfachen Grund, dass der Meißener Oberhirte letzteren „seit Jahren“ kannte. Wenngleich der Nuntius seinem positiven Eignungsurteil über Steinmann letztlich nicht folgte, erscheint Schreiber damit als Vertrauensperson noch bevor Pacelli ihn selbst als Amtsanwärter deklarierte.
Nachdem im Anschluss an Schreibers Gutachten noch eine Zweifelsfrage über die Umgänglichkeit Steinmanns verblieben war, wandte sich Pacelli an seinen langjährigen Privatsekretär Gehrmann. Als „Ostexperte“ und aufgrund persönlicher Bekanntschaft war er in der Lage, sich zur angesprochenen Frage zu äußern.137 Eine schriftliche Anfrage Pacellis an den Steyler Missionar ist nicht überliefert – es ist davon auszugehen, dass der Nuntius sein Ansinnen mündlich überbrachte. Ohne die schriftliche Antwort Gehrmanns wäre dieser Informationsaustausch daher gar nicht zu fassen gewesen. Möglich ist daher auch, dass der Steyler einer der eingangs angesprochenen anonymen Quellen war.
5. Die römische Politik im Berliner Besetzungsfall war einzig und allein die Politik Pacellis. Er bestimmte den Modus, den Zeitplan, die Kandidaten, traf alle relevanten Entscheidungen und erhielt von Gasparri für alles einen Freifahrtschein. Nicht etwa der Nuntius holte sich Rat und Order beim Kardinalstaatssekretär, sondern umgekehrt letzterer holte sich diese bei ersterem, was die Frage zur Promulgation der neuen Zirkumskriptionsbulle augenfällig zeigt. Dabei war die Weise der Berichterstattung von Pacelli wohl überlegt: So bestand sein erster Bericht vom 16. März – knapp zwei Monate nach dem Tod Deitmers – letztlich in einem Referat abgeschlossener Überlegungen, der den weiteren Kurs des Handelns des Heiligen Stuhls klar absteckte. Darin gab Pacelli auch Bertrams Eingabe wieder, freilich nur, um sie in allen wesentlichen Punkten direkt zu destruieren. Bertrams Kandidaten, die er als untauglich ausgewiesen hatte, stellte Pacelli dann in geschickter Argumentation seinen eigenen Favoriten Kaas gegenüber. Dabei überließ er seinem Vorgesetzten gewissermaßen den „Schein“ einer Personalwahl, insofern er Steinmann zwar sehr mäßig, aber immerhin als tauglich deklarierte: Das heißt, dieser war formaliter wählbar, aber realiter gab es bessere Kandidaten – nämlich insbesondere Kaas. Daher ist es auch bemerkenswert, dass Pacelli das positiv über Steinmann urteilende Votum Gehrmanns nicht erwähnte, geschweige denn nach Rom übermittelte. Ebenso verzichtete Pacelli darauf, die „neuen“ Erkenntnisse über Schreibers Priesterausbildungspraxis mitzuteilen. Allerdings muss davon ausgegangen werden, dass er es getan hätte, wenn er keine weiteren, die früheren Angaben relativierenden Informationen erhalten hätte – immerhin hatte er den Nuntiaturbericht zu diesem Zeitpunkt bereits verfasst. Dessen Inhalt war jedoch dann überflüssig geworden und daher für das Staatssekretariat in Pacellis Augen nicht relevant.
Die einzige römische „Weisung“ im Wortsinn erhielt Pacelli, als Bertram – gewiss verärgert darüber, von Pacelli weithin ignoriert worden zu sein – sich auf direktem Weg an Pius XI. wandte. In diesem Augenblick war die zielgerichtete Berichterstattung Pacellis nicht mehr die exklusive Informationsquelle der Kurie. Prompt machte sich der Papst die Warnung, die vakante Delegatenstelle noch länger unbesetzt zu lassen, zu eigen und gab über Gasparri den Auftrag, eine kurzfristige Lösung zu suchen sowie sich mit Bertram darüber zu verständigen. Diese erste Vorgabe erfüllte Pacelli, die zweite führte er offenbar nur teilweise aus, denn ohne mit dem Breslauer Oberhirten zu sprechen erwählte er Schreiber als Kandidaten. Erst nachdem er die römische Zustimmung in den Händen hielt, teilte er ihm die Personenwahl mit. Auch den Übergangsmodus des provisorischen Administrators für Berlin überlegte sich der Nuntius ohne vorhergehende Rücksprache mit Bertram. Damit blieb Pacelli die allein maßgebliche Instanz, die den Verlauf des Besetzungsfalls bestimmte.
1 Vgl. zur Besetzung des bischöflichen Stuhls von Berlin 1929/30 BANASCH, Delegaturbezirk, S. 99f.; GATZ, Besetzung, S. 212f.; HARTELT, Piontek, S. 161; HÖHLE, Gründung, S. 203–212, 217–220; DERS., Berliner Bischöfe, S. 99–101; KNAUFT, Bistum Berlin, S. 1f.; STREHLER, Schreiber, S. 68–72.
2 Vgl. zur Gründung des Bistums Berlin mit der entsprechenden Vorgeschichte maßgeblich HÖHLE, Gründung. Vgl. auch BANASCH, Delegaturbezirk; BISCHÖFLICHES ORDINARIAT BERLIN (Hg.), Glaube, S. 21–48; GOLOMBEK, Vorgeschichte, S. 69f., 92f.; STASIEWSKI, Bischofssitze, S. 168–172; DERS., Errichtung, S. 85–91.
3 Vgl. De salute animarum, Nr. XXXIII, HUBER/HUBER (Hg.), Staat und Kirche I, S. 214. Ein Statut des Breslauer Fürstbischofs von 1870 wiederholte diese Bestimmung noch einmal. Vgl. DAUMERT, Statut, S. 84.
4 HÖHLE, Gründung, S. 188.
5 Vgl. Bertram an Pacelli vom 1. Februar 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 1r–2r.
6 Bertram an Pacelli vom 1. Februar 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 1r.
7 Das genannte Statut von 1854 bestimmte, dass „unbeschadet des landesherrlichen Patronatsrechts über die St. Hedwigskirche bei jedem eintretenden Erledigungsfalle der Propstei zu St. Hedwig die Wiederbesetzung derselben zum Gegenstande einer besonderen, auf Verständigung über die am meisten geeignete Persönlichkeit gerichteten Communication zwischen dem Minister der geistlichen Angelegenheiten und dem fürstbischöflichen Stuhle gemacht und dem in Betracht gezogenen Candidaten Seitens des Fürstbischofs die kirchliche Investitur auf die Pfarrei und die canonischen Vollmachten für das Delegatenamt erst ertheilt werden sollen, nachdem derselbe Seitens des Ministers auf Grund der in jedem einzelnen Falle zuvor eingeholten besonderen Allerhöchsten Ermächtigung für annehmbar erklärt worden ist.“ DAUMERT, Statut, S. 79. Vgl. auch HECKEL, Besetzung, S. 160–164; HÖHLE, Gründung, S. 36.
8 Vgl. dazu PRUSS, Deitmer, S. 36f., wo die staatliche Beteiligung allerdings nicht erwähnt wird. Ebenso bei BANASCH, Delegaturbezirk, S. 90. Erwin Gatz spricht davon, dass Deitmer erstmals ohne Mitwirkung der preußischen Regierung Propst und Delegat geworden sei. Vgl. GATZ, Deitmer, S. 120.
9 Bertram an Pacelli vom 1. Februar 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 1r.
10 Vgl. Pacelli an Gasparri vom 26. Januar 1923, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1922–1932, Pos. 526 P.O., Fasz. 51, Fol. 3rv. Vgl. auch HÖHLE, Gründung, S. 89 Anm. 127.
11 Bertram an Pacelli vom 1. Februar 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 1r.
12 Vgl. zu den pastoralen Nöten der Berliner Delegatur, die insbesondere in der mangelnden kirchlichen Infrastruktur bestanden, ASCHOFF, Berlin; ESCHER, Pfarrgemeinden; HÖHLE, Gründung, S. 42–61.
13 Bertram an Pacelli vom 1. Februar 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 1v.
14 Bertram an Pacelli vom 1. Februar 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 1v.
15 Dieses Anliegen verfolgte Bertram nach eigener Aussage auch als Leitprinzip bei allen früheren Überlegungen zur jurisdiktionellen Zukunft der Berliner Delegatur. Vgl. HÖHLE, Gründung, S. 174.
16 Bertram an Pacelli vom 1. Februar 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 1v.
17 Pacelli an Bornewasser vom 19. Februar 1929 (Entwurf), ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 5r.
18 Vgl. Bornewasser an Pacelli vom 26. Februar 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 6rv.
19 Bornewasser an Pacelli vom 26. Februar 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 6r.
20 Bornewasser an Pacelli vom 26. Februar 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 6v.
21 Bornewasser an Pacelli vom 26. Februar 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 6v.
22 Wenige Tage später sandte Bornewasser ein zweites Schreiben an den Nuntius, das die Bitte äußerte, die eventuelle Ernennung von Kaas (zunächst) zum Weihbischof der Delegatur Berlin und seine Installation möge in einem geraden Monat erfolgen, damit das dadurch am Trierer Dom vakant werdende Kanonikat ohne staatlichen Einfluss besetzt werden könne. Diese freie Besetzung sei deshalb besonders wichtig, weil er mit dem Prälaten seinen „unersätzlichen Canonisten“ verlöre und der Nachfolger so gewählt werden müsse, dass er ihn „wenigstens in etwa … ersetzen könne“. Bornewasser an Pacelli vom 2. März 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 10r–11v, hier 10v. Hervorhebung im Original. Der Nuntius sagte ihm zu, die Trierer Verhältnisse zu berücksichtigen, sollte die Entscheidung auf Kaas fallen. Vgl. Pacelli an Bornewasser vom 11. März 1929 (Entwurf), ebd., Fol. 12r.
23 Pacelli an Schreiber vom 28. Februar 1929 (Entwurf), ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 7r.
24 Vgl. Schreiber an Pacelli vom 2. März 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 8r–9r.
25 Schreiber an Pacelli vom 2. März 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 8v.
26 Schreiber an Pacelli vom 2. März 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 8v.
27 Schreiber an Pacelli vom 2. März 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 8v.
28 Vgl. Votum Gehrmanns für Pacelli vom 14. März 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 19r–20v.
29 „… la assai difficile questione della di lui successione in questa Capitale.“ Pacelli an Gasparri vom 16. März 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 4r–6v, hier 4r.
30 Pacelli hielt Bertrams Ausführungen für so wichtig, dass er sie in italienischer Übersetzung seinem Bericht beifügte. Vgl. Bertram an Pacelli vom 1. Februar 1929 (ital. Übersetzung), S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 7r–8r.
31 Pacelli vergewisserte sich über die maßgebliche Bestimmung der Konvention und wie man sie bewerten müsse bei HECKEL, Besetzung, bes. S. 160–164.
32 Wie oben bereits gesehen (Bd. 2, Kap. II.1.7 Anm. 7) hieß es in dem Statut, dass die Verständigung zwischen dem Breslauer Fürstbischof und dem preußischen Kultusminister „unbeschadet des landesherrlichen Patronatsrechts über die St. Hedwigskirche“ stattfinden sollte. DAUMERT, Statut, S. 79.
33 Tatsächlich wurde aus der Vereinbarung anschließend von staatlicher Seite „das Recht abgeleitet, in dem revidierten Statut dem Staat ausdrücklich das Patronatsrecht über St. Hedwig vorzubehalten“, sodass laut Heckel „trotz der scheinbaren Einigung von 1854 doch noch der alte Gegensatz zwischen kirchlicher und staatlicher Auffassung in aller Schärfe“ fortbestand. HECKEL, Besetzung, S. 162f., hier 163.
34 Vgl. zum Institut des Apostolischen Protonotars participans beziehungsweise wie in diesem Fall non participans MICKE, Protonotare, bes. S. 227–233.
35 Vgl. Can. 1435 § 1 N. 1: „§1. Praeter omnia beneficia consistorialia et omnes dignitates ecclesiarum cathedralium et collegiatarum ad normam can. 396, §1, sunt reservata Sedi Apostolicae, quanquam vacanti, sola beneficia quae infra memorantur: 1° Omnia beneficia, etiam curata, quae vacaverint per obitum, promotionem, renuntiationem vel translationem S. R. E. Cardinalium, Legatorum Romani Pontificis, officialium maiorum Sacrarum Congregationum, Tribunalium et Officiorum Romanae Curiae et Familiarium, etiam honoris tantum, Summi Pontificis tempore vacationis beneficii.“ Vgl. auch MÖRSDORF, Lehrbuch II, S. 432f.; SIPOS, verba „tempore vacationis beneficii“.
36 Zugunsten der Festigung dieses Ansinnens las der Nuntius gewiss gerne die Ausführungen Johannes Heckels, dass die Breslauer Fürstbischöfe im Delegaturbezirk „nicht etwa proprio iure als Breslauer Bischöfe [handelten und handeln], sondern auctoritate apostolica, nämlich kraft eines ihnen ein für allemal in der Bulle [sc. De salute animarum, R.H.] gesetzlich erteilten Amtsauftrags. Demzufolge hatten und haben sie zwar in der Delegatur die Gewalt eines Bischofs, aber sie waren und sind nicht Bischöfe dieses Gebiets, sondern Stellvertreter des zuständigen Oberhirten, nämlich des Papstes. … Obgleich sie in weiterem Sinne und in ungenauer Ausdrucksweise häufig zur Diözese Breslau gerechnet wird, ist sie doch in Wirklichkeit durch die Bulle ein päpstlicher Verwaltungsbezirk eigener Art geworden und ist das bis heute geblieben.“ HECKEL, Besetzung, S. 147–149.
37 „… il candidato da eleggersi dovrà essere pure atto quale futuro Vescovo di Berlino.“ Pacelli an Gasparri vom 16. März 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 5r.
38 „… certamente di importanza essenziale …“ Pacelli an Gasparri vom 16. März 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 5r.
39 „… qualche finezza di modi …“ Pacelli an Gasparri vom 16. März 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 5r.
40 Vgl. Bd. 1, Kap. II.1.4 (Das Einlenken Roms und Pacellis Kandidat Maximilian Kaller).
41 „Infatto, come pur troppo dimostra l’esperienza, la istruzione ed educazione, che gli aspiranti al sacerdozio ricevono presso la Facoltà teologica ed il Convitto di Breslavia, è sotto vari aspetti assai difettosa; sembra quindi indispensabile che, una volta seperato il territorio del Brandenburgo e della Pomerania, il nuovo Presule procuri di inviare gli studenti di sacra teologia principalmente al Collegio Germanico-Ungarico in Roma od all’Istituto filosofico-teologico di Francoforte, od anche, se si vuole, in parte in qualche Seminario vescovili (ad es. a Treviri od a Fulda), che dia maggiori garanzie a tale riguardo.“ Pacelli an Gasparri vom 16. März 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 5r.
42 „… di qualità mediocri …“ Pacelli an Gasparri vom 16. März 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 5v.
43 Diese „schwere Ersetzbarkeit“ hinderte Pacelli freilich nicht daran, Kaller wenig später auf den ersten Platz der römischen Terna für die Bischofswahl des Ermländer Domkapitels zu setzen. Vgl. dazu Bd. 2, Kap. II.1.9 (Die römische Terna).
44 „… egli possiede assai notevoli doti di attività, di abilità e di esperienza anche per ciò che concerne Berlino.“ Pacelli an Gasparri vom 16. März 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 5v.
45 Vgl. Bd. 1, Kap. II.1.3 (Der Kandidat von Ludwig Kaas: Nikolaus Bares).
46 „… su questo punto fondamentale …“ Pacelli an Gasparri vom 16. März 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 6r.
47 In seiner Schlussrelation führte der Nuntius diese Kritik näher aus, indem er monierte, dass „einige Professoren“ – damit meinte er unter anderem den Lehrstuhlinhaber für Philosophie und Ermländer Domkapitular Wladislaus Switalski – „falsche oder zumindest missverständliche Meinungen“ verträten, während der Diözesanbischof, Augustinus Bludau, diesen Missständen nur tatenlos zusehe. Pacelli an Perosi vom 18. November 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1927–1931, Pos. 511 P.O., Fasz. 24, Fol. 42v, Übersetzung zitiert nach WOLF/UNTERBURGER (Bearb.), Lage, S. 233. Vgl. dazu auch Bd. 2, Kap. II.1.9 Anm. 345.
48 „Qualche dubbio lascia anche il carattere di questo candidato, che si dice di natura alquanto imperiosa, e che quindi non sembra godere speciali simpatie nel clero.“ Pacelli an Gasparri vom 16. März 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 6r.
49 „Ma, tutto sommato, parmi che egli possa essere riguardato come un soggetto idoneo.“ Pacelli an Gasparri vom 16. März 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 6r.
50 Zwar fügte Pacelli das Votum Bornewassers zur Illustration bei, doch hatte dieser so gut wie keine biographischen Angaben zum Zentrumsprälaten gemacht. Deshalb verwies der Nuntius Gasparri auf den Lebenslauf, den er Ende 1920 nach Rom gesandt hatte, damals mit der Bitte verbunden, Kaas zum Päpstlichen Hausprälaten zu ernennen. Die wesentlichen Stationen dieser von Pacelli selbst verfassten Vita waren: Kaas sei 1881 geboren, mit 19 Jahren zum philosophisch-theologischen Studium in das Trierer Priesterseminar eingetreten. Bereits ein Jahr später sei er nach Rom übergesiedelt, um als Alumne des Kollegium Germanicum an der päpstlichen Gregoriana das Laureat in der Philosophie und Theologie zu erwerben. 1906 habe er die Priesterweihe empfangen. Dem Rat des Rektors des Germanicums gehorchend (obtemperans) und mit Einverständnis Bischof Korums sei Kaas noch ein weiteres Jahr in Rom geblieben, vor allem um kanonisches Recht zu studieren und als Kaplan der Anima zu wirken. Die Leistungen auf kirchenrechtlichem Gebiet hob Pacelli eingehend hervor: „Mense Junii huius anni [sc. 1909, R.H.] R. D. Kaas a professoribus Facultatis iuris canonici electus est, ut in publica disputatione, tunc temporis in Universitate Gregoriana iterum introducta, theses doctorales defenderet. Quo examine publice superato iuris canonici doctor ‚summa cum laude‘ creatus est.“ Wieder zurück im Bistum Trier habe Kaas verschiedene Tätigkeiten ausgeführt: in der Seelsorge, als Rektor des Waisenhauses in Kemperhof bei Koblenz und als Rektor der dortigen Höheren Schule, wo er durch acht Jahre hindurch von kirchlicher wie staatlicher Seite höchstes Lob geerntet habe. Daneben habe Kaas – wieder mit Zustimmung seines Ordinarius, wie Pacelli nicht zu erwähnen vergaß – seine Studien des kanonischen sowie des bürgerlichen Rechts in Bonn fortgesetzt und ein ausgezeichnetes Werk über „Die geistliche Gerichtsbarkeit der katholischen Kirche in Preußen“ geschrieben. 1918 habe ihm Korum die neu errichtete Professur für kanonisches Recht am Trierer Priesterseminar übergeben. Im nächsten Jahr habe Kaas einen Ruf der Universität Bonn abgelehnt und zwar – so stellte es Pacelli dar – dem Urteil seines Ordinarius gehorchend (obtemperans), der ihn in Trier habe behalten wollen. In der Folgezeit seien noch weitere Ämter und Ehrungen dazugekommen, so die Ernennung zum Geistlichen Rat und zum Kirchenanwalt. Im September 1918 habe er schließlich sehr erfolgreich die Trierer Diözesansynode vorbereitet und an ihr auch lenkend teilgenommen. 1919 sei Kaas mit Einverständnis Korums (consentiente et libenter annuente) als Abgeordneter der Zentrumspartei in die Verfassunggebende Nationalversammlung und im nächsten Jahr in den Reichstag gewählt worden. Vgl. Pacelli an Gasparri vom 5. Dezember 1920, ASV, Segr. Stato, Anno 1921, Rubr. 255, Fasz. 1, Fol. 16rv; die Biographie ebd., Fol. 17r–18r, hier 17r. Es sticht sofort ins Auge, dass Pacelli dem Trierer Prälaten ein sehr gutes Zeugnis ausstellte, insbesondere dessen Leistungen auf kanonistischem Gebiet hervorhob und stets dessen Gehorsam gegenüber der kirchlichen Hierarchie betonte.
51 „Antico alunno del Collegio Germanico-Ungarico, è uomo di doti superiori ed eccezionali, universalmente stimato, e riunirebbe in sé tutti i requisiti necessari per un Vescovo residente nella capitale del Reich.“ Pacelli an Gasparri vom 16. März 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 6r-v.
52 Nach dem schwachen Ergebnis für die Deutsche Zentrumspartei in der Reichstagswahl vom 20. Mai 1928 und dem Rücktritt ihres Vorsitzenden Wilhelm Marx am 6. Oktober desselben Jahres, suchte man nach einer Parteispitze, welche die verschiedenen Richtungen und Flügel der Partei zu neuer Geschlossenheit führen sollte. Aus dieser Motivation heraus wählte man am 8. Dezember 1928 auf dem Kölner Parteitag Kaas zum neuen Vorsitzenden, der das Amt zwar nicht angestrebt hatte, aber einsah, „sich angesichts einer echten Notsituation dem Ersuchen einer Mehrheit der Delegierten nicht versagen zu dürfen“. Vgl. MAY, Kaas 2, S. 612–630, hier 619.
53 „… una scelta veramente buona …“ Pacelli an Gasparri vom 16. März 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 6v.
54 Vgl. die Schriftwechsel zwischen Borgongini Duca und Canali vom 21. respektive 23. März 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 12r und 13r über Piontek, 14r und 15r über Kaller, 16r und 17r über Steinmann sowie 18r und 19r über Kaas.
55 Vgl. Bertram an Pacelli vom 9. April 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 23rv.
56 Cortain an Bertram vom 8. April 1929 (Abschrift), ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 25rv, hier 25v.
57 Vgl. anonymer Katholik an Pacelli vom 9. Mai 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 27r–29r.
58 Anonymer Katholik an Pacelli vom 9. Mai 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 27v. Hervorhebung im Original.
59 Anonymer Katholik an Pacelli vom 9. Mai 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 28r. Hervorhebungen im Original.
60 Vgl. Bertram an Pius XI. vom 24. Mai 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 24r–25r.
61 „Sed quia is, cui nunc delegetur episcopalis administratio districtus Delegaturae, jam mox post Dioecesis Berolinensis constitutionem in Concordato provisam non poterit facile praeteriri in Episcopi novae Dioecesis nominatione, res jam nunc apud S. Sedem pendet.“ Bertram an Pius XI. vom 24. Mai 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 24v.
62 „Urbs Berlin cum Delegaturae districtu poscit manum fortem prudentis pastoris.“ Bertram an Pius XI. vom 24. Mai 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 25r.
63 „De personarum aliquot qualitatibus …“ Bertram an Pius XI. vom 24. Mai 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 25r.
64 „… che non sia da aspettare una urgenza assoluta ma basta il bisogno attuale per provvedere al bene spirituale dei cattolici di Berlino.“ Gasparri an Pacelli vom 2. Juni 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 31r.
65 „… se si potesse trovare una misura interinale da lasciare libera la via alla elezione di Kaas, quando sia prevedibile in un termine abbastanza breve.“ Gasparri an Pacelli vom 2. Juni 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 31r.
66 Vgl. Gasparri an Bertram vom 3. Juni 1929 (Entwurf), S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 27r.
67 Vgl. Bd. 1, Kap. II.1.5 (Der Konkordatsabschluss und die Diskussion über die „Würdigung“ der Vorschlagslisten).
68 Vgl.: „Allo scopo di eseguire nel miglior modo gli ordini ivi [sc. im Telegramm Gasparris vom 2. Juni, R. H.] impartitimi, mi è sembrato innanzi tutto necessario di accertare, se fosse possibile di procedere in un termine abbastanza breve alla nomina del Revmo Mons. Kaas.“ Pacelli an Gasparri vom 18. Juni 1929, S. RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 27bisrv, hier 27bisr.
69 „Antico alunno del Collegio Germanico – Ungarico, di sana dottrina, attacato alla S. Sede, non può dubitarsi che egli offra ogni garanzia nel punto capitale della formazione del clero. È inoltre di vita irreprensibile, assai stimato, colto, energico, attivo e zelante, sebbene faccia qualche volta l’impressione che senta un po’ troppo di sé stesso.“ Pacelli an Gasparri vom 18. Juni 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 27bisv. Abgesehen von der negativen Bemerkung beurteilte Pacelli den Meißener Oberhirten wenige Wochen später in seinem Abschlussbericht mit fast identischem Wortlaut: „È Prelato esemplare, di sana dottrina, attaccato alla S. Sede, assai stimato, colto, energico, attivo e zelante.“ Pacelli an Perosi vom 18. November 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1927–1931, Pos. 511 P.O., Fasz. 24, Fol. 45v, WOLF/UNTERBURGER (Bearb.), Lage, S. 242.
70 Vgl. Gasparri an Pacelli vom 3. Juli 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 33r.
71 Vgl. Pacelli an Gasparri vom 4. Juli 1929 (nicht versandte Ausfertigung), ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 34rv.
72 Vgl.: „È noto a Vostra Eminenza l’interesse, che porta il S. Padre all’ Istituto filosofico-teologico dei RR. PP della Compagnia di Gesù in Francoforte, dal quale si spera – come ve ne è così urgente bisogno – che escano in buon numero ecclesiastici solidamente formati nella sana dottrina.“ Pacelli an Gasparri vom 4. Juli 1929 (nicht versandte Ausfertigung), ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 34r.
73 Schon 1920 berichtete Pacelli dem Präfekten der Studienkongregation, Gaetano Kardinal Bisleti, dass Schreiber die Gründung einer Jesuitenhochschule in Frankfurt ablehnte und stattdessen die Errichtung einer katholischen Universität in Fulda befürwortete. Vgl. UNTERBURGER, Lehramt, S. 358.
74 „… ad un certo punto comprendersi, quantunque gli studi colà siano molto inferiori a quelli che si compiono in Francoforte.“ Pacelli an Gasparri vom 4. Juli 1929 (nicht versandte Ausfertigung), ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 34r.
75 „Ma il Revmo Mons. Schreiber, e ciò pare men comprensibile, sembra che vada anche più oltre, giacché, come ho appreso da fonte sicura, non solo non invia egli stesso i giovani nel sullodato Istituto, ma ha proibito di andarvi ad uno studente, che lo aveva domandato.“ Pacelli an Gasparri vom 4. Juli 1929 (nicht versandte Ausfertigung), ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 34r-v.
76 Die Informationen aus den beiden namentlich nicht näher genannten Quellen waren dem Nuntius wahrscheinlich mündlich zugekommen, jedenfalls finden sich keine schriftlichen Zeugnisse darüber im Nuntiaturarchiv. Man ist versucht, zumindest einen dieser anonymen Informanten mit Kaas zu identifizieren, mit dem Pacelli über die Berliner Besetzungsfrage zwangsläufig im Gespräch war und der daher vermutlich auch von der angedachten Kandidatur Schreibers wusste.
77 Vgl. handschriftliche Bemerkung: „non più inviato in seguito ad ulteriori più favorevoli informazioni – 5.7.29“. Pacelli an Gasparri vom 4. Juli 1929 (nicht versandte Ausfertigung), ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 34r.
78 „È da augurare che Mons. Schreiber, il quale ben conosce i difetti delle Facoltà teologiche, abbia, come Ordinario di Berlino, la forza di allontanare, pur colla necessaria prudenza, pian piano i suoi alunni di teologica dalla Università di Breslavia, avviandoli ad altri Istituti filosofico-teologici di più sicura e solida formazione.“ Pacelli an Perosi vom 18. November 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1927–1931, Pos. 511 P.O., Fasz. 24, Fol. 46v, Übersetzung zitiert nach WOLF/UNTERBURGER (Bearb.), Lage, S. 247. Zu diesem Zeitpunkt konnte Pacelli übrigens bereits die ersten Erfolge vermelden: „Jedenfalls gibt er [sc. Schreiber, R.H.] bereits, wie mir bekannt ist, im Unterschied zum Verhalten Seiner Eminenz Bertram, ohne Schwierigkeiten denen, die sie erbitten, die Erlaubnis, sich an das Collegium Germanicum et Hungaricum in Rom zu begeben.“ Ebd., S. 247.
79 Vgl. Pacelli an Bertram vom 5. Juli 1929 (Entwurf), ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 35r.
80 Bertram an Pacelli vom 6. Juli 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 36r.
81 Pacelli an Schreiber vom 7. Juli 1929 (Entwurf), ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 38r.
82 Das Datum ergibt sich aus einem Telegramm Schreibers an Pacelli vom 10. Juli 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 39r.
83 Vgl. Pacelli an Gasparri vom 21. Juli 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 29r–30r.
84 „… una prova di specialissima fiducia e benevolenza da parte di Sua Santità.“ Pacelli an Gasparri vom 21. Juli 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 29r.
85 Bereits am nächsten Tag kümmerte sich Pacelli um Schreibers Nachfolge in Meißen. Vgl. dazu Bd. 4, Kap II.4.2 (Pacellis Vorausschau: Antonius Hilfrich für den Meißener Bischofsstuhl?).
86 „… di personaggi competenti …“ Pacelli an Gasparri vom 21. Juli 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 29v.
87 Vgl. Art. 6 des Preußenkonkordats von 1929, HUBER/HUBER (Hg.), Staat und Kirche IV, S. 325.
88 „… accordo speciale …“ Pacelli an Gasparri vom 21. Juli 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 29v.
89 Vgl. Gasparri an Pacelli vom 31. Juli 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 42rv.
90 Vgl. Pacelli an Gasparri vom 23. August 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 33rv.
91 „… ma naturalmente, allorchè la cosa passò negli Uffici del Ministero del Culto, i pedanti burocratici cominciarono a sollevare eccezioni sia circa il modus procedendi, come intorno alla persona del candidato.“ Pacelli an Gasparri vom 23. August 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 33r.
92 Aufzeichnung Heyers vom 17. August 1929, zitiert nach HÖHLE, Gründung, S. 205.
93 Aufzeichnung Heyers vom 17. August 1929, zitiert nach HÖHLE, Gründung, S. 205.
94 Vgl. HÖHLE, Gründung, S. 205.
95 Aufzeichnung Heyers vom 17. August 1929, zitiert nach HÖHLE, Gründung, S. 206.
96 Der Artikel 13 sah vor, bei etwaigen Meinungsverschiedenheiten zwischen Staat und Kirche bei der Vertragsauslegung eine freundschaftliche Lösung anzustreben. Vgl. HUBER/HUBER (Hg.), Staat und Kirche IV, S. 237.
97 Aufzeichnung Heyers vom 17. August 1929, zitiert nach HÖHLE, Gründung, S. 206.
98 Vgl. HÖHLE, Gründung, S. 206 Anm. 22.
99 Becker an Braun vom 23. August 1929, zitiert nach HÖHLE, Gründung, S. 206. Vgl. zur Hildesheimer Bischofswahl von 1914/15 HIRSCHFELD, Bischofswahlen, S. 219–224.
100 „… il quale aveva fatto i suoi studi filosofico – teologici in Rom.“ Pacelli an Gasparri vom 23. August 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 33v.
101 „La S. Sede può quindi ora senz’altro nominare ad Amministratore Apostolico del territorio della Delegazione di Berlino il sullodato Vescovo, il quale forse potrebbe conservare provvisoriamente il titolo ed il governo della diocesi di Meißen.“ Pacelli an Gasparri vom 23. August 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 33v.
102 Vgl. Gasparri an Pacelli vom 26. August 1929, ASV, ANB 87, Fasz. 4, Fol. 120r.
103 Vg. Pacelli an Gasparri vom 27. August 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 37r–38r.
104 Vgl. dazu Bd. 1, Kap. II.1.4 Anm. 1117.
105 Die genannten Diözesen waren von den größten Änderungen der Bistumsgrenzen betroffen. Vgl. Art. 2 des Preußenkonkordats, HUBER/HUBER (Hg.), Staat und Kirche IV, S. 323.
106 „… di attendere che tutto sia pronto per una sistemazione sicura e definitiva, provvedendo intanto al governo del territorio della Delegazione di Berlino mediante la proposta nomina di un Amministratore Apostolico.“ Pacelli an Gasparri vom 27. August 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 37v.
107 Vgl. Gasparri an Perosi vom 30. August 1929 (Entwurf), S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1929–1933, Pos. 584 P.O., Fasz. 92, Fol. 39rv; Rossi an Pacelli vom 11. September 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 44r. Der Nuntius bedankte sich bei Rossi am 21. des Monats für die Übersendung des Dekrets (Entwurf), ebd., Fol. 46r.
108 Vgl. zum Administratoramt Bd. 1, Kap. II.1.4 Anm. 1046.
109 Vgl. Berolinensis Administrationis Apostolicae Decretum vom 10. September 1929 (Abschrift), ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 45r; abgedruckt in: Amtsblatt des Bischöflichen Ordinariats Berlin Nr. 1 vom 23. Oktober 1929.
110 Vgl. Pacelli an Schreiber vom 22. September 1929 (Entwurf), ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 49r.
111 Vgl. Pacelli an Bertram vom 23. September 1929 (Entwurf), ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 50r. Vgl. auch HÖHLE, Gründung, S. 207 Anm. 25.
112 Vgl. Pacelli an Braun vom 24. September 1929 (Entwurf), ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 51r.
113 So hieß es darin beispielsweise: „Zwar haben nach der Reichsverfassung die Kirchen ihre Angelegenheiten selbständig zu ordnen, so daß die Kurie ohne Befragung des Staates das Bistum Berlin hätte errichten können, doch liegt in dem Abschluß des Konkordates und in dem Zugeständnis der Mitwirkung bei Besetzung der Bischofsstühle neben diplomatischer Klugheit auch ein gewisser Akt der Courtoisie für das umgestellte Staatswesen. Das dem früheren Landesherrn zugestandene Mitwirkungsrecht bei Bischofswahlen war allerdings stärker und wurde kirchlicher Bestimmung zuwider mitunter derart ausgeübt, daß eine wirkliche Bischofswahl eigentlich nicht stattfand, sondern nahezu eine königliche Ernennung, die nicht immer seelsorglichen und geistlichen Interessen entsprach. In eingeweihten Kreisen laufen über wilhelminische Bischofswahlen böse Worte herum.“ LANGER, Felix, „Bistum Berlin. Erster Bischof: Dr. Schreiber, Bischof von Meißen“, in: „Berliner Morgenpost“ Nr. 198 vom 20. August 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 48r.
114 Der Verfasser sandte dem Nuntius den Artikel einen Monat später zu, als die Personalentscheidung im Begriff war, allgemein publik zu werden. Vgl. Langer an Pacelli vom 21. September 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 47r. Wie der Kontakt zu Pacelli zustande kam, wird aus den vatikanischen Unterlagen nicht ersichtlich. Langer erwähnte in seiner Korrespondenz ein weiteres Schreiben, von dem unklar ist, ob es eventuell von Pacelli stammte. Denkbar, aber eher unwahrscheinlich wäre, dass der Nuntius den Artikel lancierte, um die Bistumsgründung in das für ihn rechte Licht zu stellen. Ob er freilich den Namen Schreibers dabei herausgegeben hätte, wo die staatliche Zustimmung zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht feststand, ist mehr als fraglich. Prinzipiell mochte es Pacelli nicht, wenn vor dem Abschluss von Vereinbarungen Informationen in die Öffentlichkeit sickerten. Wie die „Berliner Morgenpost“ also letztlich an den Namen Schreibers gelangte und ob womöglich die staatliche Seite dafür verantwortlich war, muss offen bleiben.
115 Vgl. „Der erste Bischof von Berlin. Bischof Dr. Christian Schreiber-Meißen zum Apostolischen Administrator ernannt“, in: „Germania“ Nr. 445 vom 24. September 1929 und „Der Bischof von Berlin. Bischof Dr. Schreiber als Administrator“, in: „Schlesische Volkszeitung“ vom 25. September 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 52r und 54r.
116 Schreiber an Pacelli vom 28. September 1929, ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 57r–58r, hier 57v.
117 Vgl. dazu MÖRSDORF, Lehrbuch I, S. 170f.
118 Vgl. Pacelli an Rossi vom 2. Oktober 1929 (Entwurf), ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 60r; Rossi an Pacelli vom 7. Oktober 1929, ebd., Fol. 61r; Pacelli an Schreiber vom 12. Oktober 1929 (Entwurf), ebd., Fol. 62r; Pacelli an Rossi vom 12. Oktober 1929 (Entwurf), ebd., Fol. 63r; Schreiber an Pacelli vom 5. November 1929, ebd., Fol. 65r.
119 Vgl. Pacelli an Schreiber vom 1. Oktober 1929 (Entwurf), ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 59rv.
120 Schreiber an Becker vom 14. Oktober 1929 (Abschrift), ASV, ANB 49, Fasz. 1, Fol. 64r. Vgl. auch HÖHLE, Gründung, S. 207. Am 19. November stattete er dem Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, dem Reichskanzler Hermann Müller sowie dem preußischen Ministerpräsidenten Braun einen Antrittsbesuch ab. Vgl. STREHLER, Schreiber, S. 70f.
121 Hirtenbrief Schreibers vom 15. Oktober 1929, abgedruckt in: Amtsblatt des Bischöflichen Ordinariats Berlin Nr. 1 vom 23. Oktober 1929.
122 HÖHLE, Gründung, S. 207.
123 Vgl. Konstitution Pastoralis officii nostri vom 13. August 1930, in: AAS 23 (1931), S. 34–41; deutsche Übersetzung bei HUBER/HUBER (Hg.), Staat und Kirche IV, S. 339–345 (Nr. 188).
124 Die Ernennungsbullen datieren wie die Apostolische Konstitution auf den 13. August. Vgl. AAS 22 (1930), S. 393; Amtsblatt des Bischöflichen Ordinariats Berlin Nr. 11 vom 13. September 1930. Im Amtsblatt wurde nicht nur die an Schreiber persönlich, sondern auch die an die Berliner Diözesanen gerichtete Ernennungsbulle publiziert. Beide sind auch abgedruckt bei BANASCH, Delegaturbezirk, S. 107f. Gleichzeitig erhielt Schreiber das Ernennungsdekret zum Apostolischen Administrator ad nutum Sanctae Sedis für die Diözese Meißen und auf seine Bitte wenig später noch die üblichen Quinquennalfakultäten. Vgl. Orsenigo an Pacelli vom 30. August 1930, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1927–1931, Pos. 573 P.O., Fasz. 85, Fol. 34rv; Pacelli an Orsenigo vom 3. September 1930 (Entwurf), ebd., Fol. 36r.
125 Vgl. „Mitteilung betr. Inthronisation Sr. Bischöflichen Gnaden“, in: Amtsblatt des Bischöflichen Ordinariats Berlin Nr. 11 vom 13. September 1930.
126 Vgl. STREHLER, Schreiber, S. 72.
127 Vgl. Bd. 4, Kap. II.4.2 (Pacellis neuer Kandidat: die Ernennung Conrad Gröbers zum Bischof von Meißen).
128 Für Pacelli war also nicht entscheidend – wie Adolf Strehler durchaus verständlicherweise anzunehmen schien –, dass Schreiber durch seine administrativen Erfahrungen, die er „beim Aufbau des neuen Meißener Bistums gesammelt hatte“, besonders qualifiziert war, um sie nun wiederum „für die Grundlegung eines Bistums, diesmal in der Reichshauptstadt, einzusetzen“. STREHLER, Schreiber, S. 69.
129 Damit ist die Vermutung von Georg May über den Bischofskandidaten Kaas zumindest hinsichtlich der Besetzung des Bistums Berlin 1930 widerlegt: „Nichts spricht dafür, daß die Beteiligten, also in erster Linie Pacelli, Orsenigo und Papst Pius XI., Kaas als Kandidaten in Erwägung gezogen hätten.“ MAY, Kaas 3, S. 453–459, hier 459. May widerspricht den Darstellungen von Arthur Wynen, der von Kaas die Aussage berichtet, er habe mehrfach Bischofsstühle ausgeschlagen, und Karin Schauff, die eine Kandidatur des Prälaten für die Berliner Cathedra erwähnt. Vgl. WYNEN, Kaas, S. 15; SCHAUFF, Erinnerung, S. 19.
130 „Nel governo della diocesi di Meißen, territorio di diaspora, egli ha spiegato grande operosità. I candidati al sacerdozio, i quali prima erano formati in Praga, ora compiono i primi quattro anni di studi filosofici e teologici in Fulda (alcuni anche in Innsbruck o nel Collegio Germanico-Ungarico in Roma) e gli ultimi due anni nel Seminario clericale (Priesterseminar)eretto da Mons. Schreiber in Schmochtitz presso Bautzen.“ Pacelli an Perosi vom 18. November 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1927–1931, Pos. 511 P.O., Fasz. 24, Fol. 45v. Hervorhebung im Original. Übersetzung zitiert nach WOLF/UNTERBURGER (Bearb.), Lage, S. 243.
131 Aufschlussreich ist, dass Pacelli in seiner Finalrelation beim von Bertram als potentiellen Kandidaten für Berlin vorgeschlagenen Tützer Administrator Kaller in ähnlicher Weise lobend hervorhob, dass dieser viele seiner Alumnen zum Studium nach St. Georgen schicke. Vgl. Pacelli an Perosi vom 18. November 1929, S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1927–1931, Pos. 511 P.O., Fasz. 24, Fol. 49r-v, WOLF/UNTERBURGER (Bearb.), Lage, S. 254f. Dennoch kam Kaller für den Nuntius als Bischofskandidat der Reichshauptstadt nicht in Frage, obwohl er relativ sicher sein konnte, dass der Genannte als Oberhirte von Berlin diese Praxis beibehalten würde. Stattdessen urteilte Pacelli gegenüber Gasparri, dass Kaller dieser Aufgabe nicht gewachsen sei.
132 Eingeschlossen ist der anonym schreibende Katholik, der den Geistlichen Rat Beyer als Kandidaten für das Amt ins Spiel brachte, jedoch bei Pacelli auf taube Ohren stieß.
133 Vermutlich war er bereits bei der Tützer Besetzung 1925/26 involviert gewesen. Pacelli befragte ihn außerdem bei der Besetzung der Schneidemühler Prälatur 1930/31.
134 Zumal sich der Jesuitenpater im Kontext der causa Schneidemühl wiederum über Interna des hiesigen Berliner Falls informiert zeigte. Vgl. Bd. 2, Kap. II.1.10 (Pacellis Kandidatenerkundigungen und die Kandidatur Paul Webers).
135 Vgl. HÖHLE, Gründung, S. 205 Anm. 18.
136 Vgl. dazu Bd. 1, Kap. II.1.5 (Die Wiederaufnahme der Konkordatsverhandlungen 1926 und Pacellis Dilemma beim Besetzungsmodus der Bischofsstühle).
137 Vgl. dazu Bd. 1, Kap. II.1.4 (Ergebnis Nr. 4).