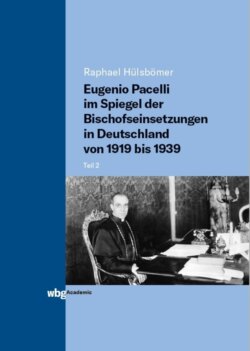Читать книгу Eugenio Pacelli im Spiegel der Bischofseinsetzungen in Deutschland von 1919 bis 1939 - Raphael Hülsbömer - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Initiative Kardinal Bertrams
ОглавлениеDie Nachfolgefrage Deitmers stellte sich daher unter der Prämisse, dass sich der rechtliche Status der Delegatur durch das in absehbarer Zeit abgeschlossene Konkordat entscheidend verändern würde. Deshalb wandte sich Bertram am 1. Februar an Pacelli, um seine Ansichten in dieser Sache vorzutragen.5 Er erklärte, dass bislang die Ernennung des Propstes von St. Hedwig und damit des fürstbischöflichen Delegaten entsprechend der Konvention zwischen dem Breslauer fürstbischöflichen Ordinariat und dem preußischen Kultusministerium von 1854 erfolgt sei: nämlich durch eine freie Amtsübertragung durch den Breslauer Fürstbischof („beneficium liberae collationis“6) nach vorhergehender Verständigung mit dem Kultusminister.7 Auf diese Weise hatte Bertram nach eigenen Angaben auch Deitmer 1920 nach einer Rückversicherung bei der preußischen Regierung, dass keine Einwände gegen ihn bestanden, ernannt.8 Bertram glaubte, dass mittlerweile jedoch eine „erhebliche Änderung in den Verhältnissen“9 stattgefunden habe, insofern nämlich Deitmer am 19. Februar 1923 auf sein Bitten von Pius XI. zum Weihbischof erhoben worden sei. Pacelli hatte das Anliegen damals unterstützt.10 Mit dieser Statusaufwertung – so folgerte Bertram – habe der Heilige Stuhl signalisiert, das Amt des Delegaten dauerhaft mit der episkopalen Würde verbinden zu wollen. Daraus sowie aus den bevorstehenden Veränderungen innerhalb der preußischen Diözesanordnung leitete Bertram ab, bei der Wiederbesetzung des vakanten Delegatenamtes nicht in derselben Weise wie bei der Ernennung Deitmers vorgehen zu können. Deshalb nahm er an, „dass Eure Exzellenz die einschlägige Verhandlung de modo designandi successorem mit dem Heiligen Stuhle selbst zu führen für gut halten, falls nicht andere Mitteilung mir zugeht“11.
Die Kandidatenfrage hielt Bertram für schwierig, weil man sie behandeln müsse wie die Bestellung des künftigen Berliner Diözesanbischofs. Indem er aber auf eine 14-jährige Vertrautheit mit den Erfordernissen von Klerus und Volk in Berlin sowie der Delegatur pochte, wies er sich als qualifiziert aus, um sich dazu äußern zu können.12 Seiner Ansicht nach seien insbesondere „die von den Behörden gemäß der Eigenart der Anschauungen der Beamtenwelt so oft überschätzten repräsentativen Vorzüge, so schön die denselben entspringende Dekoration ist, doch nur von sekundärer Bedeutung“13. Der Bischof sollte es also all den Äußerlichkeiten und Inszenierungen der deutschen Reichs- und preußischen Landeshauptstadt mit ihren Regierungsinstitutionen und ihrem Beamtentum nicht gleichtun. Vielmehr wünschte sich Bertram einen Oberhirten von tief innerlicher und aszetischer Prägung, „von gewinnender Herzlichkeit“14, der keine anderen Anliegen als die salus animarum der ihm anvertrauten Herde im Sinn habe.15 Mit dieser dezidiert unpolitischen Ausrichtung müsse sich eine tatkräftige und kluge Leitung der vielen neuen diözesanen Einrichtungen verbinden. Auch die antikirchlichen Kräfte würden einem solchen Charakter Achtung entgegenbringen. Immunität gegen den weltlichen Glanz der Reichshauptstadt, inmitten „den religiös und sittlich zerfahrenen Verhältnissen des Geisteslebens in Berlin“16, und Organisationsgeschick für den Aufbau des neuen Bistums waren also die Kriterien, auf die es Bertram vornehmlich ankam. Für den Fall, dass man einen Priester ernennen wollte, der in der Diasporasituation der Delegatur und der Diözesanverwaltung samt Bonifatiusverein bewährt sei, dachte der Kardinal zuerst an den Breslauer Domkapitular Ferdinand Piontek. Der zweite Geistliche, den er vorschlug, war der fürstbischöfliche Kommissar und Propst in Stettin, Paul Steinmann, obwohl man bei ihm Opportunitätsvorbehalte haben könne, die Bertram nicht näher erläuterte. Als dritten geeigneten Geistlichen nannte er den Tützer Administrator Maximilian Kaller, wobei es eigentlich zu wünschen sei, dass dieser nicht so früh von seiner aktuellen Aufgabe – der Administrator Tütz beziehungsweise Schneidemühl stand er seit 1926 vor – abgezogen werde.
Alle drei Genannten spielten bereits bei der erwähnten Tützer Besetzung eine Rolle. Insbesondere von Piontek und Kaller war damals die Rede gewesen, deren Kandidatur Bertram jedoch mit der Begründung abgelehnt hatte, dass sie für den Bonifatiusverein und für die Berliner Delegatur unentbehrlich seien. Nun ging es aber nicht mehr um die – weniger bedeutende – ostdeutsche Administratur, sondern um Berlin selbst, das als neues Reichshauptstadtbistum im Begriff war, für die deutsche Kirche zentral zu werden. Damit waren die beiden Geistlichen in den Augen des Breslauer Oberhirten für den neuen Bischofsstuhl gewissermaßen prädestiniert, wobei er sich wohl durch seine Beziehung zu jedem der Vorgeschlagenen (inklusive Steinmann) einen zumindest mittelbaren Einfluss auf die Regierung der neuen Diözese gesichert hätte. Alle stammten aus seinem Diözesanklerus. Bertram war sich seiner lokalen Personenwahl durchaus bewusst und überließ daher eine etwaige gesamtdeutsche Perspektive dem Nuntius. In der Liste des Kardinals fehlte der Delegaturrat Eduard Cortain, der von Bertram mit der interimistischen Verwaltung der Delegatur betraut worden war: Für eine dauerhafte Bewältigung der Aufgabe verfügte er nach Ansicht des Breslauer Oberhirten nicht mehr über die nötigen physischen Kräfte.