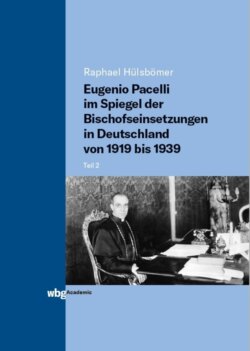Читать книгу Eugenio Pacelli im Spiegel der Bischofseinsetzungen in Deutschland von 1919 bis 1939 - Raphael Hülsbömer - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die offizielle Supplik Kilians um einen Koadjutor, das Plazet der Regierung und die Einsetzung Hilfrichs
ОглавлениеDie positive Antwort aus Rom folgte prompt, aber nicht an Hilfrich, sondern an Kilian. Denn ein wesentlicher Bestandteil des Plans war noch nicht umgesetzt worden: Es fehlte noch das offizielle Bittschreiben des Limburger Bischofs an den Papst. Den wesentlichen Inhalt dieser Supplik gab Pacelli am 18. Februar vor:
„Es wäre dann aber notwendig, dass Eure Bischöfliche Gnaden wie von sich aus und ohne jede Erwähnung des bisher in der Angelegenheit geschehenen Briefwechsels in offizieller Form eine Bittschrift an den Heiligen Vater richteten des Inhalts, Seine Heiligkeit möge Ihnen mit Rücksicht auf Ihren Gesundheitszustand einen Coadiutor cum iure successionis geben.“207
Außerdem sollte Kilian darauf eingehen, dass Limburg keinen Weihbischof benötige, dass Stadtpfarrer Hilfrich die persona idonea für das Amt darstelle – eine Woche zuvor hatte ihn auch das Heilige Offizium abgesegnet208 – und der Heilige Vater diesem gewähren möge, sein derzeitiges Pfarrbenefizium für den Unterhalt zu behalten. Wortgetreu kam Kilian dieser Anweisung am 25. Februar nach.209 Nun bedurfte es nach der Vorschrift des preußischen Konkordats der Anfrage an die Regierung, ob diese politische Bedenken gegen den Genannten geltend machen wollte. Zu diesem Zweck leitete Pacelli das offizielle Bittgesuch Kilians an den Geschäftsträger der Berliner Nuntiatur, Luigi Centoz, weiter.210 Dabei gab er noch weitere Instruktionen für die Anfrage bei der Regierung mit auf den Weg, denn als Fachmann für das Konkordat sah er mögliche Widerstände vorher. Ein solcher konnte sich seiner Meinung nach aus Artikel 2 ergeben: Dieser bestimmte, dass ein differenter Residenzort von Diözesan- und Weihbischof erst nach Abstimmung mit der Regierung festgelegt werden durfte.211 Nun war es aber ein konstitutives Element der Limburger Regelung, dass Hilfrich zumindest vorläufig nicht in Limburg, sondern in Wiesbaden bleiben sollte. Für den Fall, dass die preußischen Staatsbeamten sich auf den angesprochenen Passus berufen sollten, hatte Pacelli zwei Gegenargumente parat: Zum einen handle es sich nur um ein Provisorium, zum anderen spreche der Vertragstext ausdrücklich von Weihbischof und nicht von Koadjutor. Der Artikel 7, der die politische Klausel bei der Ernennung von Koadjutoren ins Recht setzte, beinhalte hingegen keine Residenzbestimmung.
Mit diesem theoretischen Rüstzeug sprach Centoz – der neue Nuntius, Cesare Orsenigo, war noch nicht im Amt – im preußischen Kultusministerium vor. „Nach mehrmaligem Drängen“212 habe ihm der seit wenigen Wochen als Kultusminister amtierende Adolf Grimme schließlich erklärt, dass keine politischen Bedenken gegen Hilfrich bestünden, wie der Geschäftsträger am 29. März telegraphisch nach Rom meldete. Was er mit diesem Drängen meinte, schilderte er in einem ausführlichen Bericht vom gleichen Tag.213 Zunächst sei alles reibungslos verlaufen, denn nachdem er Grimme von der Bitte Kilians, der Zustimmung des Papstes und der temporären Wohnung Hilfrichs in Wiesbaden berichtet habe, habe der „überaus freundliche Herr Minister“214 erklärt, dass er keine Schwierigkeiten dabei sehe und bald die definitive Antwort geben werde. Diese sei aber ausgeblieben. Erst nach wiederholter Bitte beim katholischen Staatssekretär Aloys Lammers aus dem Kultusministerium, die erwartete Entscheidung zu beschleunigen, habe er – so Centoz – erfahren, dass man das kirchliche Ansinnen an den zuständigen Oberpräsidenten in Kassel, den Sozialdemokraten August Haas, weitergereicht habe und auf dessen Replik warte. Lammers habe angemerkt, dass kein Zweifel an der Zustimmung zur Person Hilfrichs von Seiten der Regierung bestehe. Dennoch habe das Schweigen angedauert, sodass sich Centoz erneut zum Staatssekretär begeben und durch hartnäckiges Drängen erreicht habe, dass man den Oberpräsidenten telefonisch kontaktierte. Was die Verzögerung verursacht hatte, war freilich nicht bis zum Nuntiaturbeamten durchgedrungen. Am Morgen des 29. März habe er schließlich das Plazet erhalten, was ihm sicher gerade recht kam, weil Pacelli am Tag zuvor auf eine baldige Mitteilung gedrängt hatte.215 Der Kardinalstaatssekretär bedachte Centoz daraufhin mit einem Kompliment für die Ausdauer, die dieser in der Sache an den Tag gelegt habe.216 Diese zeigte sich auch darin, dass der Geschäftsträger der Verzögerung – die eigentlich keine wirkliche Verzögerung war, denn nach nicht einmal eineinhalb Wochen nach dem Besuch Centoz’ bei Grimme traf die ersehnte Regierungsentscheidung ein – noch auf den Grund ging, obgleich das Nihil obstat schon erteilt war. So erfuhr Centoz nach eigenen Angaben am 9. April vom Privatsekretär des bisherigen Nuntius, Pater Gehrmann, dem es wiederum Lammers anvertraut hatte, dass Hilfrich für die Regierung nicht nur eine persona grata, sondern eine persona gratissima darstellte.217 Die Frage der Residenzstadt des neuen Koadjutors sei hingegen im Kultusministerium überhaupt nicht thematisiert worden. Pacellis Befürchtungen waren also grundlos gewesen, wie er mit Freude zur Kenntnis nahm.218
Mit dem Einverständnis der Regierung war die letzte Hürde genommen. Der Rest war formaler Natur: die Mitteilung Pacellis an Kilian, dass der Papst seiner Bitte um die Nomination Hilfrichs zum Koadjutor am 31. März entsprochen habe,219 die Publikation der Ernennung im „Osservatore Romano“220 und die Anfertigung der Ernennungsdokumente durch die Konsistorialkongregation.221 Freilich war man hier über die genauen Umstände der Ernennung in völliger Unkenntnis geblieben. Daher bat Assessor Rossi Pizzardo, mittlerweile Sekretär der AES, um Rat, ob die Formel: „praevia adprobatione et confirmatione electionis seu postulationis a Capitulo et Canonicis peractae“, in die Ernennungsbulle für Hilfrich eingefügt werden müsse, wie es 1913 bei der Erhebung Kilians der Fall gewesen sei,222 oder ob man die Wendung verwenden müsse, die man 1920 bei der Nomination Schultes zum Erzbischof von Köln benutzt habe.223 Rossi wusste also weder, dass die Rechtslage in Preußen durch das Konkordat grundlegend geändert war, noch dass das Domkapitel auf die Ernennung eines Koadjutors keinerlei Einfluss hatte und die Formel in diesem Kontext daher schlicht falsch war. Daher klärte ihn Pizzardo über die Rechtslage auf und gab den Hinweis, dass weder das Domkapitel noch die Regierung in der Bulle erwähnt zu werden bräuchten, dem Rossi dann auch Folge leistete.224 Der Veröffentlichung der Ernennungsbulle im Limburger Amtsblatt am 13. Mai stellte Kilian einen kurzen Hinweis auf seine angeschlagene Gesundheit als Begründung für die Installation des Koadjutors voran.225 Die Bischofsweihe empfing Hilfrich am 5. Juni in der Bonifatiuskirche in Wiesbaden aus der Hand Kilians.226 Seine Zeit als Koadjutor währte aber nur wenige Monate. Alle Genesungshoffnungen, die Kilian zum Ausdruck gebracht hatte, wurden enttäuscht, als er am 30. Oktober desselben Jahres verstarb.227 In diesem Augenblick trat Hilfrich die Regierung der Diözese an.228 Feierlich inthronisiert wurde er schließlich am 8. Dezember.229