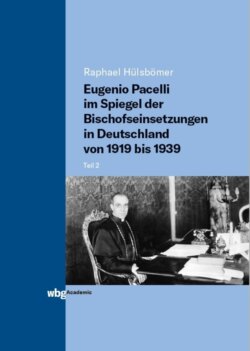Читать книгу Eugenio Pacelli im Spiegel der Bischofseinsetzungen in Deutschland von 1919 bis 1939 - Raphael Hülsbömer - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Pacellis Überlegungen zur Wiederbesetzung der Berliner Delegatur
ОглавлениеSeit dem Tod Deitmers waren genau zwei Monate vergangen. Am 16. März unterrichtete Pacelli Kardinalstaatssekretär Gasparri über den Tod des Delegaten, der „die sehr schwierige Frage seiner Nachfolge in der Hauptstadt“29 aufgeworfen habe. Pacelli berichtete von der Anfrage des Breslauer Fürstbischofs und der Doppel-Natur des freigewordenen Amtes, wie Bertram sie beschrieben hatte.30 Zunächst erläuterte er seinem Vorgesetzten die Rechtsnatur des ersten Amtes, der Propstei von St. Hedwig: Die Konvention von 1854 zwischen der Breslauer Kurie und der preußischen Regierung habe bestimmt, dass die Ernennung des Propstes nach vorheriger Verständigung zwischen dem Fürstbischof von Breslau und dem Kultusministerium vorgenommen werde. Bei dieser Regelung habe es sich um einen Kompromiss gehandelt, um die strittige Frage des staatlichen Patronatsrechts zu lösen.31 Der Staat habe dabei allerdings seine hohen Forderungen erfolgreich aufrecht erhalten, weil man in den „Statuten der katholischen Pfarrei St. Hedwig in Berlin“ ausdrücklich eine Präzedenzklausel zum Schutz des staatlichen Patronats eingefügt habe.32 Wenn daher Bertram von einer „freien Ernennung“ des Propstes spreche, so beziehe sich dies zweifellos auf seinen eigenen Standpunkt, aber nicht auf die Ansicht der staatlichen Seite.33 Außerdem – Pacelli fügte seine römische Perspektive hinzu – sei die Konvention seinerzeit vom Breslauer Oberhirten abgeschlossen worden, ohne eine vorhergehende oder nachfolgende Bestätigung durch den Heiligen Stuhl. Weil diese Tatsache in seinen Augen offenbar die Valenz der Vereinbarung erheblich minimierte, hielt Pacelli es für angemessen, dass Bertram im aktuellen Fall nicht die Zustimmung der Regierung für die Wahl des neuen Propstes einholte, höchstens in Verbindung mit der Präzedenzklausel für künftige Besetzungen. Nützlich sei außerdem die Kenntnis, dass Deitmer vor seiner Erhebung zum Weihbischof bereits Apostolischer Protonotar ad instar participantium gewesen sei.34 Falls nämlich Zweifel aufträten, ob die Besetzung der Propstei im aktuellen Fall dem Heiligen Stuhl reserviert sei, könne man sich auf Can. 1435 berufen. Dieser Canon behielt dem Papst die Besetzung jener Benefizien vor, die vor der Vakanz von einem Ehrenfamiliar des Pontifex – beispielsweise einem Protonotar – bekleidet wurden.35 Wie aus seiner rechtlichen Interpretation ersichtlich, votierte Pacelli für eine freie Besetzung der Propstei durch den Heiligen Stuhl.36
In Bezug auf das zweite Amt, das des Delegaten und Weihbischofs, sei es nötig festzuhalten – wie Pacelli erklärte –, dass angesichts der bevorstehenden Errichtung des Bistums Berlin, „der zu wählende Kandidat auch befähigt sein muss, der künftige Bischof von Berlin zu sein“37. Damit kam Pacelli auf die von Bertram verlangten Fähigkeiten zu sprechen, die der künftige Oberhirte besitzen müsse. Diese seien – der Breslauer Kardinal hatte von Innerlichkeit, Priorität der Seelsorge und administrativem Geschick gesprochen – „gewiss von essentieller Wichtigkeit“38. Doch die von Bertram als zweitrangig klassifizierten repräsentativen Qualitäten, eine „gewisse Feinheit des Umgangs“39, stufte der aristokratische Diplomat ganz anders ein: Auch sie seien alles andere als unnütz in einem solchen Zentrum wie Berlin. So sei der Einfluss Deitmers auf die kultivierten Kreise – wie Pacelli nicht unkritisch resümierte – sehr begrenzt gewesen, weil er diesen Habitus nicht besessen habe. Freilich war ein anderer Aspekt für Pacelli noch viel bedeutender: die Priesterausbildung in der neuen Diözese. Wie schon im angesprochenen Tützer Besetzungsfall ging Pacelli mit der theologischen Lehrsituation in Breslau – der alten Wirkungsstätte Joseph Wittigs40 –, wo die Berliner Alumnen studierten, hart ins Gericht:
„Tatsächlich ist, wie leider die Erfahrung zeigt, die Bildung und Erziehung, welche die Aspiranten auf das Priestertum an der theologischen Fakultät und im Konvikt von Breslau erhalten, unter verschiedenen Aspekten ziemlich mangelhaft; daher scheint es mir unerlässlich, dass, sobald das Gebiet von Brandenburg und Pommern einmal getrennt ist, der neue Bischof die Studenten der heiligen Theologie prinzipiell an das Kollegium Germanicum-Hungaricum in Rom oder an das Philosophisch-Theologische Institut von Frankfurt oder auch, wenn man will, zum Teil in ein bischöfliches Seminar (zum Beispiel nach Trier oder Fulda), welche größere Garantien in dieser Hinsicht bieten, entsendet.“41
Nachdem damit das zentrale Kriterium des Kandidatenprofils aufgestellt war, kam Pacelli auf die drei Personenvorschläge Bertrams zu sprechen:
Dessen Favorit Piontek habe sich zwar – so urteilte der Nuntius – um den schlesischen Bonifatiusverein verdient gemacht, sei aber ansonsten – wie er aus verschiedenen, namentlich nicht genannten Quellen erfahren habe – „von mäßiger Qualität“42. Außerdem würde dieser die Alumnen zweifellos weiterhin die Universität in Breslau besuchen lassen. Also stand der Genannte nicht ernsthaft zur Disposition. Ähnliches diagnostizierte Pacelli für Kaller. Zwar sei dieser sehr eifrig, dem Heiligen Stuhl treu ergeben und erledige seine Aufgabe in Schneidemühl sehr gut, aber es sei doch sehr zu bezweifeln, dass er einer so wichtigen Diözese vom Kaliber Berlin ebenso gewachsen wäre. Abgesehen davon sei es auch ziemlich schwierig, ihn dort zu ersetzen, wo doch die Einsetzung des Schneidemühler Administrators so vielen Hindernissen begegne.43 Damit spielte Pacelli wohl besonders auf das spannungsgeladene Zusammentreffen von preußischen und polnischen Interessen in diesem Grenzgebiet an, welches die Kandidatenfindung bei der vergangenen Besetzung 1925/26 erheblich kompliziert hatte. Etwas besser war es nach Ansicht des Nuntius um Steinmann bestellt. Aus dem Gutachten Schreibers, das Pacelli seinem Bericht beifügte, könne Gasparri ersehen, dass „dieser ziemlich bemerkenswerte Qualitäten der Tätigkeit, der Geschicklichkeit und der Erfahrung besitzt, auch hinsichtlich Berlin“44. Seine Treue zum Heiligen Stuhl nähre die Hoffnung, dass Steinmann auch dessen Instruktionen zur Ausbildung des Klerus umsetzen werde. Diese Instruktionen, an die Pacelli hier dachte, sind mit den Vorgaben zu entschlüsseln, welche der Geheimerlass der Studienkongregation bereits 1921 dem deutschen Episkopat an die Hand gegeben hatte.45 Auf jeden Fall – so der Nuntius weiter – sei es nötig, „über diesen fundamentalen Punkt“46 auf geheimem Wege Zusicherungen einzuholen, weil auch die Gefahr bestehe, dass er seine Alumnen, wenn nicht nach Breslau, so an die staatliche theologische Akademie Braunsberg entsende, da dort sein Bruder, Alfons Steinmann, die Professur für Neutestamentliche Exegese bekleide. Auch das war für Pacelli zu verhindern, denn in Braunsberg waren die Verhältnisse seiner Ansicht nach nicht besser als in Breslau.47 Doch das war nicht das einzige Negativargument: „Einigen Zweifel hinterlässt auch der Charakter des Kandidaten, der nämlich von etwas herrischer Natur ist und der daher keine besondere Sympathie in der Geistlichkeit zu genießen scheint.“48 Dieses Urteil Pacellis macht einen harten Eindruck: Das Gutachten Gehrmanns hatte doch eine ganz andere Sprache gesprochen und die vielen Sympathien, die der Klerus dem Stettiner Propst entgegenbrachte, luzide herausgestellt. Auf das Votum des Steyler Missionars ging Pacelli aber mit keinem Wort ein. Aus welchem Grund hielt er das überaus positiv wertende Exposé zurück? Sinn machte dieses Vorgehen nur, wenn er Steinmanns Kandidatur letztlich nicht für wünschenswert hielt. Folgerichtig war sein abschließendes Votum über den Propst nicht überzeugend: „Alles in allem aber scheint mir, dass er als eine geeignete Person betrachtet werden kann.“49
Damit hatte Pacelli in seinem Bericht nicht nur alle Kandidaten, die der Vorsitzender der Fuldaer Bischofskonferenz in Vorschlag gebracht hatte, mehr oder weniger abgelehnt. Darüber hinaus hatte er auch den Boden bereitet, um in gekonnt schulmäßiger Argumentationsdramaturgie seinen eigenen, eigentlichen Kandidaten einführen zu können: Kaas.50 Seiner Ansicht nach hatte Bertram mit seinem Hinweis, dass Pacelli seinen Blick vielleicht auch über die Grenzen Ostdeutschlands hinaus bewegen wollte, sogar auf den Trierer Kanoniker angespielt, denn über diesen habe Bertram noch kürzlich mit ihm gesprochen, als er anlässlich der Beerdigung Deitmers nach Berlin gekommen sei. Wenngleich der Zentrumsprälat dem Kardinalstaatssekretär ein Begriff sein musste, hob Pacelli die seiner Ansicht nach wichtigsten Attribute noch einmal hervor: „Ehemals Alumne des Kollegium Germanicum-Hungaricum, ist er ein Mann von hohen und außergewöhnlichen Qualitäten, der überall geschätzt wird und in sich alle notwendigen Anforderungen für einen Bischof vereint, der in der Reichshauptstadt residiert.“51 Bemerkenswerterweise machte Pacelli aber auch hier gewichtige Vorbehalte, die zumindest momentan die Wahl seines Vertrauten erschweren würden: Zum einen sei Kaas erst kürzlich – gegen seinen eigenen Willen, wie Pacelli betonte – zum Vorsitzenden der Deutschen Zentrumspartei gewählt worden und es sei nicht einsichtig, wie er dort so schnell ersetzt werden könnte.52 Zum anderen hegte der Nuntius gesundheitliche Bedenken, insofern sich Kaas aufgrund exzessiver Arbeit, den fortwährenden Strapazen seiner vielen Amtsgeschäfte und den Folgen einer Operation im November 1927 regelmäßig erholen müsse.
Pacelli hatte also für den Moment keinen opportunen Kandidaten anzubieten. Wenn man auf den tauglichsten Geistlichen Kaas zurückgreifen wollte, musste man seiner Ansicht nach also noch etwas warten. Von daher überrascht es nicht, wenn ihm im Folgenden daran lag, die Dringlichkeit der Wiederbesetzung des vakanten Amtes zu relativieren, indem er auf den Umstand hinwies, dass es bis 1923 – also bis zum Zeitpunkt der Erhebung Deitmers in den episkopalen Ordo – in Berlin keinen Weihbischof gegeben habe. Daher sei es wichtiger, „eine wahrhaft gute Wahl“53 zu treffen, als eine schleunige Entscheidung zu fällen. Mehr könne er bislang zu diesem Thema nicht sagen, behalte sich jedoch vor, darauf zurückzukommen.