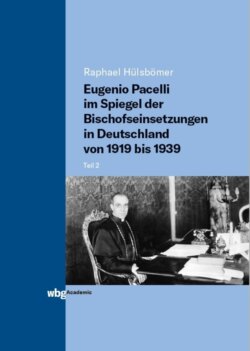Читать книгу Eugenio Pacelli im Spiegel der Bischofseinsetzungen in Deutschland von 1919 bis 1939 - Raphael Hülsbömer - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kandidatensondierungen in St. Georgen
ОглавлениеFolgerichtig legte der Nuntius seinen Plan – zusammen mit Kilians Supplik an den Papst – am 5. Oktober dem Rektor der Hochschule St. Georgen, Pater Wilhelm Klein SJ, zur Beurteilung vor.149 Er bat ihn ebenfalls, die Eignung der vom Limburger Bischof vorgeschlagenen Kandidaten Fendel und Merkel für das Amt des Weihbischofs einzuschätzen. Da Kilian nicht nur von der Möglichkeit einer anderen Regelung, sondern auch von ganz anderen Kandidaten gesprochen hatte, fühlte sich Pacelli auch hier wieder befugt, Rektor Klein um Mitteilung zu bitten, „ob in der Diözese Limburg andere Geistliche sind, die den Vorgeschlagenen vorzuziehen wären“150. Außerdem erlaubte er ihm, die Anfrage, die unter dem secretum Sancti Officii stehe, mit Pater Ludwig Kösters SJ zu diskutieren – Kösters war der unmittelbare Amtsvorgänger Kleins und von 1926 bis 1929 erster Rektor der Jesuitenhochschule gewesen.
Schon wenige Tage später meldete sich Klein zurück und referierte das Ergebnis seiner Unterredung mit Kösters.151 Die Jesuiten beurteilten Fendel und Merkel wie von Pacelli gewünscht streng ausgerichtet auf ihr Verhältnis zur Hochschule. Der Erstgenannte sei für das von Kilian vorgeschlagene Amt des Weihbischofs durchaus geeignet. Zwar gelte er nicht als „übermäßig bedeutend“152, sei aber angesehen und durch seine bisherigen seelsorglichen Ämter für die Aufgabe disponiert.
„Uns [sc. den Jesuiten, R.H.] und unserer Anstalt gegenüber ist er wohlwollend, wenn auch innerlich nicht so nahestehend wie unten noch zu nennende Kandidaten. Er ist konziliant in seinem Wesen, vielleicht auch bei Gelegenheit zu unserm Nachteil. Als Bischof käme er wohl nicht in Betracht, wie auch nicht der an zweiter Stelle genannte Kandidat, H[err] H[ochwürden] Merkel.“153
Letzterer sei ihnen kaum bekannt und man müsse abwarten, welchen Einflüssen er sich einmal öffnen werde. Genau wie der Nuntius hielten die beiden Jesuiten die Variante, einen Koadjutor zu installieren, für die weitaus bessere Lösung als die Option, einen Weihbischof zur Aushilfe einzusetzen. Für den Posten des künftigen Diözesanbischofs hatten sie vier Geistliche im Auge: den Wiesbadener Pfarrer, Antonius Hilfrich, den Subregens des Limburger Priesterseminars, Wilhelm Pappert, den Frankfurter Pfarrer, Prälat Jakob Herr, und den Dekan in Höchst (Frankfurt), Friedrich Wolf. Über alle vier fertigte Klein nicht nur eine kurze Vita an, die auch die Studienorte berücksichtigte, sondern skizzierte ebenfalls pointiert die spezifischen Qualitäten, was Kilian beides nicht getan hatte. Pacelli hingegen war dies so wichtig gewesen, dass er die „genaue[r] Angabe ihrer Personalien und Eigenschaften“154 von Klein im Vorhinein ausdrücklich verlangt hatte.
1) Hilfrich (56-jährig), promoviert in Philosophie und Theologie, sei ehemaliger Germaniker und 1898 zum Priester geweiht worden. Nach zwei Kaplansstellen in Weilburg und Frankfurt sei er 1902 Regens und 1911 Rektor des bischöflichen Konvikts in Hadamar geworden, bevor er schließlich 1914 das Pfarramt in Wiesbaden übernommen habe. 1920 sei er außerdem zum Synodalrichter berufen worden. Das Urteil der Jesuiten über ihn war durchwachsen:
„Streng kirchlich gesinnt. Sankt Georgen aufrichtig gewogen. Er scheint aber bei seinen Confratres nicht sehr beliebt zu sein. Man nennt ihn Theoretiker. Auch glaubt man, dass er einseitig die Seelsorge bei den Gebildeten bevorzugt. Trotz des Wohlwollens für St. Georgen wird er möglicherweise versucht sein, in die inneren Angelegenheiten, Studienordnung usw. sich einzumischen.“155
2) Pappert (39-jährig), in den gleichen Fächern promoviert, ebenfalls im römischen Germanicum ausgebildet und im Jahr 1915 zum Priester ordiniert, sei daraufhin Kaplan in Schlossborn, Marienhausen und Frankfurt gewesen. Danach habe er das Amt des Subregens am Limburger Priesterseminar bekleidet, 1922 dort außerdem eine Professur erhalten. Pappert war der eindeutige Favorit der beiden Gutachter:
„Ihn bezeichnet P. Kösters, der wichtige Verhandlungen in Fragen unserer Anstalt mit ihm als Vertreter des Bischofs zu führen hatte … als für unser Kolleg ohne allen Zweifel besten Kandidaten. Er ist ein warmer und aufrichtiger Freund von St. Georgen, der auch die Selbständigkeit nicht antasten wird. Ich selbst kenne ihn persönlich sehr gut aus den Jahren im Germanicum, wo er in seinem Priesterjahr die höchste Vertrauensstelle hatte, die dort Alumnen gegeben wird.“156
Die damals vorhandenen ausgezeichneten Eigenschaften habe er seit dieser Zeit weiterentwickelt: „Klugheit, solide theologische Bildung, treukirchliche Gesinnung, Seeleneifer, Einfachheit.“157 Doch auch auf der Contraseite standen vier Punkte: Pappert sei etwas übereifrig und müsse mehr Milde und Diskretion üben. Freilich sei ihm – so Klein – dieser Fehler im Gegensatz zu Kösters nicht aufgefallen. Möglicherweise sei der Genannte zu jung, aber – so beeilte sich Klein zu ergänzen – auch der von Kilian genannte Merkel sei mit seinen 41 Jahren nicht wesentlich älter. Negativ sei weiterhin seine geringe Stellung zu verbuchen, aufgrund der man in der Öffentlichkeit nicht an seine Kandidatur denken würde, sodass seine Ernennung „verstimmen“158 könnte. Schließlich stellte Klein die offene Besoldungsfrage, die allerdings nicht nur beim Subregens, sondern bei allen vier Vorschlägen beantwortet werden müsse. Eine Lösung könne darin bestehen, dass Pappert das Gehalt und die Wohnung der vakanten Regensstelle erhalte. Schlussendlich hielt Klein die aufgezählten Einwände nicht für entscheidend.
3) Herr (62-jährig), mit den gleichen akademischen Titeln wie die vorigen ausgestattet, wiederum Germaniker, hatte eine längere Laufbahn hinter sich, wie Klein skizzierte: 1892 Priesterweihe, darauffolgende Kaplanszeiten in Montabaur und Wiesbaden, 1901 schließlich Pfarrer in Schlangenbad, 1906 Regens und Professor am Limburger Seminar, außerdem Diözesanpräses der katholischen Arbeitervereine. In Kriegszeiten sei er als Stadtpfarrer und bischöflicher Kommissar nach Frankfurt gekommen, später mit einem Ehrenkanonikat und dem Prälatentitel ausgezeichnet worden. Das Urteil lautete knapp: „Er hat die angesehenste Stelle in Frankfurt a[m] M[ain]. Sehr eifrig. Sehr kirchlich gesinnt. Der Gesellschaft Jesu und St. Georgen aufrichtig gewogen. Einfach und anspruchslos. Beim Klerus leider, wie es scheint, im Allgemeinen sehr unbeliebt wegen etwas schroffen, unfeinen Wesens.“159
4) Wolf (45-jährig) habe nach dem Empfang des Weihesakraments – so die Darstellung des Jesuiten weiter – seine Kaplanszeit in Hofheim, Rüdesheim und Frankfurt absolviert. Nach einem Jahr als Subregens (1913) habe er den gesamten Krieg über als Feldgeistlicher gewirkt, anschließend sei er als Pfarrverweser in Eppstein und Kransberg tätig gewesen. Seit 1923 sei er Stadtpfarrer und seit 1925 Dekan in Höchst. Was ihm nach Ansicht Kleins fehlte, war die profunde wissenschaftliche Ausbildung. Angesichts des Faktums, dass Wolf nicht in Rom, sondern in deutschen Lehranstalten studiert hatte, überrascht nicht, dass der Jesuit bei ihm auf die Nennung seines Studienortes verzichtete. Jedoch werde er – so Klein weiter – gemeinhin als episkopabel gehandelt, sei guten Willens, im Bereich der Praxis allseitig geachtet und unter dem Klerus beliebt. Selbst kurzzeitig Mitglied der Societas Iesu gewesen – Klein erklärte, dass Wolf als Student eingetreten sei und den Orden dann aber wieder verlassen habe, was sich später allerdings noch als Fehlinformation herausstellen sollte –, sei er dem Orden gegenüber wohlwollend eingestellt. „St. Georgen wird er vielleicht nicht so viel inneres Verständnis wie die vorigen Herren, aber doch Interesse entgegenbringen, u[nd] sich wohl nicht in die innern Angelegenheiten, Studienordnung usw. hemmend einmischen.“160
Das abschließende Votum der beiden Informanten fiel auf Pappert. Doch Pacelli folgte ihrer Empfehlung keineswegs. Aus seinem Antwortschreiben vom 18. Oktober geht hervor, dass er vielmehr „auch im Interesse der Phil[osophisch-] theol[ogischen] Lehranstalt St. Georgen, und um jedem möglichen Verdacht vorzubeugen“161 für den einzigen Nicht-Germaniker unter dem Quartett plädierte: Dekan Friedrich Wolf. Diese Entscheidung hatte offensichtlich eine dezidiert taktische Motivation, doch welchem „Verdacht“ wollte der Nuntius vorbeugen? Sein Bericht, den er knapp zwei Wochen später für Gasparri verfasste, gibt Aufschluss:162 Pacelli wollte nicht, dass nach der kürzlichen Ernennung Schreibers zum Oberhirten von Berlin sofort ein weiterer „Römer“ einen Bischofsstuhl bestieg.163 Er sah die Gefahr, dass in der deutschen Öffentlichkeit der Vorwurf aufkommen beziehungsweise genährt werden könnte, der Heilige Stuhl benutze die im Konkordat gewonnenen Freiheiten ausschließlich dazu, um in Rom ausgebildete Geistliche an die Spitzen der Diözesen zu bringen. Deshalb schien es dem Nuntius klüger, die römisch-theologische Ausrichtung des Kandidaten nicht formaliter zu offenbaren, sondern einen Geistlichen zu wählen, der gleichwohl die Affinitäten zum Jesuitenorden, zum Heiligen Stuhl und zur römischen Theologie besaß, dem man diese jedoch nicht sogleich an der Biographie ablesen konnte.
Zunächst blieben ihm jedoch offene Fragen über Wolf, die er Klein zur Beantwortung vorlegte: Zum einen interessierte ihn, warum Wolf nicht in den Jesuitenorden ein- beziehungsweise aus ihm wieder ausgetreten sei. Zum anderen wollte er wissen, wo und mit welchem Erfolg er seine Studien vorgenommen habe.164 Genau diese beiden vom Nuntius angesprochenen Punkte seien – so der Rektor von St. Georgen in seiner Entgegnung fünf Tage später – der Grund gewesen, warum er Wolf an die letzte Stelle der Vorschläge gesetzt habe.165 Seine weiteren Recherchen und die erneute Absprache mit seinem Amtsvorgänger hätten seine Ansicht verstärkt, dass der Dekan „sicher ein guter Priester“ sei, „aber man kann vielleicht gerade wegen dieser beiden Punkte … etwas zweifeln, ob er unter den gegebenen Verhältnissen der rechte Mann ist“166. Nachdem Wolf immerhin zuvor von ihm als grundsätzlich geeignet vorgeschlagen war, kam diese Aussage nun einem Rückzieher gleich. Hinsichtlich der Zugehörigkeit zur jesuitischen Ordensgemeinschaft bemerkte der Rektor, dass Wolf mit seiner früheren Absicht, der Gesellschaft anzugehören, heute sehr diskret umgehe. Von einem Freund habe er erfahren, dass der Dekan von Höchst sogar mittlerweile der Ansicht sei, dass es besser gewesen sei, diesen Schritt damals nicht gegangen zu sein. Novize sei er nie gewesen und der Grund dafür sei schwer zu eruieren. Sicherlich sei dafür ein inneres Unverständnis und eine „innere Disharmonie“167 verantwortlich. Wohl deshalb habe er kürzlich den Besuch einiger Jesuitenpatres, die regelmäßig in Höchst Vorträge halten würden, abbestellt. Die wissenschaftliche Ausbildung schließlich habe Wolf einerseits in Fulda erhalten, wo er – wie Klein explizierte – Philosophie und zwei Semester Dogmatik studiert sowie die praktischen Inputs bekommen habe, andererseits in Freiburg, wo er zwei weitere Semester Dogmatik bei Professor Carl Braig gehört habe. Dass letzterer gegenüber der Neuscholastik durchaus kritisch eingestellt war, sagte Klein zwar nicht, war aber sicherlich der Grund für diese Nennung.168 Zwar sei Wolf stets fleißig gewesen und habe als begabt gegolten. Doch könne das nicht darüber hinwegtäuschen, dass er eine
„gründliche systematische Schulung in Philosophie und besonders Theologie … nicht bekommen [hat]. Hieraus – und aus seinem Charakter? – erklären sich wohl auch manche, fast unreife, stürmische Auffassungen – ‚krause Ansichten‘ sagte ein guter Freund und Bekannter von ihm –, die auch heute noch hervortreten. Für scholastischen Studienbetrieb hat er kaum Sinn.“169
Seine Stärke liege mehr auf seelsorglichem und zwischenmenschlichem Gebiet, wenngleich er auch im Umgang mit den staatlichen Behörden nicht als gewandt bezeichnet werden könne. Summa summarum schloss Klein, dass die günstige Zukunft für die Jesuitenhochschule eher ungewiss sei, wenn Wolf der künftige Bischof von Limburg würde.
Für diese Zukunft wäre Pappert unfraglich der beste Kandidat. Doch mittlerweile – so Klein weiter – seien er und Kösters der Meinung, dass aufgrund der im vorigen Schreiben angeführten Einwände auch vom Subregens abgesehen werden müsse. Diese würden jedoch auf Hilfrich nicht im gleichen Maße zutreffen, den Klein nun ins beste Licht rückte. Zwar sei auch er Ex-Germaniker:
„Aber er ist schon jetzt in der Diözese sehr angesehen und gilt in der Öffentlichkeit als Bischofskandidat. Auch steht er offenbar in gutem Verhältnis zu den weltlichen Behörden, mit denen er gewandt verhandelt, auch zu dem weltanschaulich entgegengesetzten Regierungspräsidenten.170 Dass er Sankt Georgen und der Gesellschaft Jesu aufrichtig gewogen ist, und dass bei ihm der Bestand und die glückliche Entwicklung von Sankt Georgen unvergleichlich besser gesichert sein würden als bei Herrn Wolf, kann keinem Zweifel unterliegen.“171
Im Folgenden entkräftete Klein der Reihe nach die Schwächen, die er im ersten Brief dem Wiesbadener Pfarrer zugewiesen hatte. Die „selbständige Stellung“ Hilfrichs der Hochschule gegenüber, die Klein mit der Vermutung angesprochen hatte, dass dieser sich in die internen Angelegenheiten des Studienbetriebs einmischen werde, sei nur eine relative Einschätzung im Vergleich zu Pappert und Herr gewesen. Außerdem – so führte der Rektor an – würde Hilfrich jedem Wunsch Pacellis bezüglich St. Georgen Folge leisten. Auch das vormals angesprochene Negativum der mangelnden Beliebtheit im Klerus entkräftete der Jesuit. Denn er vermutete, dass diese aus seiner „überragenden Persönlichkeit“172 resultiere.
„Jedenfalls wäre er nach Erscheinen und Benehmen, nach echt priesterlichem Denken und Leben ein würdiger, kirchlich unbedingt treuer Bischof. Seine Pfarrkirche ist, wie ich vorgestern hörte, die am meisten besuchte Kirche in der Diözese. Ich muss übrigens gestehen, dass ich nach der früher gehörten Äußerung über die ‚Bevorzugung der Gebildetenseelsorge‘ überrascht war, als ich auf einem ziemlich langen Gange mit ihm durch Wiesbaden sah, mit welcher Verehrung die Vorübergehenden, Arm und Reich, Jung und Alt ihn grüßten. Ich hatte unwillkürlich den Eindruck, ob nicht am Ende doch invidia jene Fama über ihn veranlasst habe.“173
Weitere Informationen könne sich Pacelli von den Diözesanbischöfen Matthias Ehrenfried in Würzburg und Christian Schreiber in Meißen und Berlin besorgen, mit denen Hilfrich gut befreundet sei. Ebenfalls optimal sei sein Verhältnis zu Bischof Kilian, der ihn erst im Vorjahr zum Geistlichen Rat ernannt habe.174
Mit diesen Präferenzverschiebungen zugunsten Hilfrichs auf Kosten Papperts und zu völligen Ungunsten Wolfs überholten Klein und Kösters ihr erstes Votum. Die veränderten Ansichten waren nach eigenen Angaben aus einem Besuch Kleins bei Hilfrich – den der genannte Spaziergang mit Hilfrich durch Wiesbaden bereits andeutete – sowie einem Zusammentreffen beider Jesuiten mit Wolf hervorgegangen. Ob Klein und Kösters die Genannten bei diesen Gelegenheiten bloß kritisch prüften und die Bischofsfrage gemäß dem secretum Sancti Officii nicht ausdrücklich erörterten, muss offen bleiben.