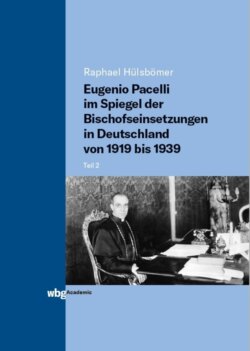Читать книгу Eugenio Pacelli im Spiegel der Bischofseinsetzungen in Deutschland von 1919 bis 1939 - Raphael Hülsbömer - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Pacellis praktische Lösung und der Vorschlag Hilfrichs
ОглавлениеWenn Kilian gehofft haben sollte, beim Papst auf mehr Verständnis als beim Nuntius zu treffen, so konnte das allein schon angesichts einer strukturellen Veränderung nicht gelingen. Denn Pacelli hatte unterdessen seine Laufbahn als Apostolischer Nuntius beim Deutschen Reich beendet. Nachdem er noch im Dezember 1929 nach Rom zurückgekehrt war und von Pius XI. den Kardinalspurpur erhalten hatte, trat er am 7. Februar 1930 offiziell die Nachfolge Gasparris im Amt des Staatssekretärs an.199 Den „Fall Limburg“ nahm er praktisch mit nach Rom und führte ihn von dort weiter.200 Noch vor seinem offiziellen Amtsantritt reagierte Pacelli aus dem römischen Staatssekretariat auf die Eingabe des Limburger Oberhirten und erwiderte ihm, dass der Papst zwar gerne zur Kenntnis nehme, dass Kilian den römischen Kandidaten befürworte, aber die geschilderten Schwierigkeiten keineswegs für unüberwindlich halte.201
Pacelli erläuterte: Zunächst seien die Probleme nur vorübergehend, denn Hilfrich könne das erste vakant werdende Kanonikat übertragen werden, womit die ausreichende Gehaltssumme vorhanden wäre. Bis dahin müsse eben improvisiert werden: Kilian habe mehrfach darauf hingewiesen, dass das Amt des Seminarregens mit dem des Weihbischofs oder Koadjutors verbunden werden sollte. Weil ersteres derzeit unbesetzt sei, stehe die damit verbundene Vergütung von 3.600 Reichsmark zur freien Verfügung. Mit den 3.000 Mark, die Kilian aus seinem Privateinkommen beisteuern wolle, seien es sogar 6.600 Mark, zu denen die unentgeltliche Verpflegung und Unterkunft, die gewöhnlich dem Regens zustehe, noch hinzukämen. Das müsse genügen, wenn man den fehlenden Betrag von 5.400 Mark nicht über eine Erhöhung der Diözesansteuer einnehmen wolle, was der Papst – so Pacelli – nicht empfehle. Für die Jahresfrist, bis das neue Priesterseminar fertiggestellt sei, müsse sich Hilfrich mit der – von Kilian als der bischöflichen Würde inkonvenient bezeichneten – Regenswohnung begnügen. Vom Staat die entsprechende finanzielle Hilfe zu bekommen, hielt Pacelli für aussichtslos, weil die Dotationssumme im Konkordat endgültig festgesetzt sei. Ein weiteres Problem, das Kilian in seinen früheren Schreiben angemerkt hatte, bestand darin, dass der Regens – also der künftige Koadjutor – für die Alumnen des Seminars Vorlesungen hielt. Sollte dieser jedoch bald Firmreisen und Pfarrvisitationen vornehmen, müsste eine Vertretung für die Lehre eingestellt werden, was dem Bischof wiederum als nicht finanzierbar erschien. In dieser Angelegenheit dachte Pacelli an eine pragmatische Vertretungsvariante, insofern man in Limburg selbst oder – nicht überraschend – in der Jesuitenlehranstalt St. Georgen Professoren finden könne, welche gewiss die Aufgabe während der Absenz des Regens übernähmen.
Nach diesen praktischen Hinweisen von höchster Stelle war an eine fortgesetzte Debatte über diese Angelegenheit nicht mehr zu denken. Wie Kilian den neuen Kardinalstaatssekretär informierte, habe er Hilfrich am 6. Februar von seiner bevorstehenden Ernennung zum Koadjutorbischof von Limburg unterrichtet und „ihn ermahnt, dass er dem Willen des Papstes gehorche“202. Hilfrich war „corde pavido“203 dazu bereit, wie er wenige Tage später in einer Ergebenheitsadresse an den Kardinalstaatssekretär schrieb. Jedoch war er keineswegs mit der provisorischen Lösung der lebenspraktischen Fragen nach Gehalt und Unterkunft einverstanden. Denn zum einen habe er eine Unterhaltspflicht gegenüber seiner Schwester, welche für ihn die Haushaltsarbeiten verrichte – in das Priesterseminar könne er sie nicht mitnehmen –, und zum anderen sei die Ausstattung der Regenswohnung im Seminar sehr spärlich. Daher schlug Hilfrich im Einvernehmen mit Bischof Kilian vor, dass er zunächst im Amt des Pfarrers in Wiesbaden und damit im Besitz des entsprechenden Benefiziums bleibe und weiterhin dort residiere. Dies sollte so lange andauern bis entweder ein Domkanonikat vakant werde oder sich eine andere Lösung der Schwierigkeiten ergebe. Für seine Pfarrei würden daraus keine Nachteile resultieren, insofern vier Kapläne, drei andere Pfarrer und zwei Priester, die an der Mittelschule unterrichten würden, seine Verpflichtungen übernehmen könnten, wenn er durch die Aufgaben des Koadjutors verhindert sei. Hilfrich zählte weitere Vorteile auf, die dafür sprächen, in Wiesbaden zu bleiben: die Wege der Visitationsreisen seien aus Wiesbaden erheblich kürzer als aus Limburg selbst; von 468.652 Katholiken der Diözese befänden sich 301.458 sehr viel näher an Wiesbaden als an Limburg;204 die Stadt erfreue sich eines guten Rufs, die Pfarrkirche St. Bonifatius sei größer als der Limburger Dom205 und das Pfarrhaus von angemessener Güte, sodass nichts von alledem der bischöflichen Würde zuwiderlaufe. Auch seine Absenz von der Domstadt sei zu vernachlässigen, weil die gerade einmal 45 Kilometer lange Strecke zwischen beiden Städten es ermögliche, bei den Sitzungen der Diözesanverwaltung in der Bistumshauptstadt anwesend zu sein. Eine „ordentlichere“ Regelung – so Hilfrich schließlich – bestehe natürlich darin, dass einer der Domherren sein Pfarrbenefizium in Wiesbaden übernähme und er im Gegenzug die frei werdende Domstelle. Aber das sei wohl schwer zu realisieren, weil das auferlegte secretum Sancti Officii – das sich so nicht zum ersten Mal als Hindernis entpuppte – eine Absprache verhindere.206