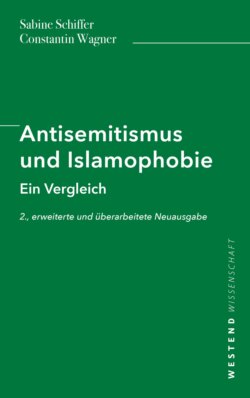Читать книгу Antisemitismus und Islamophobie - Sabine Schiffer - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1 Die Legitimationssuggestion: Bedrohungsszenario und Verteidigungsmythos
Оглавление»Seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen [Hervorhebung Autoren].«4
Mit dieser Erklärung behauptete die Hitler-Administration, die Aggression für den Krieg wäre von Polen ausgegangen und man hätte auf diesen Angriff nur reagiert. Offensichtlich hatte selbst ein Unrechtsregime wie das der Nationalsozialisten das Bedürfnis, seine Taten als rechtmäßig – als Reaktion auf Aggression – darzustellen.
Da Menschen für ihre Handlungen immer eines Legitimationsgefühls bedürfen, ist es notwendig, das Zustandekommen eines solchen Berechtigungsempfindens5 nachzuvollziehen. Ob es sich um die Errichtung des Römischen Reiches, die Kreuzzüge handelt, die Kolonisierung anderer Kontinente mitsamt der Bevölkerung, um die Sklaverei und die Fast-Ausrottung der indigenen Bevölkerungen in Amerika, um die Verfolgung und Vernichtung der Juden oder anderer ideologisch Verfolgter in den letzten Jahrhunderten, um den Terror in Algerien nach den Wahlen 1992 oder um die Brandanschläge in Deutschland (z. B. Hoyerswerda 1991, Rostock und Mölln 1992, Solingen 1993), um die gegenseitige Vernichtung durch Selbstmordattentate und Militäraktionen in Israel und Palästina oder die Anschläge des 11. Septembers 2001 auf die USA und den sogenannten Krieg gegen den Terror.
Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Allen Aktionen liegt ein Gefühl zugrunde, dass das So-Handeln erst ermöglicht: Der feste Glaube an die eigene Legitimation. Die empfundene Berechtigung zum So-Handeln kann sich dabei aus zwei unterschiedlichen Motiven ableiten:
1. die Vorstellung einer Minderwertigkeit des Gegenübers, das es nicht besser verdiente oder dem man eventuell gar helfen müsse (»The white man’s burden«/ Die Last des weißen Mannes)6
und/ oder
2. das Gefühl einer Bedrohung durch »die Anderen«, gegen die man sich »verteidigen« müsse.
Beides hat zur Legitimation von Kriegen ebenso wie zur Legitimation des Holocaust beigetragen.
Die Motive haben eines gemeinsam: Das Empfinden, dass das So-Handeln legitim sei, dass man berechtigt sei, so zu agieren, ja gar so handeln müsse, aus Vernunftgründen, und dass man damit nichts Unrechtes tue, weil man sich ja nur verteidige. Heute kann man ähnliche Mythen in den Kriegsbegründungen finden, die zwar eine völlig andere Grundlage haben als der Antisemitismus, aber dennoch von einer Bedrohung ausgehen, die in keinem Verhältnis zu den Möglichkeiten der angeblich Bedrohlichen steht.
Die Geschichtsschreibung, die immer wieder Unrecht aufgedeckt hat, scheint zu beweisen, dass die kritische Betrachtung der zuvor geführten Begründungsdiskurse oft nur in der Retrospektive möglich ist.7 Dabei stellt das rückwirkende Infragestellen solcher Diskurse zwar eine Chance dar, die Zusammenhänge zu verstehen, aber eine Vorab-Bewertung ähnlicher Mechanismen im Hier und Jetzt leitet sich daraus nicht zwingend ab.
Im Fall des Antisemitismus wissen wir heute, dass die Vorstellung einer Bedrohung durch die Juden fiktiv war – wie nicht zuletzt der Holocaust grausam bewies – und auf einer langjährigen sprachlichen Konstruktion des antijüdischen Feindbildes und dessen Verinnerlichung beruhte.8 Dennoch sahen Antisemiten sich als defensive Bewegung.9 Wie also sollen solche Diskurse erkannt werden, wenn man sich gerade emotional in einer schwierigen Situation befindet und sich bedroht fühlt?
Selbstverteidigung ist legitim und wenn der Tatbestand des Angriffs bzw. der der Bedrohung gegeben ist, ist auch Gewalt – zu Verteidigungszwecken – moralisch akzeptiert. Darüber hinaus galt schon früh, dass Angriff die beste Verteidigung sei. Das Recht auf Verteidigung ist im Völkerrecht angelegt und manifestiert sich in den modernen politischen Systemen unter anderem im Begriff »Verteidigungsministerium«. Allerdings lehrt uns die Geschichte, dass das Konzept der Bedrohung, die eine solche Verteidigung legitimieren würde, auch missbraucht werden kann. So wurde unter anderem 1883 im Chemnitzer Aufruf vor der »jüdischen Gefahr« gewarnt.10 Houston Stewart Chamberlain legitimierte die rechtliche Schlechterstellung der Juden damit, dass man sich vor ihnen »schützen« müsste.11 Wie können wir aber eine echte von einer fiktiven Bedrohung unterscheiden? Auch darüber gibt die Analyse des antisemitischen Diskurses Aufschluss.