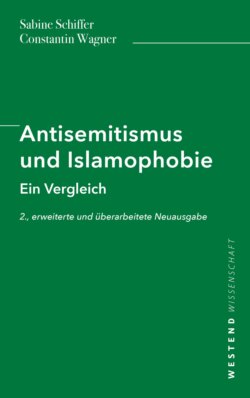Читать книгу Antisemitismus und Islamophobie - Sabine Schiffer - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.5 Aktuelle Antisemitismusdebatten als Zeugnis fortwährenden Unverständnisses
ОглавлениеIn den letzten Jahren werden immer wieder neue und letztlich doch die gleichen Debatten über Antisemitismus geführt, den es immer noch gibt – wenn auch nicht unbedingt überall dort, wo er vermutet oder behauptet wird, und stattdessen an vielen Orten, an denen er nicht entlarvt wird.144 Wir gehen im Folgenden verstärkt auf die Unsicherheiten in den Debatten ein und versuchen uns so erneut der Aufgabe zu nähern, wie Antisemitismus effektiv bekämpft werden kann und muss und ob und wie Erkenntnisse aus der Antisemitismusforschung als Vorurteilsforschung für andere diskriminierende Diskurse nutzbar gemacht werden können.
Als Wolfgang Benz, Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung (ZfA), 2008 zu einer Konferenz mit dem Titel »Feindbild Jude – Feindbild Muslim« einlud, schlugen die Wellen hoch. Das Vergleichen von antisemitischem und antimuslimischem Ressentiment galt einigen Aktivisten rund um den Polemiker Henryk M. Broder bereits als Verharmlosung von Antisemitismus und Relativierung des Holocaust.
Eine Person aus Broders Fangemeinde, Jan-Philipp Hein, interviewte 2011 für den Kölner Stadtanzeiger die Nachfolgerin von Wolfgang Benz, Stefanie Schüler-Springorum. Um hier nur verkürzt auf die aufgeregte bis unsäglich zuspitzende Debatte einzugehen, die sogar dem renommierten Antisemitismusforscher Benz Antisemitismus unterstellte, sei an dieser Stelle auf einige erhellende Äußerungen im Interview hingewiesen.
Zunächst einmal heißt es im Teasertext zum Interview suggestiv: »Ihr Vorgänger sorgte für Aufsehen, weil er Israel-Hass mit Islamfeindlichkeit verglich.« Das tat Benz nicht, denn es ging um Antisemitismus allgemein und nicht um »Israel-Hass«. Dies mag eine kleine Ungenauigkeit sein, die – wie wir noch sehen werden – jedoch eine ganze Debattenentwicklung beeinflusst und System hat. Prof. Springorum antwortet auf die Frage nach der Aufgabe des Zentrums und dem Vergleich von Antisemitismus und Islamfeindschaft:
»Man kann Antisemitismus und Islamfeindschaft miteinander vergleichen, weil dann ja auch die Unterschiede deutlich werden. Und ich sehe durchaus Parallelen zwischen der heutigen Situation und der Situation im frühen 19. Jahrhundert, also der Emanzipationszeit. Andere Kollegen sagen, es gäbe diese Parallelen auch im späten 19. Jahrhundert. Dieser Disput ist Grund genug, das historisch zu erforschen, also der Frage nachzugehen, wann welche Gruppen mit welchen Argumenten ausgegrenzt werden.«
Dieses von wissenschaftlichem Interesse geleitete Statement, das sich jeder Zensurforderung entzieht, steht für sich und ist eine Aufforderung, sich ergebnisoffen mit den diversen Epochen zu befassen, um Schlüsse und Lehren aus dem Erkannten zu ziehen. Als Aufgabe des Zentrums betont sie neben der Wissenschaft auch das Wirken in der Öffentlichkeit.145 Sie verweist dann noch auf das Spezifikum des Antisemitismus, dass das Ressentiment gegen Juden auch stets mit einer Welterklärungsfunktion einhergehe und alles Wirken von Juden auf einen großen Plan zurückführt. Hein lenkt dann das Interview auf Linkspartei und Israelfrage.
Die Kaprizierung der Problematik auf Israel, die sich hier andeutet und in Kombination mit einer verstärkten Kritik an linken Positionen einhergeht, dominiert inzwischen den Antisemitismusdiskurs. Dies wird uns noch eingehender beschäftigen (siehe Kapitel 5.5), denn dies beeinflusst auch die nach wie vor umstrittene Definition von Antisemitismus (siehe unten).
Unsicherheiten in der Rechtsprechung bezüglich antisemitischer Volksverhetzung und einige Endlosdebatten um Antiisraelismus und Judenhass zeugen von dem Bedarf einer klaren Definition, die Orientierung gibt. Eine international anerkannte gibt es bisher nicht, obwohl die Wissenschaft – wie weiter oben angeführt – die Kernpunkte von Antisemitismus klar umreißt.
Die sogenannte »EU-Arbeitsdefinition« des European Monitoring Center on Racism and Xenophobia (EUMC, heute FRA) gelangte 2005 durch einen Leak des Israel-Korrespondenten und Aktivisten Ulrich Sahm an die Öffentlichkeit.146
Die Kernthesen des Papiers lauten in der nicht autorisierten Übersetzung auf dem Webportal haGalil:
»Antisemitismus ist eine gewisse Vorstellung zu Juden, die als Hass gegen Juden ausgedrückt werden kann.
Rhetorische und physische Ausbrüche von Antisemitismus sind gegen Juden und nicht-jüdische Individuen gerichtet, und/oder gegen ihr Eigentum oder gegen Institutionen jüdischer Gemeinden und religiöse Einrichtungen.
Zusätzlich können solche Ausbrüche auch den Staat Israel zum Ziel haben, wenn er als jüdisches Kollektiv gesehen wird.«147
Dass das Papier nicht ausgereift ist, sieht man unter anderem daran, dass etwa die Bezeichnung »Juden als Volk« immer wieder eingemischt wird, was einzelne Aussagen sehr unpräzise macht. Vor allem aber das Einschließen antiisraelischer Äußerungen in die Definition erregt seither immer wieder Anstoß bzw. gibt Anlass für unzählige Debatten.
Vor allem in Bezug auf die Frage nach der Grenze zwischen berechtigter Kritik an der Politik Israels und deren Instrumentalisierung zur Diffamierung des Jüdischen allgemein werden die Unsicherheiten deutlich. Natürlich kann man nicht primär von einem antisemitischen Anliegen ausgehen, wenn jemand etwa die Militärpolitik des Landes Israel kritisiert – so kritisieren beispielsweise große Teile der Friedensbewegung jedwede Militärpolitik eines jeden Landes. Aber die Möglichkeit, dass es sich im Falle Israels um eine Stellvertreterkritik eines verkappten Antisemiten handelt, ist gegeben, liegt zum Teil tatsächlich vor und muss auf jeden Fall überprüft werden.
Was tun, um hier unterscheiden zu können? Als verbindlich galt lange in etwa folgende Regel: Antisemitisch in Bezug auf Kritik an Israel sei
1. wenn das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird
2. wenn Praktiken in Israel mit Praktiken in Nazideutschland verglichen werden
3. wenn Kritik an Israel kollektiv auf »die Juden« übertragen wird.
Bei Punkt drei gibt es nichts zu deuteln, weshalb entgegen der gerichtlichen Entscheidung im Fall des Angriffs mit Molotowcocktails auf die Synagoge in Wuppertal während des Gazakrieges 2014 dies natürlich als antisemitischer Akt zu bewerten ist. Denn hier wird die Synagoge – als Symbol für das Judentum – in Haftung genommen für die Politik Israels. Das stellt eine Verallgemeinerung dar, die diese Politik als »jüdisch« identifiziert. Auch wenn die jungen Palästinenser mit der Tat auf die Völkerrechtsverletzungen im Gaza-Streifen aufmerksam machen wollten, sie haben nicht die israelische Botschaft als Ziel ausgewählt, sondern eine Synagoge. Das impliziert, dass »die Juden« als Verantwortliche gemeint waren und das ist Antisemitismus.
Punkt eins und zwei sind hingegen mehrfach erklärungsbedürftig.
Zu Punkt eins: Wenn etwa Kritik an der Staatsgründung Israels mitsamt der Vertreibung vieler Palästinenser geübt wird, dann liegt hier ein anderer Sachverhalt vor, als wenn man einem Land das Existenzrecht abspricht, weil es von Juden bewohnt wird. Erst bei letzterem träfe eindeutig Antisemitismus zu. Die Thematisierung der Gründungsgeschichte des Staates und des mit ihm verbundenen Unrechts muss nicht zwingend gegen »den jüdischen Staat« gerichtet sein, weil er als solcher definiert ist. Solange man die gleichen Maßstäbe an alle Staaten anlegt, ohne Unterschied, ob es sich um Juden oder Nichtjuden handelt, dann ist daran auch nichts Antisemitisches. Alexander Pollak hat ausgehend von der EUMC-Arbeitsdefinition ein brauchbares Instrumentarium entwickelt, Antisemitismus zu bestimmen. Dabei geht es immer um Kritik am Juden als »Juden«.148 Er lehnt eine Eins-zu-Eins-Relation zwischen Kritik an israelischer Politik und Antisemitismus ebenso vehement ab, wie Henryk Broder sie befürwortet.
Akzeptierten wir die Argumentation des letzteren, dann wäre Israel der einzige Staat auf der Welt, dessen Politik vor jeder Kritik gefeit wäre. Und das käme einer Sonderstellung gleich, wäre also genau der doppelte Maßstab, den ein Natan Sharansky vorgeblich kritisiert – denn er kritisiert einen Doppelstandard nur, wenn er Israel zum Nachteil gereicht, nicht wenn das Messen mit zweierlei Maß Gleichberechtigung verhindert (siehe unten).
In der Tat ist ein Infragestellen des Existenzrechts Israels abzulehnen, bei allem Unrecht, das bei seiner späten Gründung geschah. Zeitgemäß und konstruktiv wäre es, die gegenseitige Anerkennung eines Existenzrechts für Israel und Palästina vorauszusetzen und davon ausgehend die Möglichkeiten eines friedlichen Zusammenlebens aller Menschen vor Ort zu stärken.149 Um einen nichtinstrumentellen Gebrauch des Begriffs Antisemitismus zu fördern, gilt es also zu klären, welcher Sachverhalt tatsächlich vorliegt.
Wer Sharanskys »drei Ds« kennt, die er weitestgehend undefiniert in die Debatte zur Bestimmung von Antisemitismus einwirft, erkennt sie als zugrundeliegender Teil der EU-Arbeitsdefinition. Dem Politiker ist es weitestgehend gelungen, die Begriffe »Dämonisierung«, »Doppelstandards« und »Delegitimierung« Israels als sogenannten »3D-Test für Antisemitismus« einzuführen.150 Unter »Dämonisierung« führt er vor allem Beispiele von Vergleichen israelischer Regierungs- oder Militärpraxis mit Nazimethoden an (siehe unten). Als Doppelstandard gilt jede Kritik an israelischer Politik, die nicht im gleichen Atemzug auch andere Länder erwähnt – ungeachtet dessen, ob Kritiker dies in anderem Kontext eventuell tun. Der Begriff der »Delegitimierung« spielt wiederum auf eine Infragestellung des »Existenzrechts« für Israel an und kann sehr weit gefasst werden, wie wir noch sehen werden.
Sharansky selbst wird wiederum nicht von ungefähr vorgeworfen, dass er seine berechtige Kritik an Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine nicht für vergleichbare Erfahrungen von Palästinensern gelten lässt, sondern diesen im Gegenteil ihre Unrechtserfahrungen schlichtweg abspricht und deren Benennung als einseitige Kritik an Israel – und somit als Antisemitismus – wertet. Insofern wäre zu prüfen, ob der doppelte Standard eventuell genau dort zu finden ist, wo Sharansky ihn gerade nicht sucht – worauf wir noch einmal in Bezug auf den neuralgischen Punkt Nahostkonflikt und die Boykottkampagne BDS gegen Israel eingehen werden (siehe unten).
Die aktuellen Definitionen reichen nicht nur nicht aus, um Antisemitismus festzumachen, sie stiften eher noch zusätzlich Verwirrung und sie erweisen der Antisemitismusforschung einen Bärendienst. Während das Plädoyer, in Zeiten der Tabuisierung von Antisemitismus verdeckte Chiffren und Codes ausfindig zu machen, die sich hinter Kritik an israelischer Politik verstecken könnten, mehr als berechtigt ist, zeugt das Faktum, dass Gutachten des ZfA bei Debatten um möglicherweise antisemitische Lehrende an Hochschulen für Klärung sorgen müssen, davon, dass mehr Unsicherheit und Unverständnis herrschen als je zuvor (siehe unten).
Der Unabhängige Expertenkreis Antisemitismus des Bundestages stellte in seinem ersten Bericht 2011 weitere Forschungs- und Bildungslücken fest, auch mit Blick auf Antisemitismus in der Einwanderercommunity.151 In der Tat ist ein Umschlagen von Kritik am Umgang mit dem Nahostkonflikt in verallgemeinernde Zuweisungen auf »die Juden« oder auch »die Muslime« zu beobachten. Diese komplexe Gemengelage mit und ohne Rückbezug auf Ereignisse in Israel-Palästina muss in einem eigenen Kapitel erörtert werden (siehe Kapitel 5). Dass antisemitische Einstellungen in einer Größenordnung von circa zwanzig Prozent (oder mehr) in der Bevölkerung verankert bleiben, belegt die nach wie vor fehlende Auseinandersetzung mit den Mechanismen eines solchen Konstrukts. Dies könnte erklären, warum zu Zeiten von Globalisierung und Wirtschaftskrisen wieder die alte Mär vom »jüdischen Finanzhai« bemüht wird.
Für kaum noch Aufsehen sorgen anscheinend antisemitische Ausfälle im Alltag, wie die ausschließlich an Juden gerichtete Aufforderung in einem Schweizer Hotel, sich vor der Benutzung des Schwimmbades zu duschen.152 Ein anderer zeitgenössischer Beitrag geht der Frage nach »Wie wurden amerikanische Juden so reich?«153 Auf unseren Einwand hin, dass dieser Beitrag antisemitisch sei, weil er nur reiche Juden fokussiere und eine Verallgemeinerung impliziere, wurde mit dem Hinweis gekontert, dass der Autor selbst Jude sei und die Zahlen den Tatsachen entsprächen. Das mag sein, aber es erinnert an Stellungnahmen Otto Glagaus, der ja auch nur Fakten berichtet hatte, als er in der Wirtschaftskrise 1873/74 lediglich die jüdischen Akteure als solche besonders betonte (siehe oben).
Nazi-Vergleiche bergen immer und überall die Gefahr einer Verharmlosung der Diktatur des Nationalsozialismus. Auch wenn nicht immer eine absolute Gleichsetzung gemeint ist, so relativieren sie in gewisser Weise die Verbrechen des Nationalsozialismus oder setzen heutige Akteure mit den Nationalsozialisten gleich. Das ist in jedem Fall zu kritisieren, nicht nur in Bezug auf Israel. Angesichts der sehr unterschiedlichen Reaktionen auf solche Vergleiche muss jedoch gefragt werden, warum eine Gleichsetzung in bestimmten Kontexten toleriert und in anderen verurteilt wird. So kursierten in der Vorbereitung auf die Kriege in Irak und Libyen Fotoreihen von Saddam Hussein und Muammar al-Gaddafi mit Adolf Hitler. Solche sinn-induktiven Anspielungen gehören zur Kriegspropaganda, sie personifizieren und dämonisieren einen Gegner – was in vielen Medien lange nicht hinterfragt wurde.
Auch im Kontext von Antisemitismus und Nahostkonflikt gibt es immer wieder Anspielungen auf oder gar Gleichsetzungen mit der NS-Zeit. Wenn diese vonseiten der Kritiker an der israelischen Politik kommen, werden sie auch verurteilt. Oft genug bleiben sie aber unkommentiert, wenn sie vonseiten sogenannter »Israel-Freunde« kommen: Nazi-Anspielungen in Bezug auf Muslime oder Palästinenser werden vergleichsweise toleriert.
Es kann hier nicht darum gehen, die Nazi-Vorwurfs-Schmetterer gegen Israel als harmlos abzutun oder überhaupt Gleichsetzungen mit dem Naziregime für angemessen zu erachten – ganz im Gegenteil. Gäbe es hier mehr Sensibilität, hätte Joschka Fischer 1999 als Außenminister Deutschlands nicht mit dem Ausspruch »Nie wieder Auschwitz!« in Anspielung auf »Konzentrationslager« auf dem Balkan für den Eintritt Deutschlands in den Kosovokrieg werben können. Ein Aufschrei gegen die Gleichsetzung von Massakern im Balkankrieg mit dem Holocaust, wie es zu erwarten gewesen wäre, blieb hier aus. Irritierend ist tatsächlich, dass einige derartiger Gleichsetzungen in unseren öffentlichen Debatten erlaubt, andere verpönt zu sein scheinen.
NS-Vergleiche in Bezug auf das Regime Saddam Husseins verursachten ganz andere Reaktionen als jene, die etwa Hertha Däubler-Gmelin gegen George Bushs Kriegspolitik vorbrachte. Und es ist nach wie vor möglich, dem Iran die Planung eines »atomaren Holocaust« in Anspielung auf seinen Willen zur Bekämpfung Israels zu unterstellen – auch hier wird der Vergleich im Mainstream nicht inkriminiert, obwohl dieselbe geschichtsrevisionistische Qualität enthalten ist. Bei den beispielhaften Gegenüberstellungen wird bereits das Messen mit ungleichem Maß deutlich.
Was aber, wenn Israelis in Israel selbst von der Anwendung von »Nazi-Methoden« sprechen? All diejenigen Israelis, die eine Diskussion hierüber führen, können natürlich ebenso wenig ignoriert werden, wie man sie als Kronzeugen missbrauchen darf. So gibt es israelische Offiziere, die die Taten der Israeli Defense Forces (israelisches Militär, kurz IDF) mit der Bezeichnung »Nazi-Methoden« kritisierten. Sie wollten nicht mitmachen bei Kennzeichnungen verdächtiger Palästinenser, Verhaftungen auf Verdacht und der Kriminalisierung Minderjähriger bei Razzien in Palästinensergebieten oder militärischen Auseinandersetzungen im Südlibanon. Dass solche Debatten in Israel stattfinden, ist ein Fakt. Deshalb sind sie noch lange nicht als solches auszuwählen und in »Kronzeugenfunktion« breitzutreten.
Die innerisraelische Diskussion, ob man nicht etwa an den vielen Kontrollpunkten, bei Verhaftungen oder Liquidierungen »nazi-ähnliche Methoden« anwende, kann nicht einfach nach Deutschland übertragen werden.154 Denn durch den Kontextwechsel von Aussagen und Textbruchstücken findet immer auch ein Bedeutungswandel statt. Durch den Wechsel des Diskursumfeldes ändern die Äußerungen ihre Bedeutung. Solche Vergleiche hinken nicht nur in Israel, auch wenn sie psychologisch zu erklären und wichtig sind, vor allem hinkt die Übertragung in ein anderes semantisches Umfeld, weil es die Bedeutung der Aussage verändert.
Während in Israel solche Überlegungen eine kritische Selbstreflexion bedeuten und zu einer kritischen Diskussion animieren sollen, übernimmt das gleiche Zitat vor dem historischen Hintergrund von Nationalsozialismus und Holocaust in Deutschland eine relativierende, ja gar verharmlosende Rolle nach dem etwas zugespitzten Motto »Na, wenn die das auch machen, dann war es ja nicht so schlimm« oder »Na, wenn die das selbst sagen, dann darf ich das ja auch meinen«. Diesen Fehler beging Jamal Karsli, ein deutsch-syrischer Politiker, als er 2002 anlässlich einer Großdemonstration in Berlin genau diese Worte wählte – in der Gewissheit, dass er israelische Offiziere zitierte. Diese Übertragung ist aber nicht harmlos.
Anders formuliert könnte die Fehlinterpretation folgendermaßen klingen: »Nazis vernichteten Juden, wenn nun andere und gar noch Juden so etwas auch tun, dann sind die eben auch nicht besser…« – damit wird das Ungeheuerliche relativiert. Dies mag einigen Deutschen zur Schuldabwehr dienen. Dann werden verallgemeinernde Sätze, wie »Die haben doch so viel Leid erlebt, die sollten doch erkennen…« plausibel und nicht ob ihrer rassistischen Implikation enttarnt. Denn »die«, die jetzt handeln, waren es ja nicht. Es gibt kein homogenes Kollektiv, weder auf Täter- noch auf Opferseite, und die Umkehrung von Täter-/Opferkollektiven macht vor allem eines deutlich: Die Grundstruktur von homogenisierender Gruppenwahrnehmung mitsamt ihrer Vorurteilsstrukturen wurden nicht erkannt.
Was Schuldabwehr für die einen bedeuten kann, kann für die anderen einem wichtigen Alarmsignal gleichkommen. Denn die Ungeheuerlichkeitsvorstellung fungiert für viele als eine Art psychologische Versicherung – eine Art Abschreckungsgarantie. So als könnte vergleichbar Ungeheuerliches gar nicht mehr geschehen. So, als wäre man gefeit, sowohl vor Erleidenmüssen, als auch vor Ausführenkönnen. Der Verlust eines solchen Sicherheitsgefühls, einer vermeintlichen Garantie durch die Betonung der Ungeheuerlichkeit, ruft erhebliche Ängste hervor. Während vorschnelle NS-Gleichsetzungen also in jedem Fall – und nicht nur in Bezug auf Israel – abzulehnen sind, weil sie eine historische, besonders drastische Situation verharmlosen, macht es trotzdem einen Unterschied, wer diese in welchem Kontext anbringt.
Ein weiterer Aspekt der verknüpften Wahrnehmung von Nationalsozialismus mit Antisemitismus und Holocaust ist der, den Hajo Meyer in seinem Buch mit dem provokanten Titel Das Ende des Judentums kritisiert. Wenn wir mit Antisemitismus ausschließlich den Holocaust assoziieren, dann verstelle das den Blick auf die verbale Erniedrigung und Entmenschlichung der Juden in den Dreißigerjahren, die Meyer persönlich erlebt hat. Hier setzt sein Vergleich mit aktuellen Propagandatexten etwa in israelischen Medien in Bezug auf Palästinenser an – denn die dehumanisierende Metaphorik sei die gleiche. Was bei Meyer fehlt, ist der Verweis, dass diese Metaphorik überall zu finden ist, nicht nur in Israel, sondern auch in palästinensischen Medien, in Bezug auf Israelis oder gar Juden und in deutschen und anderen in Bezug auf andere Outgroups ebenso.
Der Einsatz von Metaphern – etwa einer Krankheitsmetaphorik, wie sie in dem Begriff »Krebsgeschwür« angelegt ist – ist gängige politische Rhetorik zur Dämonisierung des jeweils ausgemachten Feindes. Allerdings ist Meyers besonders hoher Anspruch an einen jüdischen Staat als Erbe einer großen jüdischen Kultur problematisch. Dieser verbleibt wiederum in einer Markierung des Jüdischen, wenn auch hier im positiven Sinne gemeint. Auch hier liegt eine Verallgemeinerung vor. Warum aber sollten jüdische Staatsbürger/Politiker/Militärs kollektiv besser, also anders, sein als andere? Jede Verallgemeinerungstendenz und Markierung birgt schon den Keim der Andersbehandlung in sich, der dann – je nach Zeitgeist – mal in die eine, mal in die andere Richtung ausschlagen kann. Ein Verzicht auf diese Markierungen bedeutet: So wenig wie es Kollektivschuld gibt, kann es Kollektivopfer geben.
Das heißt nicht, dass damit historische Verantwortlichkeiten aufgelöst werden sollen. Diese Verantwortung bedeutet aber die Anwendung humaner Prinzipien auf alle Menschen und nicht wieder nur selektiv in Bezug auf wenige. Wer heute ausschließlich für Juden als Diskriminierte eintritt, weil es die Verfolgung der Juden gab und gibt, der betreibt von philosemitischer Seite her das Geschäft der Antisemiten: Die Gruppe der Juden wird damit isoliert und als Kollektiv entweder positiv oder negativ bewertbar gemacht.
Gerichtsstreitigkeiten wie die um Henryk M. Broder und den Verleger Abraham Melzer Anfang 2006 und in Folge zwischen Broder und dem Gericht in Frankfurt drehen sich um eine Gleichsetzung bestimmter Praktiken in Israel mit Praktiken, die aus dem Nationalsozialismus bekannt sind. Wie emotional hier von Seiten der Protagonisten verhandelt wird, macht sich unter anderem daran deutlich, dass das Buch Hajo Meyers von Broder in unflätigster Art und Weise wegen »Nazi-Vergleichen« abgetan wurde, obwohl Broder den Autor genau mit solchen Vergleichen selbst herabzusetzen versuchte. Ähnlich relativierend positioniert sich Mathias Döpfner, der in mindestens zwei Beiträgen seiner Tagezeitung Die Welt einen Philosemitismus an den Tag legte und dabei gleichzeitig mit Mustern, die aus dem Antisemitismus bekannt sind, auf Muslime (als einzige Antisemiten) verwies. Immerhin wurde 2019 seine Rechtfertigung für rechtsradikales Denken durchschaut und er stieß nach dem Mord an Walter Lübcke und dem Anschlag auf Synagoge und Dönerladen in Halle auf Kritik.155
Konsequent und emotional setzte sich Broder seinerzeit gegen das Gerichtsurteil zur Wehr, indem er mit Blick auf die urteilenden Richter auf die Erbschaft der »Enkel Freislers« hinwies – also einen Verweis auf eine Verbindung zwischen Roland Freisler, dem Präsidenten des NS-Volksgerichtshofes, und den heutigen deutschen Gerichten herstellte. Folgt man Broders Verbalausfällen, dann würde das in Bezug auf das Thema bedeuten: Ein Nazi-Vergleich gegen Israel ist Antisemitismus, ein Nazi-Vergleich im (vermeintlichen) Sinne Israels, also israelischer Politik, wäre demnach keiner und auch keine Relativierung des Holocaust. Israel wäre demnach das einzige Land, auf den ein Nazi-Vergleich nicht angewandt werden darf. Das wäre nicht nur ein Doppelstandard, sondern auch eine erneute Markierung, die wieder negativ auf die markierte Gruppe der Israelis, oder verallgemeinernd »die Juden«, zurückfallen kann – gemäß der Unterstellung von Macht und Verschwörung, so als könnten israelische oder jüdische Protagonisten die gesamte Kommunikation kontrollieren.
Derlei Auseinandersetzungen zeigen, wie hochsensibel dieses Thema ist und wie dies eine konstruktive Auseinandersetzung mit der Thematik erschwert. Der Vorwurf eines »jüdischen Selbsthasses« (gegenüber jüdischen Kritikern der Politik Israels) und der Antisemitismusvorwurf stehen immer schneller im Raum und das forciert dessen Missbrauch und inflationären Gebrauch.156 Gleichzeitig wird Antisemitismus an anderer Stelle gar nicht wahrgenommen: Nur so lässt sich erklären, warum manche Schriften unkritisiert bleiben, deren Existenz angesichts der Tatsache, dass die (anti-)jüdische Weltverschwörungstheorie inzwischen zumindest offiziell verpönt ist, verwundert. So etwa Gencode J von Udo Ulfkotte, in dem der Autor eine als Fiktion getarnte antisemitische Verschwörungstheorie ohnegleichen konstruiert. Er beschreibt Machenschaften des Mossad sowohl in Nahost als auch in Europa, die nahelegen, dass die wirkliche Politik hinter den Kulissen der öffentlich werdenden Debatten in Israel gemacht wird. Während der Mossad-Agent Abraham Meir sowohl innerhalb des Dienstes als auch nach seiner unehrenhaften Entlassung die Fäden einer Verschwörung zieht, wird diese gezielt Osama bin Laden und einem islamistischen Netzwerk in die Schuhe geschoben und die Weltöffentlichkeit glaubt es. Und während sie sich durch falsch gestreute »Informationen« hinters Licht führen lässt, verfolgt Meir – in seinem religiösen Wahn vom heiligen jüdischen Land – die Verseuchung der Erde mit Pesterregern, die in israelischen Labors gentechnisch so manipuliert wurden, dass sie die Mitglieder des jüdischen Priestergeschlechts Kohanim verschonen sollen.
Kaum zu glauben, dass ein solches Pamphlet nicht die Aufmerksamkeit von Netzwerken wie Honestly Concerned & Co. auf sich zieht, die sich ja auf die Fahnen geschrieben haben, Antisemitismus zu bekämpfen. Antisemitismusdebatten scheinen sich inzwischen vermehrt auf andere Aspekte zu verlegen, wie die oben erwähnten Definitionen bereits andeuteten und wie wir im Kapitel zum Nahostkonflikt noch sehen werden.
Im Herbst 2017 hat die Bundesregierung beschlossen, sich der Antisemitsmusdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) anzuschließen. Im ersten Teil der Definition heißt es richtig:
»Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die im Hass auf Juden Ausdruck finden kann. Rhetorische und physische Manifestationen von Antisemitismus richten sich gegen jüdische oder nicht-jüdische Individuen und/oder ihr Eigentum, gegen Institutionen jüdischer Gemeinden und religiöse Einrichtungen.«157
Gleich im Anschluss daran wird betont, dass Manifestationen auch die Fokussierung auf den Staat Israel sein könne, wenn er als jüdisches Kollektiv wahrgenommen werde. Der letzte Halbsatz scheint inzwischen in Vergessenheit geraten zu sein, denn die Definition wird bisweilen genutzt, jede Kritik an israelischer Politik zu diskreditieren.158
Zunächst kann eine Errungenschaft der Antisemitismusforschung nicht genug gewürdigt werden, die wir uns an dieser Stelle noch einmal vergegenwärtigen wollen: Es ist gelungen, dass das Phänomen des Antisemitismus losgelöst vom Judentum und seiner religiösen Lehren behandelt wird. Denn ein Ressentiment verweist immer auf die Ressentimentträger und ihre Wahrnehmung. Der Rassismus ist das Konstrukt des Rassisten und hat wenig bis nichts mit dem behaupteten Grund seiner Existenz, dem Abgelehnten, dem Projektionsbetroffenen, zu tun. Darum ist die Konstruiertheit der Vorstellungen eines Antisemiten in den Blick zu nehmen und nicht etwa die Betrachtung »jüdischer Eigenarten«. Letzteres entspräche wiederum dem lange kultivierten Mechanismus der Antisemitismusleugnung, die Aufmerksamkeit auf den Beschuldigten zu richten – denn diese »Eigenarten«, Sitten und Gebräuche sowie Lehrsätze der jüdischen Schriften, gab und gibt es ja tatsächlich.
Wenn auch heute kein Rückbezug auf jüdische Quellen, die fast niemand mehr kennt, weil sie weitestgehend aus der Diskussion verschwunden sind, genommen wird, so gibt es nach wie vor antisemitische Einstellungen und Äußerungen, wie wir bereits versucht haben, mit einigen Beispielen zu illustrieren. Wie tief jedoch der Verschwörungsgedanke, die Idee eines »jüdischen Agierens im Hintergrund« noch vorhanden ist, hat selbst die Autorin dieser Buchpassage noch überrascht.
Anlässlich der Gründung der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft (DPG) in Nürnberg vor einigen Jahren machte ich den Einwand geltend, dass es nicht mehr zeitgemäß sei, eine Organisation für »eine Seite« zu gründen, und man lieber eine Gesellschaft zur Überwindung des Antagonismus in Israel-Palästina gründen sollte. Um es mit Amos Oz zu sagen: »Ihr Deutschen sollt euch nicht für eine Seite entscheiden, ihr müsst für den Frieden sein und den kann es nur für alle geben!«159 Eine Deutsch-Palästinensische Gesellschaft hätte ihren Gegenpart in der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und würde damit den Gegensatz, den diese Lobbyorganisation gerne pflegt, fortsetzen. Mein Vorschlag wurde abgelehnt. Nach der Gründungsversammlung kam eine alte Dame zu mir und flüsterte: »Lassen Sie doch die Juden da draußen. Sie wissen doch, was passiert, wenn die Juden wieder alles in die Hand bekommen.« Diese Schilderung soll nicht dazu verleiten, allen Mitgliedern der damals tatsächlich gegründeten DPG diese Einstellung zu unterstellen. Wie nachhaltig so manche Verschwörungstheorie aber wirken kann, macht sich genau an dieser alten Dame fest.
Die Aufgabe, Antisemitismus zu bekämpfen, bleibt gegeben: Und sie darf sich auch nicht von den Verwirrungen um unberechtigte Antisemitismusvorwürfe entkräften lassen. Falsche Antisemitismusvorwürfe gibt es auch – aus Unverstand oder böser Absicht – und diese werden wir im Verlaufe dieses Buches noch erörtern. Nur eine aufrichtige Herangehensweise kann die vielen zu berücksichtigenden Aspekte und Facetten zu einem Gesamtbild integrieren – ohne einen Teil des Geschehens auszublenden – wohlwissend, dass man mit einer solchen Präzisierung sowieso nur diejenigen erreichen kann, die ein ehrliches Anliegen haben.
Anmerkungen
1 Andics 1965, S. 6.
2 Vgl. Hortzitz 1988, S. 173; Benz 2020.
3 Vgl. Mann 1962, S. 17; Meyer 2005.
4 So die Begründung für den Angriff des Deutschen Reiches auf Polen am 01.09.1939.
5 Subjektives Empfinden, das verstärkt werden kann durch ein kollektives Erlebnis.
6 Vgl. Kipling 1940, S. 323 f.
7 So auch Arbeiten zu Kriegsbegründungsdiskursen u. Ä., wie sie etwa die Arbeitsgruppe um Wilhelm Kempf durchgeführt hat: Vgl. Kempf 1994; vgl. auch Becker & Beham 2008 und WDR 16.11.2010.
8 Vgl. Mann 1962; Andics 1965, S. 314; Strauss & Kampe 1985; Katz 1989; Benz & Bergmann 1997; Goldhagen 1998.
9 Vgl. Katz 1989, S. 271.
10 Vgl. ebd., S. 287.
11 Vgl. ebd., S. 313.
12 Vgl. Brockhaus 1992.
13 Vgl. etwa Balibar & Wallerstein 1990; Matouschek 1992.
14 Vgl. Langaney 1990; siehe differenzierter Mayr 2005; vgl. auch die Initiative des Instituts für Menschenrechte, den Begriff »Rasse« im Diskriminierungsverbot in Artikel 3 des Grundgesetzes durch das Verbot »rassistischer« Benachteiligung zu ersetzen.
15 Vgl. van Dijk 1993, S. 80f; vgl. auch Wodak u. a. 1990.
16 Zit. nach Riepe 1992, S. 167.
17 Vgl. Tajfel 1978; ders. 1978b; Link 1993.
18 Vgl. Tajfel 1978.
19 Vgl. Hortzitz 1988, S. 119.
20 Vgl. Katz 1989, S. 254 f.
21 Glagau 1876, S. 148.
22 Glagau startete im Dezember 1874 eine Artikelserie in der Gartenlaube mit dem Titel »Der Gründer- und Börsenschwindel« (vgl. ebd., S. 256).
23 Vgl. ebd., S. 257.
24 Lakoff & Wehling 2008.
25 Siehe Beschluss des Presserats zur Änderung der Richtlinienergänzung 12.1 auf Druck von rechts in: Presserat o.D.; vgl. auch unsere Stellungnahme zum Erhalt der Richtlinienergänzung 12.1 sowie einer Erweiterung um 12.2, um Sinn-induktive Verknüpfungen durch die Bebilderung von Texten zu reflektieren: https://www.medienverantwortung.de/wp-content/uploads/2009/07/PM_08-05-13_Richtlinienerg_Presserat_12-1_12-2.pdf, aufgerufen am 31.08.2021.
26 Vgl. Schiffer 2005.
27 Sow 2009, S. 42.
28 Vgl. Andics 1965, S. 47f; vgl. auch die Diskussion in Israel um die von Shlomo Sand behauptete »Schaffung der Volksidee« in seinem Buch Wann und wie das jüdische Volk erfunden wurde.
29 Zit. nach Hortzitz 1988, S. 61.
30 Vgl. Kalpaka & Räthzel 1990; Winkler 1994.
31 Siehe auch den Begriff »Bi-Polarität«, den Jürgen Link synonym verwendet (z. B. in Jäger & Halm 2007).
32 Vgl. Freire 1973; Flohr 1991.
33 Vgl. Henley 1977; Link 1993.
34 Zit. nach Katz 1989, S. 257.
35 Vgl. Andics 1965, S. 286.
36 Ebd., S. 102.
37 Vgl. ebd., S. 164, 192.
38 Hortzitz 1988.
39 Vgl. beispielsweise Dichanz u. a. 1997; Hafez 1999.
40 Vgl. Katz 1989, S. 315.
41 Riepe 1992.
42 Christian Wilhelm von Dohm ist der Autor des einflussreichen Buchs Über die bürgerliche Verbesserung der Juden, das 1781 veröffentlicht wurde (hier zit. nach Goldhagen 1998, S. 80).
43 Benz 2010, S. 17 ff.
44 Dabei gibt es keine allgemein anerkannte Definition des Begriffs Antisemitismus. Das European Monitoring Centre against Racism and Xenophobia (EUMC) schlägt in einem Paper von 2005 vor, unter dem Begriff Antisemitismus sowohl bestimmte Wahrnehmungsweisen von Juden als auch rhetorische und physische Manifestationen dieser Einstellungen zu verstehen. Das EUMC gibt ferner einige Beispiele für Antisemitismus. Dazu zählt, »die Juden« für die Handlungen einzelner jüdischer Personen verantwortlich zu machen, ihnen Illoyalität vorzuwerfen, den Holocaust als eine Erfindung der Juden darzustellen und mehr. Vgl. EUMC 2005: Working Definition of Antisemitism, http://fra.europa.eu/fraWebsite/material/pub/AS/AS-WorkingDefinition-draft.pdf. Die Arbeitsdefinition des EUMC wurde von anderen Organisationen wie der OSZE übernommen.
45 Vgl. Katz 1989, S. 236 f.
46 Ebd., S. 327.
47 Vgl. Rosch 1977; Lakoff 1987.
48 Vgl. Mann 1962, S. 9; Hortzitz 1988; Goldhagen 1998; Schubert 2002, S. 25 f.
49 Vgl. Goldhagen 1998, S. 76.
50 Vgl. Hörmann 1976; ders. 1977; Grice 1975; Meggle 1977; Trömel-Plötz 1991, S. 50.
51 Vgl. Andics 1965; Katz 1989; Benz & Bergmann 1997; Goldhagen 1998.
52 Vgl. Silbermann & Schoeps 1986.
53 Vgl. Andics 1965; Katz 1989, S. 207 f.
54 Vgl. Schiffer 2005, S. 33 f.
55 Vgl. Katz 1989, S. 240.
56 Hortzitz 1988, S. 120 f.
57 Vgl. Dichanz u. a. 1997.
58 Vgl. Andics 1965; Hortzitz 1988; Katz 1989; Benz & Bergmann 1997; Goldhagen 1998; Schubert 2002.
59 Vgl. Honegger 1991; Balibar & Wallerstein 1990; Horkheimer & Adorno 1981, S. 192 f.
60 Vgl. Goldhagen 1998, S. 77.
61 Vgl. Noack 2001, S. 79 f.
62 Hortzitz 1988, S. 265.
63 Vgl. Schiffer 2008.
64 Vgl. Katz 1989; Mann 1962, S. 9f, 31 f.
65 Vgl. Schiffer 2005, S. 143 f.
66 Vgl. Lakoff & Johnson 1980; Link 1991; Goldhagen 1998, S. 89.
67 Vgl. Lakoff & Johnson 1980; Link 1991; Andics (1965) verwendet selbst den problematischen Begriff »Wirtsvolk«, der unreflektiert eine Parasitenmetaphorik stützt.
68 Vgl. Walther 1921, S. 5. Ganz entscheidend bei diesem Wissenschaftler ist jedoch, dass er neben dem Plädoyer für eine Rehabilitation des sogenannten Alten Testaments und Luthers gleichzeitig auch eines für die Bekehrung der Juden hält – die Seelen einiger weniger von ihnen könnten durch die Bekehrung zum richtigen Glauben gerettet werden. Demnach sind für Walther also durchaus die »charakterschwachen« Juden die Regel – nur dass eben deren »Schwäche« nicht am Alten Testament festzumachen sei.
69 Vgl. Noack 2001, S. 69 ff.
70 Katz 1989, S. 91.
71 Vgl. Volkov 1994.
72 Vgl. Katz 1989, S. 151.
73 Hortzitz 1988, S. 244.
74 Vgl. Mann 1962; Andics 1965.
75 Andics 1965, S. 208 f.
76 Vgl. Scheufele 2003.
77 Döllinger 1947, S.15.
78 Vgl. Katz 1989, S. 192.
79 Vgl. Andics 1965, S. 164 f.
80 Vgl. Katz 1989, S. 62.
81 Vgl. Andics 1965, S. 211 f.
82 Vgl. Eisner 2005.
83 Vgl. ebd., S. 239.
84 Vgl. Hortzitz 1988; Katz 1989; Benz & Bergmann 1997; Goldhagen 1998.
85 Zit. nach Katz 1989, S. 205.
86 Vgl. Hortzitz 1988, S. 239.
87 Vgl. Katz 1989; Benz & Bergmann 1997.
88 Zit. nach Katz 1989, S. 186 f.
89 Dies ist ein typisches Merkmal eines Ausgrenzungsdiskurses (vgl. Müller 1988).
90 Vgl. Andics 1965; Benz & Bergmann 1997, Schiffer 2005.
91 Vgl. Katz 1989, S. 267.
92 Boehlich 1988.
93 Wie auch viele andere Widersprüche zugunsten vermeintlicher Kohärenz ausgeblendet wurden. Vergessen war auch ein Moses Mendelssohn (1729-1786), mit dem in der Mitte des 18. Jahrhunderts Berlin zum Zentrum der jüdischen Aufklärung (Haskala) werden konnte.
94 Vgl. Tajfel 1982, S. 154 f.
95 Vgl. Katz 1989, S. 175 f.
96 Vgl. Mann 1962, S. 22 f.
97 Vgl. Katz 1989, S. 185 f.
98 Vgl. ebd., S. 270.
99 Goldhagen 1998, S. 86.
100 Vgl. ebd., S. 297 f.
101 Hafez spricht in diesem Zusammenhang von einem »Salonrassismus« (vgl. Hafez & Steinbach 1999, S. 77).
102 Vgl. Bergmann & Erb 1991; Hafez & Steinbach 1999.
103 Vgl. Andics 1965, S. 104.
104 Vgl. z. B. Said 1979; ders. 1997; Zimbardo 1995, S. 488f; Winkler 1994, S. 323.
105 Vgl. Andics 1965; Katz 1989, S. 250 f.
106 Vgl. Luckmann 1983, S. 45 (zit. nach Dichanz u. a. 1997, S. 43).
107 Vgl. Silverstein 2008, S. 88 f.
108 Vgl. Ahren u. a. 1990; Hornshøj-Møller 1995; Mannes 1999.
109 Vgl. http://www.shoa.de/content/view/250/41/; http://www.shoa.de/content/view/288/41/; Ahren u. a. 1990; Hornshøj-Møller 1995; Mannes 1999.
110 Vgl. Deuteronomium im Alten Testament (Kath. Bibelanstalt Stuttgart 1980, S. 166f; nicht wörtlich). Das Potenzial dieser Dekontextualisierung von authentischen Zitaten – also ihrer Verfremdung durch das Herauslösen aus dem Ursprungskontext – wurde ja bereits im Zusammenhang mit Eisenmengers und Grasers Zitierpraxis erörtert (siehe oben); vgl. Noack 2001 über August Rohling.
111 Vgl. Althaus 1993; ders. 2002.
112 Vgl. Katz 1989.
113 Stroebe übt Kritik an der »contact hypothesis«, da Intergruppenkontakt nicht automatisch positive Einstellungsveränderungen nach sich zieht. Denn auch hier liegt bereits eine kognitive Vorbereitung zugrunde, die zu lediglich oberflächlichen Toleranzen führen kann – wofür auch Katz (vgl. ebd., S. 241f) einige Beispiele liefert (vgl. Stroebe 1988, S. 161).
114 Vgl. Steinke 2020.
115 Vgl. Klemperer 1991; Tajfel 1978; ders. 1978b; ders. 1982.
116 Boehlich 1988.
117 Freiherr von Vincke im Vereinten preußischen Landtage 1847. Zit. nach Schrattenholz & Moleschott 1894, S. 564.
118 Domkapitular von Brandt bei Verhandlungen über die Judenemancipation im Vereinten preußischen Landtage 1847. Zit. nach ebd., S. 582.
119 Central-Verein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. Zit. nach ebd., S. 301.
120 Diese zum Teil gut gemeinte Kosten-Nutzen-Argumentation ist auch heute weit verbreitet – etwa in der »Ausländerthematik«. Dort wird etwa für Zuwanderung mit dem Verweis auf den Nutzen für unsere Sozialsystem, gesellschaftlicher Vielfalt als Möglichkeit der Kreativitäts- und Produktivitätssteigerung und Ähnlichem geworben. Sie verbleibt also in einem dualen System und übersieht leicht, dass der eine Pol – »der Nutzen ist höher als die Kosten« – bei leicht veränderten Vorzeichen immer und zu jeder Zeit in die entgegengesetzte Richtung umschlagen kann. Unhinterfragt bleibt auch, wer darüber definiert, wer wem nutzen soll.
121 Schrattenholz & Moleschott 1894, S. 437.
122 Kremer: »Kulturentlehnungen«. Zit. nach ebd., S. 457.
123 Schleiden 1879: Die Bedeutung der Juden für Erhaltung und Wiederbelebung der Wissenschaften im Mittelalter. Zit. nach ebd., S. 439.
124 von Sonsheim 1880: Zur Judenfrage. Zit. nach ebd., S. 494.
125 Schlosser 1844: Weltgeschichte für das deutsche Volk. Zit. nach ebd., S. 560.
126 Vgl. Bauer, Joachim 2006.
127 Hommel 1881: Die Semiten und ihre Bedeutung für die Kulturgeschichte. Zit. nach Schrattenholz & Moleschott 1894, S. 456.
128 Kosmopolitismus 1892: Die Lösung der Judenfrage. Zit nach ebd., S. 493 f.
129 Prof. Schleiden 1879: Die Bedeutung der Juden für die Erhaltung und Wiederbelebung der Wissenschaften im Mittelalter. Zit. nach ebd., S. 438.
130 von Sonsheim 1880: Zur Judenfrage. Zit. nach ebd., S. 494.
131 Kroner. Zit. nach ebd., S. 455.
132 Mook 1891. Zit. nach ebd., S. 511.
133 Laurent. In: Briefe christlicher Zeitgenossen. Zit. nach ebd., S. 523.
134 Ranzoni 1891. Zit. nach ebd., S. 515.
135 von Schlegel 1815: Geschichte der alten und neuen Litteratur. Zit. nach ebd., S. 560.
136 Henne. Zit. nach ebd., S. 456.
137 Bulthaupt 1891. Zit. nach ebd., S. 516 f.
138 Gleichsam ist darauf hinzuweisen, dass die Konzepte von Nation, Volk und Rasse, so wie sie im 19. und 20. Jahrhundert in Deutschland dominant sind, nicht identisch mit dem sind, was die jüdische Überlieferung als »Nation« oder »Volk« versteht. (Vgl. dazu auch die von Shlomo Sand neu entfachte Diskussion).
139 Vgl. Döllinger 1947.
140 Während er vor allem die Geschichte des Mittelalters fokussiert, verweist er auch auf die Andersstellung der Juden, schon lange vor dem Christentum. Die Ungleichbehandlung zeigte sich seiner Meinung nach auch in der sogenannten »Schutzgesetzgebung«, die ja nichts anderes als eine positive Andersmarkierung der Juden war. Allerdings wurde für die Nichteinhaltung der Schutzgesetze keine Strafe verhängt, während sonst »auch nur in geringfügigen Dingen Bann, Interdikt, Verfemung und andere drastische Mittel angedroht und verhängt wurden […]«. (Döllinger 1947, S. 11).
141 Vgl. Tajfel 1978a.
142 Dass eine Ingroup/Outgroup-Konstellation entsteht und dabei zur Identitätskonstruktion beiden Gruppen Merkmale zugeschrieben werden, kann in diesem Sinne als Reflex menschlicher Empfindungen verstanden werden. Anhand welcher Kriterien und Merkmale diese Gruppen konstruiert werden, was also darüber entscheidet, wer als »fremd«, »anders« oder gegebenenfalls »bedrohlich« wahrgenommen wird, ist keinesfalls »natürlich«, sondern hochgradig historisch kontingent und folgt vor allem den sozioökonomischen Bedingungen der jeweiligen Gesellschaft im Sinne der beschriebenen individualpsychologischen Entlastung und Legitimation von Abgrenzungsmechanismen.
143 Mann 1962, S. 36.
144 Vgl. etwa Rabinovici u. a. 2004; Heilbronn & Rabinovici 2019.
145 KSTA.de, 20.08.2011; vgl. auch Debattenstand in der Akademie für politische Bildung Tutzing im Akademie-Report 2/2011, S. 17 f.
146 Pfahl-Traughber, 16.06.2017.
147 Wien, 18.05.2005.
148 Vgl. Pollak 2008.
149 Vgl. Pappe 2007; Morris 1989; Avidan 2008.
150 Siehe »Anti-Semitism in 3D«. www.aish.com/jw/s/48892657.html (Website der Aish ha Torah, siehe unten).
151 Deutscher Bundestag, 10.11.2011.
152 o. a., 15.08.2017.
153 Goldstein, 11.09.2011.
154 Vgl. Nirgad 2005; Meyer 2005; Haaretz: verschiedene Ausgaben (siehe vor allem Amira Hass); siehe auch Shraga Elam in verschiedenen Schweizer Publikationen.
155 Vgl. Döpfner, 23.10.2011; ders., 11.10.2019.
156 Pollak 2008, S. 17f; vgl. auch Evelyn Hecht-Galinskis Antwort auf Arno Lustiger. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 26.9.2008, S. 44; vgl. Zuckermann 2018.
157 Zit. nach Botschaft des Staates Israel in Berlin, 02.06.2016.
158 Über den Streit und die Manipulationen rund um die IHRA-Definition informiert Joseph Croitoru in seinem lesenswerten Artikel in der Süddeutschen Zeitung vom 20. Juli 2020 unter dem Titel »Was ist Antisemitimus?« Auch das Buch von Kenneth Stern, einem der Mitgestalter der Antisemitismus-Definition und heute ein vehementer Kritiker ihrer Instrumentalisierung, verdient Beachtung: The Conflict Over the Conflict: The Israel/Palestine Campus Debate.
159 Sinngemäß nach seiner Stellungnahme im Erlanger Markgrafentheater beim Poetenfest 2005.