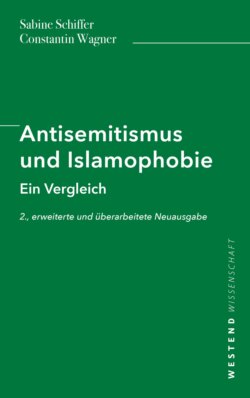Читать книгу Antisemitismus und Islamophobie - Sabine Schiffer - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort zur zweiten Auflage
ОглавлениеNicht zuletzt der antisemitische Anschlag in Halle am 9. Oktober 2019 hat gezeigt, dass der Hass gegen Juden virulent ist und die Relativierung rechtsradikaler Gesinnung schreckliche Früchte trägt. Aus Worten werden Taten; Hassrede on- oder offline muss in ihrer Menschenverachtung ernst genommen werden. Relativierung à la Extremismus- und Totalitarismusforschung ist unangebracht.1 Chauvinistische Menschenfeindlichkeit ist etwas anderes , als es links motivierte Gewalttaten sind, die darum nicht gutgeheißen werden müssen.
Nach dem Anschlagsversuch auf die Synagoge in Halle hat der Mörder zweier Menschen einen Dönerladen angesteuert. Sein sogenanntes Manifest offenbart entsprechend seiner rechtsradikalen Vorbilder, dass antimuslimischer Rassismus und antisemitische Weltverschwörungstheorien in den Köpfen von den sogenannten »white supremacists« verbunden sind und deren »Verteidigungstaten« eine angeblich höherstehende (nationalen) Identität legitimieren sollen.
Dass die beiden tatsächlich getöteten Opfer von Halle eine Passantin und ein junger Mann waren, der zufällig in dem Dönerladen aß, passt zu den chauvinistischen Einstellungen des Mörders, der in dem Kunden eines »Türken« einen »Volksverräter« sehen will und in Frauen durch feministische Bewegungen zu selbstbewusst gewordene Subjekte.
Max Czollek hat in seinem Gastbeitrag auf Spiegel-Online den genannten Zusammenhang auf den Punkt gebracht:
»An dieser Stelle zeigt sich einmal mehr diese deutscheste aller Weigerungen, anzuerkennen, dass es sich bei rechten Morden wie denen in Halle zwar um den Angriff eines einzelnen Mannes handeln mag, aber nicht um einen Einzeltäter. […] Wir sollten uns noch einmal vor Augen führen, was ein Rechtsextremer hier in aller Deutlichkeit demonstriert hat: Die neu-alten Rassisten meinen auch Juden. Wer ein Deutschland ohne Kanaken oder Muslime will, will auch eins ohne Juden.«2
Mit Ausnahmen wie der des Comedian Shahak Shapira, der in einem Tweet auf die Verbindung zwischen den Anschlagszielen hinwies, betonten die meisten Folgediskurse der Betroffenheit besonders die antisemitische Motivation des Rechtsterroristen. Das mag vor dem Hintergrund deutscher Geschichte verständlich sein und hat auch seine Berechtigung. Allerdings zeugt dieser Umstand auch davon, dass die Menschenverachtung ideologisch Verblendeter nicht mit gleichen Maßstäben gemessen wird – denn über den Antifeminismus und den antimuslimischen Rassismus des Täters wurde in der Folge kaum öffentlich debattiert. Ob die Bekämpfung von Hass, Hassrede und Gewalttaten aus Menschenhass erfolgreicher sein könnte, wenn man alle Rassismen gleichwertig behandelt, ist eine offene Frage, die es zu beantworten gilt.
Mit unserem hier neu aufgelegten, zuerst 2009 erschienenen Buch konnten wir zeigen, dass antijüdische und antimuslimische Diskurse vergleichbare Momente haben, dass sie beide fortbestehen und durchaus von denselben Ressentimentträgern gleichzeitig vertreten werden können. Zudem ist die Strategie durchschaubar, mit einer vermeintlich philosemitischen – weil vermeintlich israelfreundlichen – Haltung andere Ressentiments als irgendwie legitim erscheinen zu lassen.
Bei genauerer Betrachtung erscheinen Antisemitismus und Islamophobie als zwei Seiten der gleichen Medaille – allerdings weisen beide Phänomene auch Spezifika auf, die differenziert bewertet werden müssen. Ein Vergleich darf nicht mit Gleichsetzung verwechselt werden, und dieser verbietet sich auch im Hinblick auf die öffentlich und politisch dominanten Vernichtungsdiskurse der NS-Zeit. Ausgehend vom »sanfteren« antisemitischen Diskurs im 19.Jahrhundert, drängten sich jedoch einige Erkenntnisse auf, die für den Umgang mit aktueller Hate Speech wichtige Hinweise geben.3
Sabine Schiffer & Constantin Wagner, Frankfurt/Berlin im August 2021
Anmerkungen
1 Vgl. Berendsen, Rhein & Uhlig 2019.
2 Czollek 2019.
3 Vgl. Schüler-Springorum 2020.