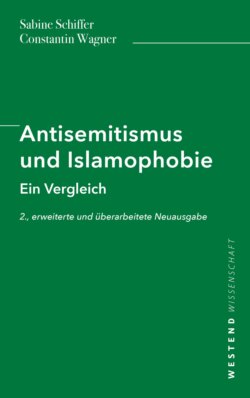Читать книгу Antisemitismus und Islamophobie - Sabine Schiffer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I.
Erinnern alleine reicht nicht – Überlegungen zur Mahnkultur »Holocaust« im Lichte aktueller Entwicklungen
ОглавлениеEs ist leichter, einen Atomkern zu spalten als ein Vorurteil.
(Albert Einstein)
Richtig Deutsch lernen sollten sie, sich sittlich benehmen und vor allem nicht auffallen in der Mehrheitsgesellschaft: die Juden im ausgehenden 19. Jahrhundert. Nicht nur die vielen Dokumente des Berliner Antisemitismusstreits um 1880 geben Aufschluss über die gängigen Argumentationsmuster der damaligen Zeit, aber sie machen die – lange davor und immer wieder danach – angebrachten Motive deutlich, beispielsweise die Angst vor einer Verschwörung oder sogar Weltherrschaft der »Anderen«. Genau diese Denkstrukturen sind heute in Ansätzen wiederzuerkennen, wenn Leitkultur und völkischer Nationalismus beschworen werden – übrigens mit teilweise durchaus ähnlichen Argumenten wie damals.
Das jährlich wiederholte Erinnern an den Nationalsozialismus, Zweiten Weltkrieg und Holocaust ist nur ein Teil dessen, was Menschen von heute der Geschichte, aber vor allem den Opfern von damals, schulden. Feststellbar ist jedoch eine gewisse Ritualisierung der Erinnerung, ihre drohende Erstarrung und Projektion in eine angeblich abgeschlossene Vergangenheit bis hin zu Tendenzen von Verdrängen wie in der ersten Generation und dem Vergessen in den nachfolgenden Jahrgängen. Aber auch und gerade die junge Generation sollte in die Lage versetzt werden, ähnliche Mechanismen zu erkennen.
Wer nachvollziehen möchte, wie man den Anfängen der Judenverfolgung hätte wehren können, darf nicht erst mit der Betrachtung der nationalsozialistischen Zeit beginnen. Wie die Analyse des antisemitischen Diskurses um 1880 zeigt, waren die antisemitischen Topoi schon lange vorher angelegt und entwickelten erst fünfzig bis sechzig Jahre später, wenn auch in einem vollkommen veränderten Kontext, ihr vernichtendes Potenzial.
Um also den Anfängen wehren zu können, muss die Entwicklung des antisemitischen Diskurses nachgezeichnet werden. In ihm schlummerte stets das Potenzial, zu eskalieren. Während die Vernichtungsformen und der entmenschlichte Zynismus der NS-Zeit kaum zu überbieten sind, macht die Analyse des antisemitischen Begründungsdiskurses Parallelen zu anderen rassistischen Diskursen deutlich. Antisemitische Denkformen sind nach wie vor virulent und auch wenn sie einige Spezifika aufweisen, die spezifisch antisemitisch sind und eine andere Logik als »herkömmliche« rassistische Diskurse haben, können sie strukturell wichtige Hinweise auf die Mechanismen diskriminierender Diskurse im Allgemeinen liefern.
»Verstehen-wollen« bedeutet dabei nicht, dass damit die Gräueltaten verständlich, erklärbar oder gar verzeihbar werden, ganz im Gegenteil: Aus der heutigen Perspektive gilt es, ein moralisches Urteil zu fällen, über das, was Menschen Menschen angetan haben. In der Retrospektive liegt neben der Chance aber auch die Tücke: Denn der Blick von heute auf gestern verstellt leicht den Blick auf morgen. Die Rückschau verhindert manchmal sogar zu erkennen, wie Menschen in einen Denkzyklus geraten konnten, der sie bereit dafür machte, andere zu vernichten oder auch »nur« Zuschauer zu sein. Es nützt niemandem etwas, wenn die Nachkriegsgenerationen sich staunend hinstellen und fragen, »Wie konnten die nur?« Dieses Statement bedeutet nur, dass man sich über die Dinge stellt und sich selbst für immun gegenüber rassistischem Denken und Handeln hält.
Eine solche Selbsteinschätzung würde bedeuten, dass sich die Menschheit ein für alle Mal für gefeit vor Diskriminierungen und Verletzungen der fundamentalen Menschenrechte hielte. Genau dieses Wiegen in Sicherheit ist aber eine Illusion. Das Wissen um die Ungeheuerlichkeit des Holocaust ist noch keine Garantie dafür, dass antisemitisches und rassistisches Denken nicht fortbesteht. Das Überleben des Antisemitismus trotz aller Aufklärungsversuche und der Ungeheuerlichkeit des Geschehenden belegt bis heute genau diese Schlussfolgerung.
Ohne jemals einen historischen Verlauf voraussagen zu können – der ja von vielen Variablen und Zufällen abhängig ist –, müssen die Gefahren ernster genommen werden, die in Diskriminierungsdiskursen lauern – ob antijüdisch, antimuslimisch, antiamerikanisch, antirussisch oder sich gegen irgendeine andere Gruppe richtend. Es ist eben nicht mit Sicherheit vorauszusagen, welche Elemente eines Diskurses jetzt oder in der Zukunft einmal wirksam werden, welche politischen und militärischen Konstellationen sich ergeben. Darum sind die Debatten um Hate Speech und Political Correctness auch gesellschaftlich relevant. Die Themen sollten weder zur Rechtfertigung rassistischer und menschenverachtender Äußerungen im Namen der Meinungsfreiheit noch zur Rechtfertigung von Zensurmaßnahmen unliebsamer Kritik an politischen Verhältnissen und gesellschaftlichen Entwicklungen missbraucht werden. Nur ein ehrliches Interesse an Klärung der Grenzziehung zwischen hass- und gewaltinduzierender Hetze und herrschaftskritischen Meinungsäußerungen kann hier Abhilfe schaffen.
Der Antisemitismus wurde schon oft für überwunden erklärt – doch er war und ist es nicht. Bestes Beispiel sind physische Angriffe auf Menschen, die als Juden erkennbar sind, die Lebendigkeit antisemitischer Vorstellungen – etwa angesichts der Finanzkrise 2008 – in manchen Raptexten oder Forenkommentaren im Internet. Dort wurde vielsagend über die »Ostküste« und eine »(jüdische) Hochfinanz« schwadroniert. Auch angesichts von Einlassungen jüdischer Organisationsvertreter zu politischen Fragestellungen sind einige zu schnell dabei, hier von »jüdischer Einflussnahme« auszugehen, ohne die verallgemeinernde Zuweisung der Aktivitäten Einzelner auf das gesamte Judentum selbstkritisch zu hinterfragen. Und wenn in dem ARTE-Dokumentationsfilm Die diskrete Verführerin über die Schauspielerin Lauren Bacall ihre »jüdische Herkunft« mit Bildern geldwechselnder Juden aus Osteuropa illustriert wird, dann bedient diese Anspielung bereits antisemitische Stereotype und ein stereotypes Framing.
Wenn Hannah Arendt angesichts der Ungeheuerlichkeit der industriellen Judenvernichtung und ihrer Diagnose von der »Banalität des Bösen« fordert, nicht bei der Denunziation des Übels und der Identifikation mit den Verfolgten stehen zu bleiben, dann bedeutet das auch, zu verstehen, dass Juden keinesfalls aufgrund ihres tatsächlichen Verhaltens gehasst wurden und werden. Antisemitismus ist also getrennt vom Judentum zu betrachten und eine Ausdrucksform der sogenannten Mehrheits- beziehungsweise Dominanzgesellschaft.
Und auch wenn in der Geschichte besonders exponiert und immer wieder Juden betroffen waren und sich der Hass auf vernichtende Weise gerade an Juden vollzog, können sich die Grausamkeiten auch bei anderen Gruppen von Menschen wiederholen: Unter anderen Bedingungen können andere getroffen werden – wie beispielsweise die systematischen Morde an den Herero oder den Armeniern belegen, aber auch die Massaker in Ruanda, Korea, Myanmar und Kolumbien, um nur einige wenige Beispiele aus dem Meer an besonders grausamen Menschenrechtsverletzungen aufzugreifen.
Viele unterhalb der Schwelle von physischer Gewaltanwendung bestehende rassistische Denk- und Verhaltensweisen sind dabei den weißen deutschen Mehrheitsangehörigen überhaupt nicht als »rassistisch« bewusst. Dies erklärt auch die Tatsache, dass die Mehrheit der Bevölkerung der festen Überzeugung ist, sich nicht rassistisch zu verhalten. Die 2011 erschienene Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung mit dem Titel Die Abwertung der Anderen zeigte einmal mehr, wie tief rassistisches Denken in dieser Gesellschaft vorhanden ist. So stimmten 30,5 Prozent der Befragten der Aussage »Es gibt eine natürliche Hierarchie zwischen schwarzen und weißen Völkern« zu.1 19,7 Prozent vertraten die Ansicht, Juden hätten in Deutschland zu viel Einfluss. Diese Aussage setzt auch die Vorstellung von Illoyalität gegenüber der Gesamtgesellschaft beziehungsweise die Vorstellung eines primären Bezugs zur »eigenen Gruppe« voraus. Folgerichtig waren 29,4 Prozent der Ansicht, Juden im Allgemeinen kümmerten sich um nichts und niemanden außer um ihre eigene Gruppe. Dem Satz »Bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man Juden nicht mag« stimmten 35,6 Prozent zu.2 46,1 Prozent derselben Befragten waren indes der Meinung, es gebe zu viele Muslime in Deutschland. Muslime in Deutschland stellten zu viele Forderungen, fanden sogar 54,1 Prozent.3 2021, zehn Jahre später, sehen die Zahlen nicht grundlegend anders aus: Über vierzig Prozent der Befragten folgen zumindest teilweise dem durch Akteure der Neuen Rechten verbreiteten Mythos einer Verschwörung durch den Islam, wenn sie der Aussage zustimmen »Die deutsche Gesellschaft wird durch den Islam unterwandert«.4 Über dreißig Prozent stimmen auch heute noch mindestens »teils/teils« der Aussage zu, dass man aufgrund der israelischen Politik verstehen müsse, dass manche etwas gegen Juden haben.5 Man bedenke, dass hier nur explizite Zustimmung oder Ablehnung in Bezug auf bestimmte Gruppen erfragt worden ist und Phänomene wie struktureller Rassismus und Antisemitismus gar nicht erfasst sind.
Eine Ablehnung des Vorhandenseins muslimischer und anderer Minderheiten verspüren – so zeigt sich hier einmal mehr – nicht nur Rechtspopulisten, sondern auch Personen, die sich gegen einen Rassismusvorwurf wehren würden. Rassismusleugnung ist seit jeher ein Teil des Rassismus. Eine besondere Form der Abwehr ist die »Maulkorbthese«, die ausgerechnet Meinungsführer wie Thilo Sarrazin bemühen. Um Kritik am Rassismus abzuwehren, wird diese Kritik als Versuch eines Redeverbotes gedeutet. Zwar gilt Meinungsfreiheit tatsächlich nicht für Rassismus und Volksverhetzung, dennoch stellt sich hier bei vielen schnell der Reflex ein, »man wird doch wohl noch sagen dürfen…«.6 Dieser Schleusenöffner, der als vermeintliche Tabuandrohung in Bezug auf eine sowieso nicht vorhandene Political Correctness daherkommt, schließt eine kritische Debatte, welche die Thesen wirklich prüft, von vornherein aus. Die Maulkorbthese geht häufig mit einem verschwörungstheoretischen Gedanken einher, in dem »die Anderen« bereits dafür gesorgt haben, dass man nicht mehr »seine Meinung« sagen dürfe.
Ein weiteres bewährtes Moment der Rassismusleugnung bietet im Falle von antimuslimischem Rassismus auch noch die Begriffsdiskussion über »Islamophobie«. Während man andere schiefe Begriffe wie »Antisemitismus« mitsamt ihrem teilweisen Missbrauch ignoriert, wird über eine Begriffsdebatte im Fall von Islamophobie das dahinter liegende Ressentiment selbst häufig infrage gestellt.
Noch schwieriger als ein weiteres Element der Rassismusabwehr erkennbar ist der Vorwurf der »Deutschenfeindlichkeit«, den etwa die ehemalige Bundesministerin Kristina Schröder schon lange propagiert. Das ungleiche Machtverhältnis zwischen Muslimen beziehungsweise »Muslimifizierten«7 und »Mehrheitsgesellschaft« wird in den öffentlichen Debatten – nicht nur bezüglich »Islamismus« – durch einen Gefahrendiskurs häufig in sein Gegenteil verkehrt. Diese Strategie der Täter/Opfer-Verkehrung ist ein in der Rassismusforschung schon lange bekanntes Phänomen. Das Sich-angegriffen-Wähnen kann eigene Aggressionen als Verteidigung erscheinen lassen; damit wird das bereits benannte Machtverhältnis negiert (siehe unten).
Auslöser der im Oktober 2010 die breite politische und mediale Öffentlichkeit erreichende Debatte um eine angebliche »Deutschenfeindlichkeit« waren Klagen von Pädagogen, dass Schüler aus Zuwandererfamilien immer wieder deutsche Kinder ausgrenzten und beschimpften. Aufsehen erregte vor allem ein Beitrag für das Mitgliedermagazin des Berliner Landesverbands der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), in dem zwei Lehrkräfte aus dem Ausschuss für multikulturelle Angelegenheiten der GEW auf das Thema hinwiesen. Durch den Bericht fühlte sich insbesondere Kristina Schröder in ihrer bisherigen Argumentation bezüglich der »Deutschenfeindlichkeit« bestätigt und warnte vor der Diskriminierung von Deutschen im eigenen Land. Die Familienministerin gab zu Protokoll, auch Deutschenfeindlichkeit sei »Fremdenfeindlichkeit und Rassismus«:
»Denn hier wird jemand diskriminiert, weil er einer bestimmten Ethnie angehört […]. Da werden deutsche Kinder und Jugendliche dafür angegriffen, weil sie Deutsche sind.«8
Auch die damalige Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Maria Böhmer, prangerte die Deutschenfeindlichkeit an Berliner Schulen an.9 Die Tageszeitung Die Welt bewertete diese Aussagen als mutig, denn auch in der CDU hätten immer mehr Politiker die Augen verschlossen. Zu den unbequemen Wahrheiten der Integrationsdebatte gehöre die in sozialen Brennpunkten offen gezeigte und oft auch gewaltsame Deutschenfeindlichkeit. In dem am 15. Oktober 2010 in der FAZ erschienenen Artikel »Das Schweigen der Schulen über Deutschenfeindlichkeit« heißt es:
»Zu lange wurde geduldet, zu lange auf multikulturelle Beschwörungsrituale gesetzt, zu lange die Debatte vermieden und das Problem rhetorisch verbrämt: Es gibt einen Rassismus in sozialen Brennpunkten, der von muslimischen Schülern ausgeht.«
Einerseits wird der unpassende Begriff des Rassismus auch hier verwendet, andererseits scheint die muslimische Religionszugehörigkeit der Aggressoren durch die gewählte Formulierung relevant. Gleiches gilt, wenn von einem »islamisierten Schulalltag« gesprochen wird. Dass dies die Linie des Artikels ist, wird auch an der Kritik an einem GEW-Workshop deutlich:
»Das soziale Desaster der Risikobezirke reicht als Begründung. Kulturelle Differenzen aber und vor allem die Abgrenzungsmacht der orthodoxen Moscheevereine, die Eltern wie Kindern das Bild vom verkommenen Westen und den unsittlichen, ehrlosen Deutschen so erfolgreich einimpfen, das war der Rede nicht wert.«
Auch der Mythos der »einknickenden« Deutschen, die sich nicht trauen würden, sich zu wehren, wird in dem Artikel kolportiert, wenn es heißt:
»Aber auch die Mädchen langen zu, ›Kopftuch gegen Blond‹ nannte sich eine Hasskampagne an einer Schule. Aber die Kopftücher hatten sich verrechnet, ihre schicken, blonden Gegnerinnen waren Polinnen, denen man offenbar zu Hause nicht eingetrichtert hatte, dass es besser sei, sich wegzuducken.«
Klaus Wowereit, so die Forderung in dem FAZ-Artikel, solle sich eine Freitagspredigt anhören, denn das seien »die seelischen Aufrüstungen, die Familien sich holen, deren Kinder dann in den Schulen die ›Huren‹ und ›Schlampen‹, die ›Christen‹ und ›Schweinefleischfresser‹ jagen.« Spätestens hier wird eine direkte Verbindung zwischen muslimischer Religionszugehörigkeit und aggressivem Verhalten gegenüber »Deutschen« hergestellt und die Diskussion über »Deutschenfeindlichkeit« in die Debatte über den Islam eingeordnet. Die Muslime selbst werden offensichtlich nicht als Deutsche gesehen – die »Verachtung, die viele muslimische Einwanderer der Gesellschaft entgegenbringen, die sie aufgenommen hat, ist das eigentliche Problem«10 – so die Analyse des Zeitungsartikels. Dies sei »in der Migrationsgeschichte« einmalig.
In der medialen und politischen Debatte ging weitgehend unter, dass die wissenschaftlichen »Kronzeugen« von Kristina Schröder und den anderen Protagonisten der Debatte – wie der Kriminologe Christian Pfeiffer, auf dessen Forschungsergebnisse sie sich angeblich stütze – Schröders Aussagen als falsch zurückwiesen und ihre Agitation als Missbrauch ihrer Befunde bezeichneten: Es gebe keine Untersuchung, die zeige, dass durch Deutschenhass motivierte Gewalt zunehme.11 Außerdem wurden auch Herkunft und Implikationen des Begriffs unzureichend thematisiert. Mit dem Begriff der »Deutschenfeindlichkeit« wird schließlich auch gesagt, dass diejenigen, deren Verhalten mit diesem Begriff problematisiert werden soll, selbst keine Deutschen sind.12 Der Begriff wurde im Februar 2008 von der rechtspopulistischen Wählervereinigung »Bürger in Wut« in einer Bundestags-Petition eingebracht, um »deutschenfeindliche Äußerungen« als Volksverhetzung ahnden zu lassen. So neu, wie es in den Medien im Oktober 2010 erschien, war die Debatte also nicht. In der extremen Rechten wird der Begriff schon seit den Neunzigerjahren gebraucht.
Mindestens genauso unterbelichtet blieb in der Debatte aber auch die Frage, ob man in Bezug auf das problematisierte Phänomen sinnvollerweise von ›Rassismus‹ sprechen kann. Wissenschaftlich gängige Rassismusdefinitionen gehen (siehe unten) davon aus, dass
»Rassismus ein Machtsystem darstellt, das faktische Diskriminierung und Benachteiligung rechtfertigt und durchsetzt, denn Rassismus ist nicht nur eine Frage von Einstellungen und Verhaltensweisen, sondern vor allem auch Ausdruck von Machtverhältnissen.«13
Damit ist die Komponente der strukturellen Diskriminierung wie der Zugang zum Arbeits- oder Wohnungsmarkt angesprochen. Mehrheitsangehörige können auf Grundlage dieser Definition individuelle Ausgrenzungserfahrungen machen, aber nicht rassistisch diskriminiert werden. Die Diskriminierung von deutschen Kindern auf dem Schulhof ist somit auch nicht mit den verschiedenen Formen wie antimuslimischem Rassismus oder Antisemitismus gleichzusetzen, wie von Schröder und anderen Protagonisten der Debatte immer wieder versucht. Ohne Schimpfworte wie »Kartoffel« oder »Jude«, ohne Antisemitismus und antideutsche Reflexe unter muslimischen oder anderen Jugendlichen leugnen zu wollen, sollte nicht das Machtgefälle übersehen werden, das Rassismus zugrunde liegt. Schließt man dieses Machtgefälle und die Funktion von Rassismus von der Diskussion aus, verrät sich endgültig die Tendenz zur Rassismusleugnung und mithin zum Erhalt dominierender Strukturen.
Zwei heute zentrale Erscheinungsformen rassistischen Denkens sind der Antisemitismus und die Islamophobie. Bei allen historischen und auch aktuellen Unterschieden zwischen Antisemitismus und Islamophobie ist es an der Zeit, die gemeinsame Aufgabe zu erkennen: die politische Bekämpfung von gruppenbezogener Diskriminierung egal welcher Art.
Der Vergleich von Antisemitismus und Islamophobie beziehungsweise antimuslimischem Rassismus sorgt dabei immer wieder für öffentliche Aufregung. Diese Aufregung ist gut verständlich und hat ihre Berechtigung dort, wo entweder begründbare Zweifel bestehen, dass die Grauen des eliminatorischen Antisemitismus – der Holocaust – relativiert werden sollen (also der moralischen Ebene), und zum anderen dort, wo es gute Gründe dafür gibt, von einem analytischen Missverständnis auszugehen, wenn beide Phänomene gleichgesetzt werden. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn behauptet wird, dass Muslime heute in der gleichen Position seien wie Juden im Nationalsozialismus. Die Aufregung hat dort keine Berechtigung, wo es darum geht, Juden und Muslime als Betroffene rassistischer Diskurse gegeneinander auszuspielen, einem der beiden real vorhandenen Phänomene die Existenz abzusprechen oder alle rassistischen Ausdrucksformen unterhalb der totalen Barbarei abzuqualifizieren.
Wie unter anderem Micha Brumlik in einem gleichnamigen Essay argumentiert hat, heißt vergleichen ja auch nicht, gleichzusetzen.14 Ganz im Gegenteil: Zu einem Vergleich gehört es selbstverständlich immer auch, die Unterschiede herauszuarbeiten. Noch einmal: Natürlich gibt es die Gefahr, dass Antisemitismus und Islamophobie einfach gleichgesetzt werden – was nicht nur ein moralisches, sondern auch analytisches Problem darstellen würde. Gleichzeitig zwingt die Wirklichkeit aber Personen, die sich mit rassistischen Welterklärungen beschäftigen und versuchen, diese zu bekämpfen, dazu, auf das Phänomen »Islamophobie« einzugehen. Und warum sollte nicht dort, wo es Parallelen gibt, aus den Erkenntnissen der Antisemitismusforschung gelernt werden? Bei dem Versuch, Parallelen und Unterschiede herauszuarbeiten, kann es sinnvoll sein, immer wieder zwischen analytischer und empirischer Ebene zu unterscheiden.
Die Besonderheiten des Antisemitismus – des Hasses auf Juden, weil sie Juden sind – werden später noch ausführlicher dargelegt werden. Dass jedoch die im antisemitischen Diskurs angelegte Feind-Stigmatisierung auch auf andere Gruppierungen übertragbar war und ist, soll zunächst erläutert werden.
Diese Feind-Stigmatisierung setzt zwei Dinge voraus, die im Folgenden genauer betrachtet werden:
1. Die Merkmale diskriminierender Diskurse ähneln einander. Sie weisen vergleichbare Strukturen auf – ob historisch oder aktuell.15
2. Die Diskriminierung beginnt mit der Markierung einer Gruppe als anders und der fortwährenden Wahrnehmung von Taten einzelner Gruppenmitglieder als Eigentümlichkeit der ganzen Gruppe.16
Der antisemitische Diskurs ist der am ausführlichsten erforschte diskriminierende Diskurs überhaupt. Von ihm ausgehend soll der aktuelle Diskurs über Islam und Muslime untersucht werden, um zu prüfen, inwiefern islamfeindliche Muster vergleichbar beziehungsweise unterschiedlich sind. Dabei soll nicht der weiterhin berechtigte und notwendige Kampf gegen Antisemitismus relativiert, sondern ebenso gestärkt werden wie der Kampf gegen jede Form von Rassismus, Hass und Verfolgung bis hin zur Vernichtung.
Die Systematik der Analyse ist so angelegt, dass historische Unterschiede zurücktreten und die Diskursverläufe im Vordergrund der Betrachtungen stehen. Gleichzeitig wird auf weitere diskriminierende Diskurse aufmerksam gemacht und zur Diskussion gestellt, inwiefern beziehungsweise welche rassistischen Denkmuster sich – oft weitgehend unbemerkt – reproduzieren.
Anmerkungen
1 FES 2011, S. 68.
2 Ebd., S. 65 f.
3 Ebd., S. 70 f.
4 Häusler & Küpper 2021, S. 237.
5 Zick 2021, S. 188 f.
6 Unser Archiv, welches Medienbeiträge aus circa zwanzig Jahren umfasst, ist übervoll von Aussprüchen und Beiträgen im Sinne von »Endlich sagt es mal einer!«. Neben der kontinuierlichen Kolportierung von antisemitischen Elementen, sexistischen Darstellungen, homophoben und anderen gruppendiskriminierenden Veröffentlichungen lassen sich negativ-stereotype Beiträge über Islam und Muslime seit Jahrzehnten nachweisen. Die abwertende Rede gegenüber Minderheiten gehört geradezu zum Grundrepertoire der Massenmedien und stellt keinerlei »Tabubruch« da. Auch die von Sarrazin geäußerten »Thesen« sind keineswegs neu, sondern sämtlich schon so oder so ähnlich vertreten worden. Siehe hierzu weiter unten.
7 Den Begriff der Muslimifizierung übernehmen wir von Hilal Sezgin (2011, S. 49). Sie versteht darunter den Prozess, durch den eine ursprünglich religiöse Kategorie zur ethnischen Beschreibung wird.
8 Spiegel-Online, 10.10.2010.
9 Lachmann 2010.
10 Alle Zitate sind dem bereits genannten Artikel entnommen: FAZ, 15.10.2010.
11 Vgl. ARD-Sendung »Panorama«, 24.01.2008.
12 Vgl. Shooman 2010.
13 Rommelspacher 2002, S. 133.
14 Brumlik 2009.
15 Vgl. Allport 1991, S. 29; Horkheimer & Adorno 1969, S. 180; Heitmeyer 2008.
16 Vgl. Schiffer 2005, S. 200 f.