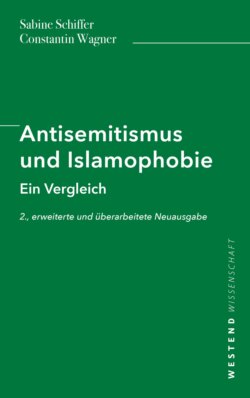Читать книгу Antisemitismus und Islamophobie - Sabine Schiffer - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2.2.4 Die Forderung nach Assimilation und der Verstellungsvorwurf
ОглавлениеDer rechtlichen Emanzipation der Juden folgte die Assimilationsforderung.84 Vor allem Philosemiten glaubten, dass durch einen Wegfall äußerlich erkennbarer Merkmale oder gar durch die Taufe die antijüdische Hetze ein Ende finden würde beziehungsweise die Juden »von ihren schlechten Eigenschaften befreit« würden – so auch der Tenor von Wilhelm Marrs Judenspiegel.85
Dagegen mutete der Wunsch nach Identitätswahrung wie Verrat an.86 Aber auch die assimilierten Juden behielten ihre Markierung aus der Sicht der nichtjüdischen Öffentlichkeit bei, bis hin zur Unterstellung, dass sie sich aus strategischen Gründen verstellten und dies nur besser konnten als ihre auffälligeren Glaubensgenossen und dass sie so das politische System hintergehen wollten.87 Dieser Verstellungsvorwurf verhinderte somit sogar, dass ernst gemeinte Versuche der Assimilation überhaupt als solche wahrgenommen und anerkannt werden konnten.
Am Beispiel Richard Wagners, der nach seinem Karriereknick gegen seinen Konkurrenten Giacomo Meyerbeer polemisierte, wird diese Sicht, aber auch die Folgen für die assimilierten Juden, deutlich. Richard Wagner schreibt:
»Der gebildete Jude hat sich die erdenklichste Mühe gegeben, alle auffälligen Merkmale seiner niederen Glaubensgenossen von sich abzustreifen: In vielen Fällen hat er es selbst für zweckmäßig gehalten, durch die christliche Taufe auf die Verwischung der Spuren seiner Abkunft hinzuwirken. Dieser Eifer hat den gebildeten Juden aber nie die erhofften Früchte gewinnen lassen wollen: Er hat nur dazu geführt, ihn vollends zu vereinsamen.«88
Fazit: Die Juden konnten es den Nichtjuden nicht recht machen.89 Versuchten sie ihre Kultur (auch äußerlich) zu bewahren, dann wurden sie als integrationsverweigernd und »undeutsch« eingestuft. Wollten sie sich hingegen assimilieren, dann unterstellten ihnen viele Nichtjuden Verstellung und Parasitentum. So konnte alles, was auf »Besserung« hätte hindeuten können, wieder uminterpretiert und somit ins stereotype Licht zurückgeordnet werden.
Ein Beispiel genügte dabei bereits, um die gesamte Unterstellung zu »beweisen« – entsprechend unserer generalisierenden »Pars-pro-toto«-Wahrnehmung.90 Dies widerspricht entschieden Katz’ Schlussfolgerung, dass die Juden lediglich die Selbstmarkierung hätten aufgeben müssen, um dem Rassismus zu entgehen.91 Über die Definitionsmacht, wer fremd und mit welchen Eigenschaften ausgestattet ist, verfügt aber immer der Mächtigere in einer hierarchischen Konstellation – der, der die Gesetze und Umstände in einem Gemeinwesen prägt, und das war im europäischen Kontext niemals die Minderheitengruppe der Juden.
Die Folgen des Misstrauensdiskurses schlugen sich in Parlamentsdebatten und Medien nieder und weisen einige Parallelen zu den Leitkulturdebatten des 21. Jahrhunderts auf, etwa wenn dem Judentum »Unvereinbarkeit mit der Moderne« vorgeworfen wurde, was an Riten wie dem Schächten festzumachen wäre. Das Religiöse an sich schien in einer »aufgeklärten« Gesellschaft keinen Platz mehr zu haben und sollte in die Unsichtbarkeit verbannt werden.92 Auch hier wurde der Widerspruch zum sonst eher als fortschrittlich geltenden Judentum ignoriert93 – ebenso, wie auch die Vorstellung vom prototypischen Deutschen durch die Debatte eine Re-Christianisierung erfuhr.
Obwohl in Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts weniger als ein Prozent der Bevölkerung Juden waren, galten sie als gefährliche Fremdkörper und als eine die Mehrheit bedrohende Personengruppe, die sich nicht integriert hätte: Ein Beispiel dafür, wie ein Feindbild herbeigeredet werden kann.
Das Misstrauen den jüdischen Bürgern gegenüber machte sich in Forderungen nach einer Untersuchung der Thoraschulen und deren Lehrbücher sowie nach Predigten in deutscher Sprache deutlich. Das Misstrauen blieb – trotzt aller Bemühungen von jüdischer Seite. Mit dem Misstrauen blieb auch die Markierung und die Verwechslung von Fakt und Relevanz, denn oft waren nicht die genannten Fakten falsch, sondern die ständige Thematisierung des »Jüdischen« außerhalb der relevanten Kontexte.
Die immer wiederkehrende Verweigerung, Juden als gleichwertige Bürger anzuerkennen, schürte auch Misstrauen und vor allem Resignation auf deren Seite. Nur wenigen Juden gelang der Spagat zwischen all den unerfüllbaren Anforderungen und ihrem eigenen Identitätsgefühl. Von der Mehrheitsgesellschaft lieber gehört wurden sowieso diejenigen, die sich ihrer Gruppe gegenüber unsolidarisch94 verhielten und persönlichen Nutzen daraus zogen, als (ehemalige) Juden das »Jüdische« abzulehnen.95 Innerhalb der jüdischen Gemeinden wurde heftig diskutiert, ob man sich anpassen oder eher abgrenzen solle. Es gab beides. Misstrauen spiegelte sich auf beiden Seiten wider: Durch die Diskriminierung der Juden wurde die sich selbst erfüllende Prophezeiung der Andersartigkeit regelrecht kultiviert.96