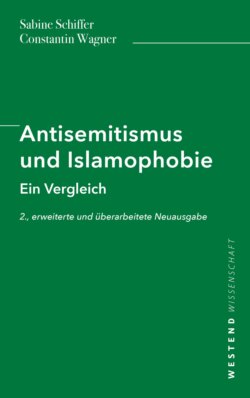Читать книгу Antisemitismus und Islamophobie - Sabine Schiffer - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.4 Anti-antisemitischer Rechtfertigungsdiskurs ohne Aussichten auf Erfolg?
ОглавлениеIn jeder Phase antisemitischer Agitation gab es auch Reaktionen, die sich dezidiert gegen die Judenfeindschaft aussprachen. So auch nach dem bereits erwähnten Berliner Antisemitismusstreit um 1880, der wiederum deutlich machte, dass der Judenhass offensichtlich latent vorhanden war und nur äußerer Anstöße bedurfte, um jederzeit wieder aktiviert zu werden. Interessant sind in diesem Zusammenhang die Gruppierungen und Publizisten, die glaubten, sie könnten durch Aufklärung gegen den Antisemitismus ankommen. Ein unglückliches, aber nicht untypisches Beispiel bietet der angesehene Historiker Theodor Mommsen, der gegen seinen Amtskollegen Heinrich von Treitschke argumentierte. Obwohl der Akademiker vor einem Legen verbaler Brandsätze à la Treitschke warnte, war es letztlich Mommsen, der sozusagen en passant das Motiv prägte, die »Juden seien schon immer ein Element der Decomposition« gewesen.116
Ein weiteres prägnantes Beispiel in diesem Zusammenhang ist der bereits erwähnte Antisemiten-Hammer von Josef Schrattenholz, der historische und aktuelle Zitate von angesehenen Persönlichkeiten präsentiert, um Entgleisungen im öffentlichen Diskurs entgegenzutreten. Der Autor des Vorworts zeigt sich optimistisch, dass mit diesem Werk ein für alle Mal der Dummheit des Antisemitismus begegnet werden und ihm der Garaus gemacht werden könne.
Die folgenden Beispiele aus diesem Buch entstammen hauptsächlich der Zeit um die Mitte des 19. Jahrhunderts, als es im öffentlichen Diskurs von Parlament und Medien um die rechtliche Gleichstellung jüdischer Bürger ging. Es werden im Folgenden vor allem Passagen daraus zitiert, die in Zeiten von Leitkulturdebatten im Deutschland des 21. Jahrhunderts wieder eine brisante Aktualität bekommen haben.
»Die jüdische Religion enthält keine Vorschriften, welche die Juden verhinderte, ebenso gute Staatsbürger zu sein, als wir Christen.«117
»Ich weiß aus Erfahrung, dass es wohl möglich ist, dass ein jüdischer Lehrer auch bei christlichen Kindern ein guter und moralischer Lehrer sein kann.«118
Man achte auf die unausgesprochene Grundannahme: »Christen sind gute deutsche Staatsbürger« bzw. umgekehrt »gute deutsche Staatsbürger sind Christen«. Eine Prämissenanalyse ist ein effektives Mittel, um Einstellungen zu ermitteln. Die Explizitmachung oben genannter Selbstverständlichkeiten deutet auf tiefsitzende Ablehnungsgefühle gegenüber nichtchristlichen Mitbürgern hin.
Ihre komplette Anderswahrnehmung als Folge von »Pars-pro-toto«-Wahrnehmung und Verallgemeinerung machte den im Folgenden zitierten Ausspruch nötig, der auch im Jüdischen Museum in Berlin zu lesen ist:
»Wir sind nicht deutsche Juden, sondern deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens. […] Wir verdammen die unsittliche Handlung des Einzelnen, wess Glaubens er sei; wir lehnen jede Verantwortung für die Handlung des einzelnen Juden ab und verwahren uns gegen die Verallgemeinerung, mit der fahrlässige oder böswillige Beurtheiler die Handlung des einzelnen Juden der Gesammtheit der jüdischen Staatsbürger zur Last legen.«119
Erschreckend war für viele, dass nach einer Phase der Konsolidierung gesellschaftlicher Gleichstellung eine Wirtschaftskrise und ihre Folgen alles Erarbeitete sofort zunichte machte. Die alten Einordnungen waren so dominant und noch so unreflektiert, dass sie sofort wieder aktiviert werden konnten, wie das die Beispiele Otto Glagaus und Heinrich von Treitschkes bereits gezeigt haben.
Interessant ist fernerhin die Feststellung, dass eine starke Argumentation der Aufrechnung und Nützlichkeit zur Rehabilitation jüdischen Lebens und Wirkens in Deutschland und der Welt bemüht wurde.120 Die wichtigsten Motive dieses anti-antisemitischen Rechtfertigungsdiskurses werden hier, mit jeweils einem Beispiel aus verschiedensten Quellen, aneinandergereiht, aufgelistet und zusammenfassend kommentiert:
»Juden entwickelten die historisch-kritische Methode der Bibelauslegung, sie sind die Erfinder der Linguistik.«121
»Die Semiten waren es, die im Alterthum den Austausch der materiellen und geistigen Güter zwischen Asien, Europa und Afrika besorgten, und die im grossen Wettkampf der Völker sich von jeher […] durch fleissige Verwerthung des Eigenen und des Erborgten hervorgethan.«122
»keine Reformation ohne die Kenntnis des Urtextes«123
»Kunst und Industrie haben an den Juden begeisterte Jünger und Förderer gefunden und auf allen Gebieten des Lebens haben die Juden ihre Ebenbürtigkeit mit ihren Mitbürgern nichtjüdischen Bekenntnisses vollständig bewährt. […] Was aber Juden, die seit Moses Mendelssohns Zeiten am öffentlichen Leben wie an der geistigen Bewegung der Menschheit theilgenommen haben, in der Philosophie, in der Naturwissenschaft, besonders in der Medicin und Mathematik, in der schönsten Litteratur, in der Tonkunst, geleistet haben und noch leisten, gehört nicht mehr der jüdischen, sondern der allgemeinen Litteratur an.«124
»Die Israeliten sind das wichtigste Volk des Orients; denn nicht nur erhielten sie durch die Macht, welche sie unter ihren Königen David und Salomo sich erwarben, grossen Einfluss auf die Staaten der westlichen Hälfte Asiens, sondern ihre Geschichte und Litteratur hat auch, durch das unter ihnen entstandene Christenthum, eine außerordentlich grosse und bleibende Wichtigkeit für die Völker aller Klimate und Zungen erhalten. Außerdem sind auch die von ihnen überlieferten Bücher die am zuverlässigsten und am besten geordneten Schriften über die ältesten Geschichtswerke, welche es gibt.«125
Das Dilemma des Verteidigungsdiskurses wird hier an zweierlei deutlich. Erstens bedeutet eine Defensive immer auch eine diskursive Hierarchie, in der eine Seite die relevanten Themen definiert und die andere Seite immer nur reagieren kann. Das Gegenüberstellen der »Vorzüge der Juden« gegenüber den Nichtjuden verbleibt im »Wir vs. Ihr« und zudem in der Kategorisierung »Juden/Semiten sind anders« und homogenisiert gleichzeitig beide Gruppen, was dann in der Typisierung »der Jude (an sich)« seinen generalisierenden Kulminationspunkt findet.
Obwohl gut gemeint, verstärkt das Aufwiegen geradezu den Antagonismus und suggeriert eine Naturgegebenheit von Gegeneinander und Hierarchie, die nur ein Oben und Unten duldet und einfach voraussetzt, dass der christliche Deutsche der Maßstab aller Dinge sei.126 Dadurch, dass diese Beiträge einfach nur die Angriffsrichtung umdrehen, verbleibt der Diskurs im Konzept der Konkurrenz und erschwert oder verhindert sogar eine Entwicklung in Richtung Gleichwertigkeit und Miteinander, wie etwa die folgenden Beispiele belegen.
»Wir müssen hier vor allem eins bedenken, dass uns nämlich von den Semiten schon in einer Zeit Kunst- und Litteraturdenkmäler vorliegen, wo wir von indo-germanischen Völkern dergleichen noch nichts kennen.«127
»Nicht in grösseren angeborenen Geisteskräften, sondern nur in der strengeren Befolgung der religiösen Vorschriften und einer keuschen, sparsamen und gewissenvollen Lebensweise haben die Semiten ihre grösseren financiellen Erfolge zu suchen. Wenn die Christen nur dasselbe thun wollten, hätten sie sich nicht vor einer semitischen Übermacht zu fürchten […].«128
»Wie schon erwähnt, scheinen die Juden ein angeborenes Sprachtalent zu besitzen […].«129
»Der Jude ist von der Natur mit so vielen und grossen Geistesgaben ausgestattet, dass er sehr bald auf dem Felde, das zu bebauen ihm gestattet ist, Meister wird.«130
Auch wenn bei den letzten beiden Beispielen das Gegenüber nicht explizit genannt wird, so bleiben die Rehabilitationsversuche im dualen System »entweder die«/»oder die«. Es ist dann nur noch ein kleiner Schritt hin zu einer Idealisierung der so oft Geschmähten und Diffamierten.
Dieses Verhalten ist ein unbemerkter Reflex, der oft gerade bei Menschen einsetzt, die Mitgefühl empfinden. Denn wenn man ständig angegriffen wird oder spürt, dass jemand zu Unrecht angegriffen wird, so wird der Verteidiger nur die Fakten anführen, die den anderen rehabilitieren können. Als Gegenargumente kommen dann Beispiele aus der Geschichte oder Gegenwart zum Einsatz, die den Angegriffenen in einem positiven Licht erscheinen lassen.
Dies ist ebenso verständlich wie tückisch, denn dadurch wird dann oft ein übertrieben positives Bild vom Beschuldigten kreiert. Das ist manchmal nötig, um dem ebenso verzerrten Negativbild überhaupt etwas entgegenzusetzen. Aber dieser Mechanismus dient in seiner Selektivität fatalerweise nicht der Aufklärung – in dem Sinne nämlich, dass es überall solche und solche gibt –, sondern verstärkt Dualismus und Polarisierung.
Dass die unglückliche Stereotypisierung nicht in der Beschimpfung, sondern bereits in der homogenen Wahrnehmung einer ganzen Gruppe verschiedenster Menschen gleichen Glaubens, gleicher Nation, gleichen Geschlechts liegt, ist von elementarer Wichtigkeit. Damit bleibt die eigentliche Problematik, nämlich die Übertragung von Merkmalen einzelner auf eine ganze Gruppe, konstant – eben nur mit umgekehrter »Stoßrichtung«.
Dies macht den Diskurs nicht glaubwürdiger – im Gegenteil, die eigentlich kompatiblen Narrative divergieren immer mehr, bis jeder dem anderen Lüge und Überheblichkeit vorwirft. Dabei ist es unerheblich, ob dieser Diskurs für eine Gruppe von Betroffenen oder von außenstehenden Verteidigern bedient wird. So ließen sich damals Übersteigerungen finden, wie:
»Das Heil kommt von den Juden.« 131
»Je reicher der Jude wird, je splendider wird er; beim Christen wächst mit dem Reichthum der Geiz.«132
»Ich liebe die Juden und mein Wunsch geht dahin, dass sie sich im Sinne der Überlieferung entwickeln mögen. Es giebt keine Rasse, keine Religion, die eine solche Tradition besässe, wie diejenige der Propheten.«133
Auch hier zeigt sich deutlich, dass der Philosemitismus ebenso eine Stereotypisierung ist, weil er »die Juden« auch als homogen betrachtet wie sein antisemitisches Gegenüber. Damit bleibt die Vorstellung, »alle Juden sind gleich und entweder so oder so« erhalten – sie bleiben ein Beschreibungsobjekt, etwas nicht Normales. Von Gleichwertigkeit und Differenziertheit sind damit alle gleich weit entfernt.
»Die Juden haben wie alle anderen Nationen ihre Vorzüge und ihre Schwächen […].«134
»Der Vorzug der Hebräer vor allen anderen asiatischen Völkern besteht einzig und allein darin, dass […]«135
Wie auch vermeintlich differenzierende Aussagen homogenisierend wirken können, wird an den letztgenannten Zitaten deutlich. So lange verallgemeinernd von »den Juden« oder »den Christen« die Rede ist, ist die Sache immer tendenziell rassistisch und bedient den Abgrenzungsdiskurs »Wir und die Anderen« – wie er sich auch in folgendem Zitat niederschlägt: »Sie leben seit Jahrhunderten unter uns.«136
Zu »uns« gehören, laut einer solchen Aussage, Juden also nicht. Es muss demnach nicht immer so zugehen, dass die diskriminierte Gruppe offen beschimpft wird, um sie auszugrenzen.
»Ich halte […] die Judenfrage für eine Racenfrage und bin des Glaubens, dass insbesondere zwischen den Germanen und den Juden eine starke, wahrscheinlich gegenseitige Antipathie besteht, stärker als zwischen anderen Nationen. Solche Abneigungen sind ebenso unerklärbar wie unüberwindlich, aber die Cultur kann sie bändigen und die Gesittung der Einzelnen kann ihnen den beiliegenden Stachel nehmen. Sie zu schüren und zum Dogma zu erheben halte ich für ein unverantwortliches Unrecht, das nur der Fanatismus und der Eigennutz zeitigen kann. Gegen jeden materiellen oder ideellen Schaden, den ein Jude unserem wirtschaftlichen oder geistigen Leben zufügt, mögen die Bedrohten oder diejenigen, die sich zu Hütern des Volkes berufen fühlen, kämpfen. Aber über den einzelnen Fall hinaus darf dieser Kampf sich niemals erstrecken, wenn er nicht den Unschuldigen mit dem Schuldigen treffen will. Das gewöhnliche Interesse zu einer Culturfrage zu stempeln und gegen den ganzen Stamm zu wüthen, den wir doch nun mal unter uns aufgenommen haben, dessen Rechte und Pflichten die unsrigen sind, dessen Intelligenz wir nun nutzbar gemacht und an dem wir im Lauf langer Jahrhunderte mindestens eben so viel gesündigt haben wie er an uns – das ist eine Rohheit, die den Angreifer stärker als die Angegriffenen brandmarkt.«137
Die Vermischung der Kategorien Religion und Nation sind nicht dem Autoren allein anzurechnen, denn auch in der Selbstdefinition von jüdischer Seite ist diese Vermischung bereits angelegt und auch nicht auflösbar, weil sowohl Religion als auch Volksempfinden traditionell jüdisches Selbstverständnis bestimmen.138 Ignatz von Döllinger setzt in einer Rede von 1881 hier an.139 Er beschreibt die Chancenlosigkeit des sowohl markierten als auch sich selbst markierenden »Volkes« der Juden. Widersprüchliche Gesetzgebungen seien für die Markierung und Diskriminierung der Juden verantwortlich, sodass nicht über »die Juden«, sondern über ihre Bedingungen geurteilt werden müsse.140
Heinrich Bulthaupt hat herausgearbeitet, dass die Verantwortung für eine mögliche Auflösung eines hierarchischen Verhältnisses dabei bei demjenigen liegt, der den größeren Zugang zur Macht hat. Dies entspricht den sozialpsychologischen Beschreibungen von Henri Tajfel, der die gruppendynamischen Entwicklungen in hierarchischen Konstellationen systematisch beschreibt.141 Wichtig ist für unsere Analyse die Beobachtung, dass die fortgeschrittenen Erkenntnisse einerseits als auch die Festschreibung so manchen Klischees andererseits aufgrund der unbedachten bzw. selbstverständlichen Verwendung der üblichen Sprache Hand in Hand gehen.
Auch der von Hannelore Noack in Bezug auf die Verunglimpfung der jüdischen Schriften genau nachgezeichnete anti-antisemitische Diskurs von Akteuren wie Dr. Franz Delitzsch, Rabbiner Dr. Kroner, Rabbiner Dr. Bloch und vielen anderen war langfristig auf verlorenem Posten. Den Makel der defensiven – sprich: unterlegenen – Apologie, den Ruch des Sich-verteidigen-Müssens, wurde man nicht los. Golo Mann erkennt viel später genau diese Mechanismen und den Verbleib in der Gegenüberstellung Wir und Ihr, was er als ein bewusstes, ja bösartiges Festhalten interpretiert.
Dabei übersieht er allerdings, dass sich Menschen durch als Andere wahrgenommene in ihrem Sein infrage gestellt sehen können: Diese Herausforderungen nehmen Menschen häufig nur sehr ungern an. Golo Mann wittert jedoch etwas von Grund auf Böses hinter diesem durchaus natürlichen, aber dennoch zu bearbeitenden Reflex menschlicher Empfindungen.142
Dennoch bleibt Manns Erkenntnis bemerkenswert, dass einerseits (konstruierte) Unterscheidungskriterien ausgemacht werden müssen und die Mehrheit andererseits von dieser Abgrenzung profitiert:
»Immer und überall hat es rechtlose oder unterprivilegierte Minderheiten gegeben. Das hat grundsätzlich immer auf zwei Ursachen beruht: darauf, dass die verfolgten Minderheiten irgendwie anders waren als die Mehrheit, in ihrer Vorgeschichte und Herkunft, ihrem körperlichen Sein, ihrer Sprache, ihrem Glauben anders waren oder doch als anders galten, und die Mehrheit ihnen gegenüber unter sich bleiben wollte; ferner darauf, dass der Mehrheit diese Fremdheit und Feindschaft, die ja immer mit einem Gefühl der Überlegenheit, mit Gewohnheiten und Einrichtungen der Herrschaft verbunden war, entschieden Spaß machte.«143
Hinter dem »Spaß machen« darf ruhig die Feststellung der Rassismusforschung erkannt werden, dass rassistische Strukturen zugunsten des Privilegienerhalts der davon profitierenden Schicht gerne beibehalten werden.
Auch heute noch ist zu beobachten, dass die Zusammenhänge nicht vollständig verstanden wurden und werden, denn immer noch und immer wieder gibt es antisemitische Äußerungen. Wobei wir uns auch bewusst machen müssen, dass rationale und intellektuelle Durchdringung ein emotionales Phänomen nicht auflösen können – hier gibt es also mehr zu betrachten als nur den Diskurs, auf den wir uns in dieser Abhandlung aber beschränken müssen.