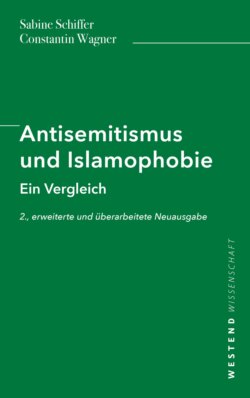Читать книгу Antisemitismus und Islamophobie - Sabine Schiffer - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2.2.5 Die Bildungselite und der Antisemitismus
ОглавлениеRichard Wagner veröffentlichte 1869 seine Schrift gegen die »Verjudung der modernen Kunst« Das Judenthum in der Musik offiziell unter seinem Namen, nachdem er sie zwanzig Jahre zuvor anonym herausgegeben hatte.97 Diese Wende zum bekennenden Antisemitismus zeugt davon, dass der Judenhass, vorbereitet durch seine penetrante Kontinuität und bestechende Kohärenz – eben durch Evidenzsuggestion –, zunehmend gesellschaftsfähig wurde. Gerade der moderat vertretene, sich nüchtern-wissenschaftlich kleidende Blick auf die Juden wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Akademikerkreisen zunehmend akzeptiert und bekam durch diese Art von Anerkennung indirekt Legitimation und weiteren Aufschwung.98
Nicht ohne Erstaunen und Schrecken macht Daniel Goldhagen in seinem viel diskutierten Buch folgende Feststellung:
»1880 kam es zu einer reichsweiten Kampagne mit dem Ziel, Juden ihre bürgerlichen Rechte wieder abzuerkennen; 265 000 Unterschriften wurden gesammelt, der Reichstag debattierte zwei Tage lang. Bemerkenswerterweise stammten die Unterschriften diesmal meist nicht von Angehörigen der ›ungebildeten‹ untersten Klassen, sondern von Grundbesitzern, Priestern, Lehrern, Beamten.« 99
Wie gefährlich es ist, sich durch das Erreichen eines bestimmten Bildungsniveaus für immun gegenüber Vorurteilen zu halten, zeigt auch das Beispiel Frankreichs. So war das Bildungsbürgertum im Frankreich des 19. Jahrhunderts zunächst über die antisemitischen Machenschaften im östlich gelegenen Europa höchst verwundert. Die antisemitische Agitation wurde als rückständig und unaufgeklärt gewertet. Entsprechend scheiterten antisemitische Zeitschriften in Frankreich.
Dennoch gelang es dem Journalisten Édouard Drumont, dem Herausgeber der wieder eingestellten Zeitschrift L’Antisémitique 1886 infolge der Bankaffäre der Union Générale mit dem Buch La France juive Kritik an dem »Eindringen« von Juden und ihrer vermeintlichen wirtschaftlichen Vormachtstellung zu üben. Drumont schuf eine »gelungene« Verbindung disparater ideologischer Elemente, die sich nicht widerlegen ließen, und gründete schließlich im Aufwind des nun erstarkenden französischen Antisemitismus die sogenannte Antisemitische Liga.100
Die geschilderte Gefahr des Immunitätsglaubens betrifft vor allem die sogenannten Eliten eines Landes sowie die Gesellschaften, die sich für weit entwickelt halten.101 Die Geschichte des Antisemitismus widerspricht der Vorstellung, dass höhere Bildung vor Vorurteilen schütze.102 Wie die Zeit des Nationalsozialismus, aber auch schon davor, beispielsweise die Schicksale eines Heinrich von Treitschke, Theodor Mommsen und Adolf Stoecker, in Deutschland ebenfalls gezeigt haben: Auch Bildung schützt vor Torheit nicht!
In welche Richtung sich rassistische Diskurse entwickeln und welche Intensität sie entfalten, kann natürlich nie vorausgesagt werden. Als der angesehene Wissenschaftler von Treitschke 1879 die Diskussion um die Nichtintegrierbarkeit der Juden in die »deutsche« Gesellschaft entfachte, meinte er damit nicht, dass man offen gegen sie agieren oder ihnen gar die erworbenen Bürgerrechte wieder absprechen sollte. Er plädierte »lediglich« für eine fordernde Haltung ihnen gegenüber. Um seinen Ausführungen Nachdruck zu verleihen, sprach er immer wieder von der »Judengefahr«.
Viele Zeitgenossen von Treitschkes wunderten sich über die formulierte Zuspitzung seiner Beobachtung und darüber, dass er alle Juden als Fremdkörper empfand – Deutschsein und Judesein schloss sich seiner Meinung nach aus. Der darin begründete Loyalitätskonflikt spiegelte sich auch im Erscheinungsbild des sogenannten Reformjudentums im Deutschland des 19. Jahrhunderts wider. Das Religiöse an sich wurde als Verrat und grundsätzlich verdächtig eingestuft. In einer »aufgeklärten« Zeit schien es vordergründig keinen Platz mehr zu haben und das Jüdische galt teilweise sogar als Gefahr für die Werte der liberalen Gesellschaft.
Der fünfzig Jahre später von den Nationalsozialisten aufgegriffene Satz »Die Juden sind unser Unglück« stammt von Heinrich von Treitschke selbst. Umgekehrt war es zu dieser Zeit jedoch durchaus noch möglich, durch Renommée und Ansehen den Antisemitismus und seine pogromartigen Ausschreitungen wirksam zu verurteilen. So etwa setzte der spätere Kaiser Friedrich Wilhelm wichtige Zeichen, indem er gegen die hetzerischen Predigten Adolf Stoeckers im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts Stellung nahm. Er bezeichnete den Antisemitismus als »Schande des Jahrhunderts« und bot damit sicherlich einem stärkeren Aktionismus eine gewisse Zeit lang Einhalt. 103