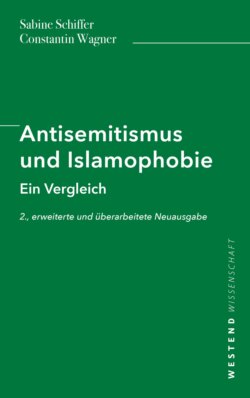Читать книгу Antisemitismus und Islamophobie - Sabine Schiffer - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2 Antisemitismus: Singularität und Exemplarizität eines rassistischen Diskursmusters
ОглавлениеObwohl gelegentlich vor einer Überdehnung des Rassismusbegriffs gewarnt wird, arbeiten wir mit einem solchen, denn auch hierfür gibt es gute Gründe. Es hat sich nämlich gezeigt, dass die Muster der Diskriminierung kaum danach unterscheidbar sind, ob diese aufgrund theoretisch veränderlicher oder tatsächlich unveränderlicher Merkmale stattfindet.
Dem in vielen öffentlichen Debatten dominanten und im Brockhaus zusammengefassten Verständnis von Rassismus zufolge sind hiermit gemeint:
»Einstellungen […] als auch Handlungen, die die Verachtung, Benachteiligung, Ausgrenzung und Unterdrückung bis hin zur physischen Vernichtung von Menschen dadurch legitimieren bzw. in die Tat umsetzen, dass sie eine Auswahl vorhandener körperlicher Merkmale zu ›Rassenmerkmalen‹ zusammenstellen und diese meist negativ bewerten.«12
Da Merkmale wie etwa Kleidung, Haartracht, Name oder Akzent die gleichen Folgehandlungen auf sich ziehen können wie sogenannte Rassenmerkmale, ist ein erweiterter Rassismusbegriff gerechtfertigt und entspricht im Wesentlichen dem des Neorassismus, dem »Rassismus ohne Rassen« beziehungsweise dem kulturellem Rassismus.13 Menschenrassen gibt es biologisch nachweisbar ohnehin nicht, was die konkrete soziale Wirksamkeit dieser Kategorien auch in der Gegenwart freilich nicht vermindert.14
Auch veränderbare, markierte Merkmale können also – sichtbar oder unsichtbar – dazu dienen, die Betreffenden zu klassifizieren. Diese Klassifikation muss dabei nicht zwangsläufig oder in allen Punkten negativ sein. Eine explizite Rassismusleugnung kann sogar häufig als Indiz für latent vorhandenes rassistisches Denken gewertet werden – allerdings natürlich nicht in jedem Fall.15
Albert Memmi isoliert analytisch folgende Strukturmerkmale von Rassismus: die Hervorhebung von Unterschieden, die Wertung dieser Unterschiede sowie der Gebrauch dieser Wertungen im Interesse des Wertenden, insbesondere zur Legitimierung von Macht und Privilegien.16
Zu Beginn steht also die Hervorhebung von Unterschieden und die Konstruktion einer Gruppe anhand dieser Unterschiede. Dies geschieht beispielsweise dort, wo eine allgemeine islamische Symbolik präsentiert wird, wenn es um Gewalt und Terrorismus geht oder auch in den ständigen Darstellungen von kopftuchtragenden Frauen bei den Themen Zuwanderung oder Fremdheit. Hier wird eine (homogene) Gruppe geschaffen, die nicht Teil des Eigenen ist. Gleiches ist aus dem antisemitischen Diskurs bekannt. Zunehmend wird auf diese Weise Heterogenität nicht mehr wahrgenommen und die Vorstellung von einer Gruppe, die über »kulturelle Andersartigkeit« oder »Fremdheit« von der eigenen abgegrenzt wird, kann sich etablieren.
Der zweite Schritt besteht in der Wertung dieser Unterschiede. Dies geschieht häufig über eine bestimmte Darstellung der westlich-christlichen Zivilisation und einem bestimmten Geschichtsbild, in dem bestimmte Topoi vorkommen (wie zum Beispiel die Aufklärung) und andere nicht genannt werden (wie etwa Kolonialismus, Nationalsozialismus, aber auch Beiträge von Strömungen, die heute nicht als europäisch verstanden werden).
Zuletzt folgt der Gebrauch dieser Wertungen im Interesse des Wertenden, insbesondere zur Legitimierung von Macht und Privilegien (dazu zählt einerseits die materielle Ebene: der Wohnungsmarkt, der Arbeitsmarkt und so weiter, andererseits – und damit verbunden – die Alltagsebene). Diese Wertung kann auch implizit geschehen und muss nicht absichtlich erfolgen.
Wenn diese drei Strukturmomente erfüllt sind, lässt sich von Rassismus und diskriminierender Darstellung reden, unabhängig davon, ob anhand der Vorstellung einer »rassischen« oder einer »kulturellen« Andersheit diskriminiert wird. Dabei gilt es – gegen den häufig hervorgebrachten Einwand, auch die Rivalität zwischen Personen verschiedener Städte oder Regionen sei dann »Rassismus« – das dritte Element der Definition zu betonen. Es ist von Relevanz, ob mit dem jeweiligen Merkmal eine tatsächliche gesellschaftliche Ungleichbehandlung verbunden ist, das heißt ob aufgrund der Gruppenzugehörigkeit reale Benachteiligungen einhergehen.
Voraussetzung für die Vorstellung einer grundlegenden Differenz bleibt aber zunächst das Richten des Blicks auf eine bestimmte wie auch immer definierte Gruppe, die dann im Laufe des Redens über dieselbe zunehmend als homogen wahrgenommen wird.17 In Folge dessen, dass die Aufmerksamkeit auf diese Gruppe gerichtet ist – sie markiert ist –, werden einzelne Beobachtungen in Zusammenhang mit dieser Gruppe zunehmend der Gruppenzugehörigkeit zugeschrieben und weniger anderen Umständen.18 Auf ausgewählte Fakten kann dabei sprachlich gezeigt werden, während Gegenteiliges ausgeblendet bleibt.19
Dass der Rassismus aber bereits mit dem Markieren einer Gruppe beginnt, zeigt das folgende Beispiel aus dem antisemitischen Diskurs.
Das Merkmal »jüdisch« wird vor allem dann aktiviert, wenn es sich um negativ bewertete Themen handelt, wie zum Beispiel anlässlich des Ausbruchs der Wirtschaftskrise 1873, als die überwunden geglaubten antijüdischen Gefühle wieder aufkeimten.20 Ein vermeintlich harmloses Beispiel, das in der Berliner Zeitschrift Die Gartenlaube veröffentlicht wurde, zeigt das deutlich:
»Zu den Geistern, welche die Zeit sofort begriffen und sie gründlich, oder eigentlich ›gründerlich‹ auszubeuten verstanden, gehört in erster Reihe Hermann Geber. Er steht ebenbürtig neben Heinrich Quistorp und J. A.W. Carsten; und etwas hinter ihm steht – Herr Paul Munk. Hermann Geber, ein ›schwarzlockiger‹ Versicherungskünstler, verwandelte sich kurz vor der Wiedergeburt des Deutschen Reiches in den farbenschillernden Falter eines Grossindustriellen und General-Speculanten. […] Wir verlassen einstweilen Herrn Geber und wenden uns zu Herrn Munk. Paul Munk stammt, wie so viele ›seiner Glaubensgenossen‹, die hier ihr Glück machten, aus dem Posenschen. Seit 1866 ist fast das halbe Grossherzogthum Posen nach Berlin eingewandert, ist die Zahl der hiesigen ›Juden‹ von 20 000 bis 50 000 gestiegen. Die ›Kinder Israel ‹ vermehren sich in Berlin ebenso heftig wie einst in Ägypten, und es sind durchgehends wohlhabende und reiche Leute […].«21
An diesem vermeintlich harmlosen Beispiel wird deutlich, wie alltäglich die Markierung der Juden war. So konnte der Journalist Otto Glagau22 auf den Vorwurf hin, die kritisierten Gründer ausschließlich als Juden identifiziert zu haben, darauf verweisen, die christlichen Namen nicht unterschlagen zu haben. Das stimmt. Dennoch hat er im Falle, wo es sich um einen Juden handelte, dieses Faktum explizit genannt oder irgendwie markiert (Locken, Herkunft Posen…), an anderen Stellen markierte er mit dem Einschub »mosaischen Glaubens«. Im Falle christlischer Beteiligter unterließ Glagau Verweise auf die Religionszugehörigkeit.23
Die Markierung des »Jüdischseins«, das heißt das zusätzliche Erwähnen dieser Tatsache in einem wirtschaftlichen Zusammenhang, suggeriert, dass das Merkmal »jüdisch« relevant für den Sachverhalt sei. Immer wenn Dinge zusammen präsentiert werden, werden sie auch füreinander relevant gehalten – so funktioniert menschliche Wahrnehmung. Und so funktioniert mediales Framing, wie es Elisabeth Wehling nach der Lehre George Lakoffs erneut in die Debatten um mehr geforderte Verantwortung von Medienmachenden eingebracht hat.24
Die Diskussion um die Merkmalsnennung bei Straftätern, die der Deutsche Presserat regelmäßig aufgreift und die zu einer Aufweichung der Richtlinienergänzung 12.1 geführt hat, dreht sich genau um diesen Aspekt. Denn es geht um die Problematik der verknüpften Wahrnehmung von Straftatsberichterstattung und der Nennung von Gruppenmerkmalen.25 Und es geht immer wieder darum, dass die Nennung von für den Sachverhalt irrelevanten Fakten auf diesen abfärbt und sozusagen indirekt die eigene Relevanz suggeriert. So lassen sich Einzeltaten einer ganzen Gruppe zuweisen. Und dies betrifft sehr vorzugsweise bereits markierte Gruppen, weil die Berichterstatter dort oft meinen, eine solche Nennung »nicht unterschlagen« zu dürfen, während sie gar nicht auf die Idee kommen, dass eine Nichtnennung bei Mehrheitsgruppen eine ebensolche »Unterschlagung« sei.
Eine Überschrift wie »Türke überfiel Bank« wäre demnach zwar sachlich richtig, aber eigentlich ist die Nennung der Nationalität für den Sachverhalt des Banküberfalls nicht relevant. Bringt man das Merkmal ein, dann handelt es sich um eine Sinn-Induktion26 durch einfaches Zusammenfügen disparater Elemente, das heißt, es wird mehr Sinn in den Gesamtzusammenhang interpretiert, als in den einzelnen Elementen vorhanden ist. Erst beim Durchführen einer Gegenprobe wird die Irrelevanz des Merkmals deutlich, etwa, wenn man die Religion der anderen Betroffenen bei dem historischen Beispiel ebenfalls benennt oder die Nationalität auch dann, wenn in Deutschland die Täter Deutsche sind. Noah Sow schlägt ihrer Leserschaft vor:
»Sagen Sie mal laut: ›Ich bin eine Weiße‹, und auch: ›Ich bin eine von diesen Weißen da‹, und vervollständigen Sie: ›Ich bin eine typische Weiße, weil…‹ Merken Sie, dass Sie gar keine Lust darauf haben? […] Willkommen im Club.«27
Hingegen ist beim Delikt einer Passfälschung zumindest potenziell durchaus relevant, welcher Nationalität ein Täter ist. Geht man also vom Sachverhalt aus, dann ergibt sich schnell, was für diesen relevant ist und was nicht, und nur dieses sollte dann auch benannt werden – denn ansonsten suggeriert man Zusammenhänge, die nur dem Messen mit zweierlei Maß entspringen und keine Gruppeneigenschaft sind.
Während sowohl Anti- als auch Philosemiten das Jüdische ständig markierten und damit als »anders« – da erwähnenswert – herausstellten, betrieben viele jüdische Gemeinschaften auch Selbstmarkierung. Dass die Zugehörigkeit zum Judentum offensichtlich als Merkmal definiert wurde, das bestimmte Menschen als »fremd«, »besonders«, »anders« und schließlich als feindlich konzeptualisierte, ist allerdings durch die Konstruktion der »Mehrheitsgesellschaft« und nicht durch das Verhalten mancher Juden zu erklären. Schließlich war es die »Mehrheitsgesellschaft«, die über die Deutungsmacht verfügte, durchaus vorhandene (religiöse) Praktiken als das zu verstehen, was eine grundlegende Nichtzugehörigkeit zum nationalen Kollektiv begründete. Die Markierung in der Wahrnehmung, nämlich die Juden als eine gesonderte Gruppe zu betrachten, blieb auch ohne äußere Merkmale konstant, weil die kognitive und verbale Markierung sich in vielen Köpfen festgesetzt hatte.
Dieses Phänomen schlägt sich unter anderem auch in der Bezeichnung der Juden als »Volk« nieder, also der Vermischung von religiöser und ethnischer Kategorie.28 Etwa am Beispiel der Behandlung von Konvertiten wird die Konzeptualisierung von Juden als Ethnie deutlich, da sie trotz Übertritt zum Christentum »ethnisch« weiterhin als Juden eingeordnet blieben.
Den Verbleib in einer einmal gefestigten Markierung beschreibt der getaufte Autor Ludwig Börne Mitte des 19. Jahrhunderts anschaulich:
»Es ist ein Wunder! Tausendmale habe ich es erfahren, und doch bleibt es mir ewig neu. Die Einen werfen mir vor, daß ich ein Jude sey, die Anderen verzeihen mir es; der Dritte lobt mich gar dafür; aber Alle denken daran. Sie sind wie gebannt in diesem magischen Judenkreise, es kann keiner hinaus.«29
Hier wird das dualistische Denken deutlich, das jedem Rassismus zugrunde liegt, aber beim Antisemitismus in einer besonderen Form auftritt (siehe unten): »Die Anderen« werden immer als Gegenpol zum »Wir« wahrgenommen.30 Im Dualismus31 wird alles Wissen in eine Entweder-oder-Struktur eingeordnet, die die Welt zu ordnen scheint.32 So ist etwas entweder gut oder böse, richtig oder falsch, »zu uns« gehörig oder nicht, schwarz oder weiß.
Durch die Einteilung in eine In- und eine Outgroup findet zwangsläufig eine (gedankliche) Homogenisierung der jeweiligen Gruppe von außen statt, die der Realität nicht gerecht wird, aber durchaus homogenisierend wirkt.33 Sprich: Zuweisung und Verallgemeinerung wirken sich auf die Gruppe aus, oftmals werden zugeschriebene Eigenschaften durchaus adaptiert oder aber bewusst abgelehnt – was wiederum eine Annahme der Thematik bedeutet.
Die Nichtwahrnehmung der individuellen Unterschiede, der unterschiedlichen Interessen und Lebenssituationen der deklarierten Gruppenmitglieder sowie der Prozesse, in denen sich Verhaltensweisen entwickeln, ist eine Grundvoraussetzung dafür, sich einem statischen und homogenen Block gegenüber zu sehen und sich von diesem eventuell bedroht zu fühlen. Die Annahme von homogenen Gruppen ist Teil eines dualistischen Denkens und immer falsch.
Ein weiteres Merkmal rassistischer Diskurse ist die Verallgemeinerung, welche Tatsachen, die für einen Teilbereich Gültigkeit haben, auf den gesamten Sachverhalt überträgt – pars pro toto. Im genannten Beispielfall wurde so etwa die Anzahl der Juden unter den Börsenmaklern einfach auch auf die Gründer übertragen, wodurch die Aussage »90% der Gründer und Börsenmakler sind Juden.«34 zustande kam – ein geflügelter Satz der damaligen Zeit. Dies ist ebenso falsch wie die Übertragung der wirtschaftlichen Dominanzidee auf die Juden allgemein, obwohl Juden aus historischen Gründen tatsächlich (gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil) prozentual relativ häufig als Bankiers, Industrielle und eben Börsenmakler tätig waren.35 Die wirtschaftliche Dominanzidee fruchtete aber vor allem darum immer wieder, weil allgemein eine »diffuse Ablehnungshaltung ohne Sachkenntnis«36 einhergehend mit dem Verdacht, dass diese – die Anderen – wohl immer irgendwie zusammenhalten,37 vorherrschte. Die Rolle des ideologischen Sprachgebrauchs beim Zustandekommen dieser ablehnenden Einstellung macht vor allem Nicoline Hortzitz mit ihrer Arbeit zum Früh-Antisemitismus deutlich.38
Auch Prominenz schützte nicht vor Diffamierung: der besonders erfolgreiche Bankier Bleichröder weckte erst recht das Misstrauen seiner Mitbürger. Gerson Bleichröder war der Privatbankier Bismarcks, Hofbankier der Hohenzollern und Hilfsarbeiter des Auswärtigen Amtes. 1855 trat er an die Spitze der von seinem Vater gegründeten Bank. Um 1860 war das Bankhaus Bleichröder eine der größten Banken für Staatsanleihen und gemeinsam mit dem Bankhaus Oppenheim führend bei der Eisenbahn- und Industriefinanzierung. Bleichröder war Mitglied des sogenannten Preußen-Konsortiums, eines Zusammenschlusses führender deutscher Banken, und somit an der Finanzierung der Monarchie und des Reiches beteiligt. Er galt zeitweise als reichster Mann Deutschlands und hatte auch zu wirtschaftlichen und politischen Eliten im Ausland Kontakt. Er half entschieden mit, die Finanzierung des preußisch-österreichischen Kriegs von 1866 durch eine Staatsanleihe zu ermöglichen, und war auch an den Verhandlungen und der Abwicklung der französischen Reparationszahlungen im Anschluss an den Krieg von 1870/71 beteiligt. Bleichröder wurde als zweiter ungetaufter Jude in Preußen 1872 in den Adelsstand erhoben und besaß eine Anzahl weiterer Auszeichnungen. Er zählte zu den sogenannten assimilierten Juden und galt als »loyal« – was bereits die Infragestellung von Loyalität als normale Erwartung impliziert. Trotz seines geschäftlichen Erfolgs gelang es ihm nicht, sich dauerhaft und problemlos an der Spitze der wilhelminischen Gesellschaft zu etablieren. Die sich zum Ende des Jahrhunderts verstärkende antisemitische Tendenz hielt den jüdischen Bankier auf Distanz zu anderen Mitgliedern des Großbürgertums und des Adels.
Jeder Rassismus beginnt also mit der Markierung, mit der Bezeichnung und Wahrnehmung des Gegenübers als irgendwie anders. Darum stützt auch der Philosemitismus den Rassismus gegen Juden, denn Philosemiten erwähnen ebenso das Judesein außerhalb der relevanten Kontexte – wie es in dem Börne-Zitat ebenfalls deutlich wird.39 Selbst Joseph Arthur de Gobineau hat in seinem Essai sur l’inegalite des races humaines (1853-55) zunächst eine Lanze für »die Semiten« gebrochen.40 Dieser positive Rassismus erhält jedoch die Markierung aufrecht und leistet dadurch dem Rassismus allgemein Vorschub.41 So auch durch Christian Wilhelm von Dohms wohlmeinender Ausspruch: »Der Jude ist doch mehr Mensch als Jude«.42 Anti- und Philosemitismus gehören zusammen.