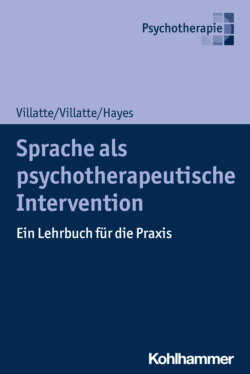Читать книгу Sprache als psychotherapeutische Intervention - Steven C. Hayes - Страница 36
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3 Regelgeleitetes Verhalten und Inflexibilität 2.3.1 Regelgeleitetes Verhalten kann zu mangelnder Kontextsensitivität führen
ОглавлениеBemerkenswert ist die folgende Kehrseite des symbolischen Lernens: wenn Menschen auf der Grundlage von Regeln lernen, untergräbt dies die lenkende Funktion der unmittelbaren Erfahrung (d. h. Lernen von Kontingenzen). Die Paradoxie liegt darin, dass die mangelnde Sensitivität gegenüber direkter Erfahrung nicht auf ungünstigen Eigenschaften des symbolischen Denkens beruht. Im Gegenteil, gerade weil die symbolischen Fertigkeiten einen so großen und raschen Nutzen haben, drängen sie andere Quellen des Lernens und menschlichen Verhaltens an den Rand.
Stellen Sie sich folgendes vor: Sie besuchen zum ersten Mal eine Stadt und möchten wissen, wo sich die besten Restaurants befinden. Sie schlagen in einem Reiseführer nach und essen in einigen der dort empfohlenen Restaurants. Jedes Mal verlassen Sie das Lokal sehr zufrieden. Das Essen ist hervorragend, der Service schnell und freundlich, und die Preise entsprechen genau Ihrem Budget. Wenn Sie das nächste Mal in der Stadt sind, freuen Sie sich schon darauf, Ihre Lieblingsrestaurants zu besuchen, wo Sie guten Service und hervorragendes Essen zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen. Jahr für Jahr besuchen Sie die gleichen Orte und sind stolz darauf, dass Sie die besten Lokale kennen.
Eines Tages erzählt Ihnen ein Freund, dass er vor kurzem in derselben Stadt war und dort in einigen großartigen Restaurants gegessen hat. Keines davon steht auf Ihrer Liste. Einige liegen in einem Teil der Stadt, den Sie nie besucht haben, weil Ihnen von einem Besuch abgeraten wurde. Ihr Freund dagegen hatte sich die Zeit genommen, unterschiedliche Stadtteile zu erkunden, verschiedene Gerichte auszuprobieren und einige Restaurants zu testen. Er wollte herausfinden, ob Essen, Service und Preis in einem guten Verhältnis stehen. Im Laufe der Zeit hatten sich einige Teile der Stadt entwickelt und auch die Restaurants dort wurden besser. Obwohl Sie selbst schnell und zweckmäßig herausgefunden hatten, wo die besten Restaurants waren, wurden Sie dadurch unempfindlich für die Veränderung der Stadt. Ihr Freund, der die Stadt selbst erkundete, fand Restaurants mit interessantem Essen und günstigeren Preisen an unerwarteten Stellen.
Menschen lernen einen großen Anteil an dem, was sie später umsetzen, durch Regeln. Regeln sind eine Erweiterung des grundlegenden relationalen Lernens. Zwei Ereignisse können unabhängig von ihren intrinsischen Merkmalen beliebig in Beziehung miteinander gesetzt werden. Dasselbe Prinzip macht es möglich, Regeln aufzustellen, die von den Konsequenzen, die sie beschreiben, unabhängig sind. Der Grund ist relativ einfach: Regeln entstehen durch eine Kombination symbolischer Beziehungen. Diese Kombinationen können arbiträr sein. Wir könnten beispielsweise behaupten, dass das Lesen dieses Buches Sie zu einem guten Therapeuten oder aber auch zu einem guten Koch machen wird, indem wir die Aussage »Lesen dieses Buches« in eine konditionale Beziehung (wenn… dann) setzen. Damit haben wir eine Regel aufgestellt, die die Konsequenz der Handlung genau beschreibt. Diese Konsequenz kann eine Auswirkung auf Ihre Entscheidung haben, das Buch weiterzulesen. Dabei kann es ausschlaggebend sein, ob die vorausgesagten Konsequenzen unplausibel, unerwünscht oder angsteinflößend sind. In jedem Fall ist die Regel verständlich und wird Ihr Verhalten beeinflussen.
Forscher im Bereich der Relational Frame Theory konnten experimentell zeigen, wie eine Kombination abgeleiteter Beziehungen zur Entwicklung von Regeln führt (O’Hora, Barnes-Holmes, Roche & Smeets, 2004). Wie in vielen Experimenten der RFT Forschung bestand der erste Schritt darin, ein völlig neues relationales Netzwerk herzustellen. So wird sichergestellt, dass die Probanden keinen vorherigen Kontakt mit den verwendeten Stimuli hatten. Die Probanden in diesem Experiment mussten lernen, was »vorher« und »nachher« bedeutet, als lernten sie es zum ersten Mal. Dabei wurden willkürlich gewählte Hinweisreize verwendet (z. B. !!! für »vor« und ## für »nach«). Außerdem mussten sie Äquivalenzklassen für Farbbezeichnungen (z. B. ()() = gelb, ^^ = rot) erlernen. Die Probanden sollten anschließend farbige Knöpfe in der richtigen Reihenfolge betätigen, nachdem sie bestimmte Hinweisreize wie »()() – ## – ^^« (d. h. gelb – nach – rot) erhalten hatten.
Netzwerke dieser Art ermöglichen, dass Regeln die Konsequenzen eines bestimmten Verhaltens festlegen, ohne dass die Person mit den tatsächlichen Auswirkungen in Kontakt tritt. Eine Regel wie: »Wenn Sie angespannt sind, atmen Sie langsam und Sie werden sich besser fühlen.«, beinhaltet beispielsweise ursächliche Beziehungen (wenn – dann) und auch Äquivalenzbeziehungen zwischen »sich besser fühlen« und Wahrnehmungen, die man mit einem entspannten Zustand in Verbindung bringt, usw. Diese Beziehungen sind vergleichbar mit künstlich hergestellten Beziehungen wie »()() – ## – ^^«.
Wenn Menschen mit Hilfe von Regeln lernen (wie im vorherigen Bespiel mit einem Reiseführer), lernen sie zwar schneller, zahlen dafür aber einen Preis. Regelgeleitetes Lernen wird der Situation häufig nicht so gerecht, wie Verhalten, das durch direkte Erfahrung und Rückmeldung geprägt ist. Der Schlüssel für die Steuerung des Verhaltens ist dann ein symbolisches Netzwerk, das auf einer gemeinsamen Sprache basiert. Regeln erzeugen Verhalten, das keine Sensitivität gegenüber Veränderungen hat, die von der Regel nicht antizipiert werden. Dies ist ein Grund, warum Menschen sehr lange in regelgeleitetem Verhalten verharren, das in der aktuellen Lebenssituation überhaupt nicht mehr hilfreich ist.
Experimentelle Forschung im Bereich von regelgeleitetem Verhalten bestätigte immer wieder diesen Effekt (siehe Hayes, 1989 für eine umfangreiche Zusammenfassung). In einer Studie hatten die Probanden die Aufgabe, einen roten oder einen blauen Knopf zu drücken, die abwechselnd aktiviert wurden, um Punkte mit einem bestimmten Geldwert zu sammeln (Hayes, Brownstein, Zettle, Rosenfarb & Korn, 1986). Wenn der rote Knopf aktiv war, erhielten die Probanden einen Punkt, wenn sie den Knopf durchschnittlich zehnmal gedrückt hatten. Beim blauen Knopf erhielten sie einen Punkt, nachdem sie einmal für etwa 10 Sekunden gedrückt hatten. Die Probanden waren in zwei Gruppen eingeteilt: Eine Gruppe erhielt die Information: Die beste Strategie ist, den roten Knopf schnell und den blauen Knopf langsam zu drücken. Die andere Gruppe musste eigenständig lernen. Wie Sie sich vorstellen können, entwickelten die Probanden, die den Tipp erhalten hatten, sehr viel schneller ein Verhaltensmuster, das Ihnen viele Punkte einbrachte, als die Probanden, die sich die beste Vorgehensweise selbst erarbeiten mussten.
Nachdem beide Gruppen das Verhaltensmuster verinnerlicht hatten, wurden heimlich die Bedingungen verändert. Jetzt wurde ein Punkt vergeben, nachdem der blaue Knopf im Durchschnitt 10 Mal gedrückt worden war. Der rote Knopf musste nur einmal und für etwa 10 Sekunden gedrückt werden, um einen Punkt zu erhalten. Die Probanden wurden über diese Veränderung nicht informiert. Sie konnten allerdings fortlaufend die Entwicklung ihres Punktestandes beobachten. Die Probanden, die in der ersten Phase ihr Verhaltensmuster durch direkte Erfahrung entwickelt hatten, passten sich an die neuen Umstände viel schneller an als jene, die in der ersten Phase zutreffende Instruktionen erhalten hatten. Die Regel half ihnen, schneller zu lernen, machte sie aber gleichzeitig weniger sensibel für Veränderungen in ihrer Umwelt. Die Möglichkeit einer Veränderung war in der ursprünglichen Information nicht vorgesehen.
In gewisser Weise ist das Problem sogar erwünscht. Unempfindlichkeit gegenüber Veränderung bietet einen Vorteil. Wenn wir laut rufen: »Lauf nicht auf die Straße!«, wollen wir nicht, dass Kinder die Relevanz dieser Anweisung erst durch Versuch und Irrtum testen. Ein einziges vorbeifahrendes Auto könnte ein Test zu viel sein. Aber Sprache und Kognition neigen dazu, sich auf Gebiete auszuweiten, in denen sie nutzlos oder sogar schädlich werden, wenn sie den Kontakt mit direkter Erfahrung verhindern. Dieses Phänomen ist nicht auf Anweisungen von außen beschränkt. Manchmal verursacht auch das Aufstellen eigener Regeln ausreichend psychologisches Unheil in Bereichen wie Einfühlungsvermögen, Kreativität, Spiel, Sex und Beziehungen. Wir können einerseits Probleme lösen, indem wir Vernunft und Problemlösestrategien anwenden. Gleichzeitig erschaffen wir durch die Dominanz von Sprache und Kognition neue Probleme.
Ein besseres Verständnis des dominanten Einflusses der Sprache kann zur Lösung dieses Problems durch die Steuerung des Kontexterlebens beitragen. Menschen können dann »die Sprache an die Leine« nehmen, dafür sorgen, dass sie hilfreich und flexibel ist, sie aber gleichzeitig begrenzen, wenn sie das nicht ist.