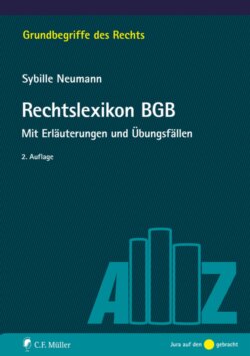Читать книгу Rechtslexikon BGB - Sybille Neumann - Страница 50
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеE › Einreden und Einwendungen › Erläuterungen
Erläuterungen
77
Innerhalb der Einreden unterscheidet man zwischen den peremptorischen Einreden, d. h. solche Einreden, die es dem Schuldner dauerhaft ermöglichen, die Leistung zu verweigern (wichtigstes Beispiel: Einrede der Verjährung gem. § 214 BGB) und den dilatorischen Einreden, d. h. solche Einreden, die es dem Schuldner vorübergehend ermöglichen, die Leistung zu verweigern.
Beispiele:
Einrede der Vorausklage gem. § 771 BGB (erlaubt dem Bürgen die Leistung zu verweigern, bis der Gläubiger erfolglos die Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen des Schuldners unternommen hat); Einrede des nichterfüllten Vertrages gem. § 320 BGB.
Ein Juristenspruch lautet: „Über Einreden muss man reden“. D. h. Einreden werden im Zivilprozess vom Richter grundsätzlich nur dann berücksichtigt, wenn sie vom Schuldner geltend gemacht werden.
78
Innerhalb der Einwendungen unterscheidet man die rechtshindernden Einwendungen von den rechtsvernichtenden Einwendungen. Rechtshindernde Einwendungen sind solche, die das vermeintliche Recht des Gläubigers erst gar nicht erstehen lassen.
Beispiel:
Der Vertrag ist von Anfang an nichtig, weil er gem. § 138 BGB sittenwidrig ist.
Rechtsvernichtende Einwendungen sind solche, die das Recht des Gläubigers nachträglich beseitigen.
Beispiel:
Der Anspruch des Gläubigers besteht nicht mehr, weil der Schuldner gem. § 362 BGB bereits erfüllt (Erfüllung) hat.
Weiterführende Literatur
Jens Petersen, Einwendungen und Einreden, JURA 2008, S. 422-424. Bernhard Ulrici/Anja Purrmann, Einwendungen und Einreden, JuS 2011, S. 104-107.