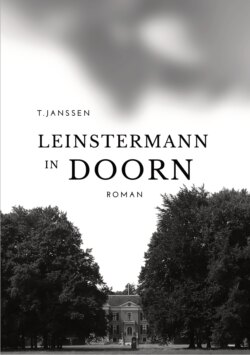Читать книгу Leinstermann in Doorn - T. Janssen - Страница 13
Оглавление4
Wiesbaden, 14.3.1939
Lieber Holm!
Hab vielen Dank für Deinen Brief, den ich leider erst mit einiger Verspätung erhalten habe.
Wie Du selbst geschrieben hast, ist seit Deiner Trennung von Deiner Familie viel Zeit vergangen. Trotzdem – oder gerade deshalb – habe ich mich sehr über das unerwartete Lebenszeichen von Dir gefreut! Über unseren Vetter bestand ja bis zur Verlegung seiner Einheit eine gewisse Information über Deinen Verbleib – für mich sehr unregelmäßig, da die Nachrichten immer den Umweg über unsere Eltern genommen haben.
Leider hat sich mein Zustand entgegen Deinen Wünschen nicht verbessert. Ich selbst hatte gute Hoffnung, die sich jedoch schnell zerschlug. Die Dunkelheit des übermäßig langen Winters hat vielleicht dazu beigetragen – ich kann es nicht sagen. Die Ärzte und Pfleger sprechen wenig mit mir. Ich bekomme Spritzen, deren Inhalt ich nicht kenne, deren Nutzen ich nicht bemerke und deren heftige Wirkung ich nicht verstehe. Sicherlich ist ein Teil davon dazu gedacht, mich nachts ruhiger schlafen zu lassen – denn das war in den letzten Wochen ein großes Problem für mich. Immer wieder wurde ich aus dem Schlaf gerissen, völlig aufgeregt und nass vor Schweiß. Einerseits bin ich dann wie starr vor Angst, andererseits beginnt sich mein Körper vor innerer Spannung zu schütteln. Es fühlt sich vielleicht ähnlich an, wenn man bewegungsunfähig gefesselt neben einem Eisenbahngleis liegt, während ein langer Zug vorüber fährt. Bei einem dieser Anfälle musste der Pfleger mir einen Beißring in den Mund zwängen, aus Angst davor, ich würde mir selbst die Zunge abbeißen.
Sind diese Krämpfe fort, bin ich völlig erschöpft, aber gewissermaßen beruhigt. Es ist, als wenn man einen großen Kampf überstanden hat, der an die Abgründe der eigenen Existenz führt. Mit den Spritzen jedoch scheint eine Besserung in Sicht – ich erwache nicht mehr so häufig und fürchte mich zumindest nicht mehr so sehr. Allerdings quälen mich die übrigen Wirkungen der Behandlung, es ist an manchen Tagen fürchterlich!
Körperlich bin ich offenbar gesund, aber meine Nerven und meine Seele leiden. Sie sagen hier, es sei Hysterie. Aber genug davon!
Ich wünsche Dir für Deine neue Anstellung viel Erfolg! Inzwischen dürftest Du ja bereits einige Erfahrungen gesammelt haben. Hast Du Gelegenheit, den alten Kaiser zu sehen oder gar zu sprechen? Und wie ist das Leben am Hof in Doorn? Vor einigen Jahren habe ich eine Serie von Artikeln in der »Neuen Illustrierten« gelesen, dort wurde von den Ereignissen am Ende des Krieges bis zu dem Exil in Doorn alles recht ausführlich beschrieben. Ich bin sehr neugierig, was Du aus erster Hand zu berichten hast.
Auch interessiert mich sehr, ob Du zu neuen Erkenntnissen wegen der Pflanzenkrankheit gekommen bist. Hast Du überhaupt Zeit, neben Deiner Arbeit für den Kaiser noch zu forschen? Bitte schreibe mir ausführlich, wie es Dir dort ergeht – Du kannst Dir denken, dass es hier einen Mangel an Abwechslung gibt.
Ich möchte Dir nicht vorenthalten, dass Vater und Mutter mich vorige Woche besucht haben. Da ich nicht sicher wusste, wie Du zu der Sache stehst, habe ich Deinen Brief nicht erwähnt. Der alte Herr war wortkarg und in seiner Art abweisend – wie immer also. Es schien ihm gar nicht recht zu sein, dass sein Sohn es sich in einem Krankenhaus gutgehen lässt. Von meinem Leiden will er nichts wissen: Die lange Reise hierher scheint Mutter ihm abgerungen zu haben. Allerdings kann auch sie mich nur schwer anhören, da sie dazu neigt, alles als große Glaubensfrage aufzufassen. Also auch hier: wie immer!
Daher habe ich beschlossen, meine Worte sorgsam zu wählen. Auch wenn ich mich selbst derzeit nicht verstehen kann, so ist es doch eine Art stummes Trauern, wenn man sich vor den eigenen Eltern nicht öffnen kann – oder darf?
Mutter hatte einige Zeichnungen und eine Karte von Deinen Kindern mitgebracht – kein Wort darauf von Sigrid. Ich muss gestehen, ich war sehr gerührt. Als ich mir jedoch die kleine Zeichnung Deiner Tochter näher ansah, musste ich etwas schmunzeln. Agnes hatte unter anderem eine Fahne mit dem Hakenkreuz gemalt – allerdings verkehrt herum! Heinrich grüßt stramm »mit deutschem Gruß«, so weit ist es gekommen!
Mutter hätte wohl nicht davon gesprochen, wenn Vater im Raum gewesen wäre – sie will ja alles von ihm fernhalten. Auch wenn ich es anders wünschte, fürchte ich, Vater ist unversöhnlicher denn je. Daher ist es gut, wenn wenigstens wir beide im Kontakt stehen! Vielleicht öffnet die Zukunft Türen, die Dir heute noch versperrt sind.
Über unseren Bruder haben die beiden nicht gesprochen. Zudem hat er mich weder hier besucht, noch habe ich brieflichen Kontakt mit ihm. In den letzten Jahren waren die Begegnungen rar gesät, da er recht weit entfernt kaserniert war. Er war immer fest in seinen Überzeugungen, das wird auch jetzt so sein. Vielleicht will er Vater zeigen, dass er »ein ganzer Kerl« ist und für das Vaterland zur Waffe greifen kann. Ich weiß es nicht und es ist mir ehrlich gesagt auch gleich! Weder er noch Vater hatten jemals Interesse für meinen Weg, von Verständnis ganz zu schweigen. Ich weiß, Du musstest das ähnlich erfahren.
Eigentlich müsste ich mir wünschen, bald wieder entlassen zu werden. Aufgrund der Entwicklungen im Land und des als unvermeidbar geltenden Krieges fühle ich mich hier jedoch sicher. Insofern muss ich auf das Schicksal vertrauen und mich den Behandlungen der Ärzte unterwerfen.
Ich hoffe, dass Du bald wieder Gelegenheit findest, zu schreiben. Bis dahin sende ich Dir die besten Wünsche von hier.
Viele Grüße aus der Heimat,
Paul
*
»Mir scheint, die frischen Knospen sind ein gutes Zeichen in diesen wilden Zeiten«, sinniert Perry Breddenburg und betastet vorsichtig die zarten Blütenansätze.
Holm prüft den Zustand des Rhododendron-Bestandes; der Gast begleitet ihn, um eine Pause von der schweißtreibenden Holzarbeit zu nehmen. Die Nachrichten dieser Tage lassen eine Konzentration auf die täglichen Aufgaben kaum zu.
Mit starkem amerikanischen Akzent bemerkt Breddenburg: »Wenn ich mir dagegen die Schlingpflanzen dort drüben anschaue, ist das eher ein Sinnbild für Expansion. Naja, ist auch eine Form von neuem Leben.«
Holm hält mit seiner Arbeit inne und sieht den anderen verwundert an. Seit einigen Tagen ist der alternde Schriftsteller nun in Doorn. Offenbar ist er ein scharfer Beobachter, wenn auch nicht alles eine solide Grundlage zu haben scheint, was er von sich gibt.
In dieser Sache hat Breddenburg vermutlich recht, denkt Holm.
Er betrachtet die aufsprießenden Unkräuter in den Beeten.
»Expansion bringt selten neues Leben, eher im Gegenteil. Zumindest, was die Vielfalt der Arten angeht«, erklärt Holm. Der Einmarsch der Wehrmacht in die Tschechei und der Anschluss des Memelgebietes sind gewiss keine Zeichen für eine friedliche Koexistenz.
»Was werden Sie tun, wenn die Deutschen auch nach Holland gehen?«
Breddenburgs Frage erscheint Holm ein wenig zu persönlich, so dass er sich lieber wieder den Pflanzen zuwendet.
»Was auch Pflanzen tun sollten, wenn eine aggressive neue Art auftritt: eine eigene Abwehr entwickeln oder ausweichen«, antwortet Holm.
»Aber Sie sind doch Deutscher, was haben Sie zu befürchten?«
»Ich kann nicht einschätzen, was Seine Majestät tun wird. Das müssten Sie selbst besser beurteilen können – so lange, wie Sie ihn kennen.«
»Wilhelm?« Breddenburg lacht lauthals, so dass sein langer weißer Bart heftig in Bewegung gerät. »Der wird seinen Garten niemals verlassen, da bin ich mir sicher!«
Plötzlich wirkt der Amerikaner nachdenklich.
»Wissen Sie, als die Sache mit Hitler anfing, da war ich mir ziemlich sicher, dass die Nazis den Kaiser nach Hause holen würden.«
Das ist nicht geschehen und wird auch niemals geschehen, denkt Holm. Das Leben in Doorn hatte bis auf wenige Ausnahmen absolut nichts mehr mit dem neuen Reich zu tun.
»Nun, vielleicht ist es auch andersherum besser«, korrigiert sich der Schriftsteller. »Vielleicht muss die Bewegung von hier ausgehen – bring the Kaiser home, man, bring him home!«
Die Schlagzeile klingt gut, denkt Holm, bring the Kaiser home.
»Denken Sie, die neuen Herrscher räumen in absehbarer Zeit freiwillig das Feld?«
Perry Breddenburg wirkt ernst, als er nach einiger Überlegung Antwort gibt.
»Das letzte Kaiserreich hat keine fünfzig Jahre überdauert, die Republik nicht einmal zwanzig. Wie auch immer Sie es persönlich sehen wollen: Die Deutschen werden nicht ewig dem Führer hinterherrennen. Zugegeben, früher habe ich das etwas anders gesehen.«
Höflich, aber bestimmt wechselt Holm das Thema:
»Wie beurteilt man denn die aktuellen Ereignisse in Amerika?«
»Das kommt ganz darauf an, wen Sie fragen«, erwidert Breddenburg mit einem schelmischen Grinsen.
Genau wie in Doorn, pflichtet Holm ihm ohne Worte bei.
Erst vor Kurzem war er unfreiwilliger Zeuge einer lautstarken Diskussion geworden, die sich zwischen Ilsemann und Freiherr von Grancy, einem der diensthabenden Herren, in der Nähe des Holzhackplatzes entlud. An Jans Äußerungen im Anschluss konnte er ablesen, dass die Bewertung des Vorgehens der Nazis häufig Thema und durchaus Schwankungen unterworfen war. Immer wieder Streitpunkt: Wie soll sich der alte Kaiser zum Reich positionieren? Einige fordern den Kaiser auf, seinen Einfluss in Deutschland zu vergrößern und für die eigene Sache zu nutzen. Andere vertreten die Ansicht, dass Hitler dem alten Kaiser längst einen Platz im epischen Spiel der Kräfte zugewiesen hat: den einer unbedeutenden, nutzlosen Randfigur.
*
Als Holm Pauls Brief am späten Abend noch einmal liest, ist er in seinen Gefühlen hin- und hergerissen. Einerseits ist er froh, dass sein jüngerer Bruder seine Bemühungen erwidert und geantwortet hat. Anderseits beschleicht ihn ein ähnlich bedrückendes Gefühl wie nach dem Gespräch mit Anni Brandt. Er zweifelt, er hadert, ob er den unausweichlichen Themen standhalten kann.
»Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los«, notiert er als Überschrift für diesen Tag, in Erinnerung an das Gedicht Goethes, das er in der Schule nur unter Mühe auswendig wiedergeben konnte. Lyrik ist alles andere, aber nicht sein Steckenpferd.
Holm versucht, seine Gedanken und Gefühle zu sortieren, was ihm angesichts der Fülle der unterschiedlichen Aspekte in Pauls Brief sehr schwerfällt. Vieles hatte er in der Zeit im Rheiderland beiseiteschieben können, aber in Doorn ticken die Uhren anders.
Pauls Brief ist ein Zeitensprung in die Vergangenheit. Über seinen Bruder Walter hatte Holm eine Ewigkeit keine Nachrichten gehört. Obwohl die beiden auf besondere Art verbunden sind, steht ihm Paul trotz des großen Altersunterschiedes viel näher, und das seit jeher. Seine Eltern scheinen sich laut Pauls Beschreibung in ihrem Verhalten nicht verändert zu haben – diese Hoffnung hatte Holm in Bezug auf seinen Vater ohnehin längst aufgegeben. Er spürt, wie der Ärger und die Wut wieder Oberhand gewinnen und wischt die Gedanken beiseite. Jedoch, so sehr er sich auch müht, nach vorne zu schauen: Die Aufgaben werden nicht kleiner oder angenehmer.
Schließlich schlägt Holm das Notizbuch zu. Müde und doch voll Anspannung reibt er sich zuerst den Nasenrücken, dann den Nacken.
Ilsemann ist für einige Wochen in Deutschland und wird, wie es seine Art ist, einen unverfälschten Überblick über die Lage geben können. Kurz ertappt Holm sich bei dem Gedanken, seine freien Tage für einen Besuch bei Paul zu nutzen. Kopfschüttelnd registriert er, dass diese Intention für ihn zu früh kommt.
Er denkt zurück an das Gespräch mit Breddenburg. Wie sagte der Amerikaner?
»Bring the Kaiser home.« Andererseits war sich der alte Weggefährte aus Potsdamer Zeiten sehr sicher, dass Seine Majestät seinen Garten nie verlassen würde. Mit diesem Widerspruch im Kopf schläft Holm endlich ein, befreit von der Last der Gedanken.
*
»Diese Bank scheint es Ihnen angetan zu haben«, spricht ihn Annegret, das Dienstmädchen, mit einem breiten Grinsen an. Sie scheint wie aus dem Nichts aufgetaucht zu sein, nicht einmal das Klappern ihres alten Fahrrads hatte er wahrgenommen.
»Das Schicksal geht seltsame Wege«, bemerkt Holm trocken, ohne sein Lehrbuch zur Seite zu legen.
»Ich sehe, diesmal leistet Ihnen Else Böhler keine Gesellschaft?«
»Nein, die Lektüre ist mir im Moment zu schwer, gewissermaßen.«
Sie stellt ihr Fahrrad ab und setzt sich zu ihm auf die Bank, an der Straße zwischen Doorn und Maarn. Sofort fällt ihm ihr langes, offenes Haar auf, das in der Frühlingssonne glänzt. Wie auf Zuruf streicht sie sich mit den Fingern einige Strähnen aus dem Gesicht, so dass er einem Blick in ihre tiefdunklen Augen nicht ausweichen kann. Sie sitzt ein klein wenig näher, als man es normalerweise tun würde.
»Sie leben in Maarn?«, fragt er so beiläufig wie möglich.
»Genau in dieser Richtung«, zeigt sie in den Wald.
»Ich sehe Sie selten im Dienst«, stellt er fest.
»Außer Sie liegen gerade im Schlamm oder lassen sich vom Doktor verarzten.« Ihre Witzeleien treffen ihn kurz, dann muss er selbst schmunzeln.
»Ich komme nicht oft aus dem Haupthaus heraus, und dort gibt es eine eigene Nebentreppe für das Dienstpersonal. Ich komme so gut wie nie mit den Majestäten oder den deutschen Herren zusammen. Diese Dienste führt das deutsche Personal aus.«
Holm wundert das, zumal die junge Frau die deutsche Sprache hervorragend beherrscht. Das interessiert ihn: »Wie haben Sie so gut Deutsch sprechen gelernt?«
Sie zögert etwas, weicht dann mit einem Lächeln aus. »Das ist eine lange Geschichte. Ich will und kann Sie mit den Details nicht langweilen.«
»Ich habe es nicht eilig«, erwidert er und legt sein Buch nun doch beiseite.
»Leider muss ich Sie auf einen anderen Zeitpunkt vertrösten, da bei mir die Zeit etwas drängt.«
»Sie werden erwartet«, bemerkt Holm bewusst zweideutig.
Annegret kichert und spielt sein Spiel mit. »Vielleicht? Warum interessiert Sie das?«
Ihm fehlt die passende Erwiderung.
»Dann muss ich auf die Offenbarung Ihres Geheimnisses wohl verzichten ...«
»Nein, im Ernst: Ich muss jetzt wirklich gehen. Heute Abend bin ich wieder im Dienst, da bleibt leider nicht viel Zeit für Geschichten. Und vielleicht ist meine ja gar nicht so interessant, wie Sie denken?«
Sie nimmt ihr Fahrrad und sieht ihn an – für einen Augenblick treffen sich ihre Blicke.
Funkelnde, dunkelbraune Augen – eigentlich untypisch, beobachtet Holm.
»Ich würde mich trotzdem freuen, Ihre Geschichte zu hören«, sagt er.
»Ja. Aber dann möchte ich auch mehr über die Gründe wissen, warum Sie ausgerechnet nach Doorn gekommen sind!«
Sie nimmt seinen nachdenklichen Gesichtsausdruck wahr; besser, als er selbst sein Gefühl beschreiben könnte.
Einige Sekunden ist es still, dann fasst er sich und sagt: »In Ordnung. Morgen, gleiche Zeit, gleicher Ort?«
Sie überlegt kurz, nickt und sagt: »Gerne. Und bringen Sie Ihr Buch wieder mit!«
Holm schaut ihr versonnen nach.
Meine Geschichte, das dürfte nicht ganz einfach werden.
Vielleicht ist doch alles Schicksal? Wer weiß ...
Als er sein Fahrrad nimmt, entdeckt er im letzten Moment sein Buch auf der Bank: »Nederlands leeren, van Laurens Blikkx en Braam Duvel«. Als er sich die Namen der Autoren genauer ansieht und sie ausspricht, muss er plötzlich laut lachen. Mehr als einmal hatte er diesen Ausruf in seiner Zeit bei Hesse gehört, wenn den Einheimischen wieder einmal etwas missglückt war.
Seine Mutter würde vor Scham im Boden versinken, könnte sie ihn über den üblen Fluch so lachen hören!
*
Die beiden alten Herren beim Entenfüttern in der Sonne zu beobachten, hinterlässt bei Holm einen schwer zu beschreibenden Eindruck. Der alte Kaiser und der Schriftsteller, etwas abseits der Kammerdiener, der das Brot auf einem Teller anreicht – und die Enten, die sich trotz ihres wohlgenährten Zustandes gierig auf jeden Brocken stürzen, der in die Gracht fällt. Gewissermaßen ist es eine sehr harmonische Szene, die die lange Freundschaft der beiden Weggefährten unterstreicht. Ein besonderer Humor scheint die Männer zu verbinden: Im minütlichen Wechsel fängt der Eine auf eine Bemerkung des Anderen lauthals an zu lachen.
»Perry, Du bist und bleibst ein Scherzbold!«, hört Holm den alten Kaiser sagen, nachdem beide sich von ihren letzten Lachanfall erholt haben.
Dennoch kann Holm sich des Gefühles nicht erwehren, dass diese Szene vergänglich, ja fragil ist – und das nicht nur aufgrund des hohen Alters der Hauptdarsteller. Für einen Moment lässt er sich von dem seltsam melancholischen Gedanken erfassen, wie sehr der alte Kaiser in Doorn doch fern von dem ist, was er einmal war. In Holms Kindertagen hatte man zum Kaiser aufgesehen, der zumindest vordergründig die Geschicke des Reiches lenkte. Was wirklich war und was Fassade, konnte er damals nicht durchschauen. Der Glanz der Hohenzollern, der Prinzen und hohen Herren, hatte auch bis ins nüchtern-hanseatische Hamburg gestrahlt.
Nach dem Krieg, als Holm zu einem jungen Mann herangewachsen war, hatte sich alles verändert. Der Großteil der Bevölkerung zeigte den einstigen Herrschern die kalte Schulter und suchte nicht erst seit der großen Krise nach einem Schuldigen für das ganze Elend. Der Kaiser aber war fort – geflüchtet, statt mit zigtausenden Soldaten im Abwehrkampf gegen die vorrückenden Truppen der Entente heldenhaft im Feld zu bleiben. Die Not der einfachen Menschen hatte den Glanz der Adelshäuser nun schmerzhaft grell erstrahlen lassen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Druck ins Unermessliche wuchs, den Großteil dieses Reichtums zu teilen. Es ging ums Überleben, nicht um die Farbe des Blutes.
Holm schüttelt den Gedanken rasch ab. Für Schwärmereien oder Mitleid für die adeligen Häuser gibt es in seiner Welt keinen Raum.
Führt der alte Kaiser nicht ein äußerst angenehmes Leben, in erbaulicher Gesellschaft seiner Herren und einer fünfzigköpfigen Dienerschaft? Ist sein Auskommen in Doorn nicht abgesichert, auch das seiner Kinder und Kindeskinder?, rückt Holm seine Perspektive zurecht.
»Herr Leinstermann, auf ein Wort!«, ruft ihn Breddenburg heran. Holm wird aus seinen Gedanken gerissen. Der alte Kaiser ist bereits mit dem Kammerdiener auf der Treppe zum Haupteingang, nur der amerikanische Schriftsteller ist zurückgeblieben.
»Gehen wir ein Stück?«, fragt er.
Sie wenden sich dem Park zu und schlendern wortlos in Richtung Rosengarten. Piet, Jan und die anderen sind im Pinetum beschäftigt, so dass die beiden Männer allein bleiben.
Holm begutachtet die Rhododendren, während Breddenburg ihm zusieht. Etliche Blütenknospen sind grau-braun, teilweise sind die Zweige bis weit hinunter abgestorben. Holm schüttelt den Kopf, als Breddenburg näher kommt.
»Da sieht nicht gut aus«, bemerkt der Amerikaner. »Bei uns zu Haus habe ich vergleichbares noch nicht gesehen.«
»In der Tat, diese Schäden bereiten uns Sorgen! Auch bei meiner alten Stelle waren Pflanzen befallen. Es hilft ein wenig, wenn man die kranken Zweige herausschneidet.« Holm zieht seine Rosenschere, trennt ein befallenes Stück ab und betrachtet die Knospe genauer. Feine Härchen bedecken die Oberfläche.
Pilzbefall! Aber woher?
»Sonst kann man nichts tun?«, fragt Breddenburg interessiert nach.
Holm schüttelt langsam den Kopf. »Die Lösung des Problems steht noch aus.«
Breddenburg betrachtet eine befallene Pflanze und denkt angestrengt nach.
Er ist ein aufmerksamer Beobachter, stellt Holm erneut fest.
»Haben Sie schon einmal an Gas gedacht?«, fragt Breddenburg, während er einen Zweig betastet.
»Wie meinen Sie das?«
»Nun, vielleicht könnte man die Schädlinge gewissermaßen ausräuchern. Vergasen.«
Holm wägt kurz die praktische Machbarkeit ab. Bei Verkaufsware könnte es gehen, wenn sie bereits zum Versand ausgegraben ist. Er ist interessiert.
»Das könnte eine Möglichkeit sein. Wie sind Sie auf diesen ausgefallenen Gedanken gekommen?«
Breddenburg muss lachen: »Freut mich, wenn ich Ihnen helfen kann. Aber ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken: Die Idee stammt von Wilhelm!«
Holm ist völlig irritiert, was der Amerikaner deutlich in seinem Gesichtsausdruck ablesen kann.
»Hat der alte Kaiser das Ihnen gegenüber vorgeschlagen?«, fragt Holm.
Breddenburg wird ernst. »Gewissermaßen, ja.« Er zögert, fortzufahren.
»Wollen Sie mich in Kenntnis setzen? Ich meine, sollte es eine Möglichkeit geben, durch diese Methode die Pflanzen zu heilen, wäre das doch sehr hilfreich.«
Der Amerikaner räuspert sich. »Hören Sie, vor einigen Jahren erhielt ich einen Brief von Wilhelm. Ich weiß nicht, wie eng Ihr Kontakt zum Kaiser und den Herren aus Deutschland ist, aber es gibt dort ... bei einigen Haltungen, die denen im Reich nicht unähnlich sind. Auch in dem Grad der Radikalität.« Er macht eine Pause, zieht seine Rauchutensilien aus der Hemdtasche und steckt sich eine Zigarette an.
»Wollen Sie?«
»Nein, Danke. Ich glaube, der Qualm ist nicht gerade förderlich für die Gesundheit.«
»Wie Sie meinen«, entgegnet Breddenburg und steckt das Etui wieder zurück. Eine Weile stehen Sie schweigend nebeneinander, dann findet der Amerikaner die Sprache wieder.
»Wilhelm war seinerzeit sehr aufgewühlt. Die alten Geschichten, verstehen Sie? Die Republik, die Frage der Kriegsschuld, die Kommunisten, die Sozialdemokraten, die Juden ... All diese ... Dinge. Ich meine, verstehen Sie mich nicht falsch: Ich sehe einen Juden auch lieber von hinten als von vorn, am liebsten gar nicht!« Er nimmt einen tiefen Zug und haucht den Rauch kunstvoll in kleinen Wölkchen aus.
»Wo ist der Zusammenhang?«, fragt Holm nach. Er will nicht ungeduldig erscheinen, ist aber sehr an einer Lösung der Rhododendron-Krankheit interessiert.
»Nun, Sie müssen wissen, es war damals eine schwierige Zeit für Wilhelm«, erklärt der Amerikaner. »Und er war wohl auch sehr aufgebracht, als er den Brief schrieb.«
Wieder ein tiefer Zug an der Zigarette.
»Seine Stimmungen wechseln manchmal sehr plötzlich: In einem Moment ist er voller Hoffnung, wenig später völlig niedergeschlagen. Man kann herzlich mit ihm lachen, aber die dunklen, einsamen Winkel in seinem Gemüt zu ertragen, ist eine ganz andere Sache.«
»Das kann ich mir vorstellen.«
»Es fällt mir nicht leicht, das zu sagen, Herr Leinstermann – und ich möchte auch nicht, dass Sie einen falschen Eindruck bekommen!« Breddenburg zögert wiederum, blickt auf den verbliebenen Zigarettenstummel, wirft ihn zu Boden und tritt die Glut aus. »Gewissermaßen waren sie für ihn wie lästige Insekten, wie Schädlinge. Sie sollten einfach verschwinden, weg!«
»Wer?«
»Na, die anderen. Die Sozialdemokraten, die Kommunisten, die Juden. Da kam ihm diese Idee ...«
»Ich fürchte, ich verstehe«, bemerkt Holm abgestoßen.
Breddenburg hebt den zertretenen Zigarettenstummel auf und schaut ihn versonnen an. Beide stehen eine gefühlte Ewigkeit ohne Worte beieinander. Schließlich löst Holm die Situation und befreit den Schriftsteller aus seiner Erklärungsnot.
»Es wird für unser Problem mit den Rhododendren eine andere Lösung geben. Vielleicht eine, die weniger radikal ist.«
Breddenburg hat seine Freundlichkeit wiedergefunden und lächelt verlegen.
»Gehen wir noch ein Stück weiter?«
*
Als er nach dem Mittag wieder zu seinen Leuten kommt, ist Holm in Gedanken noch bei der rätselhaften Rhododendron-Erkrankung. Sollte der Befall durch Insekten verursacht oder übertragen werden, würden sich die Übeltäter wahrscheinlich bald zeigen.
Beim Pinetum angekommen, schlägt ihm Gelächter entgegen. Sofort werden ungute Erinnerungen an den Sturz mit dem Fahrrad wach – doch diesmal halten sich die Urheber nicht verborgen, sondern schauen ganz offen und unverblümt in seine Richtung.
»Darf ich den Grund für die Erheiterung erfahren?«, fragt Holm argwöhnisch.
Wieder nur Gelächter.
Piet fasst sich zuerst: »Es ist Ihre Hose!«
Holm ist verunsichert. »Meine Hose? Was ist damit?«
Das Gelächter steigert sich, Holm wird ungehalten: »Verdammt nochmal, heraus mit der Sprache! Was ist mit der Hose?«
Jan versucht, ernst zu werden: »Sie müssen wissen, Pumphosen haben in Doorn eine gewisse Tradition.«
Wieder Gelächter.
Piet ergänzt: »Schön gesagt, Jan! Es gab mal einen Gast, der mit so einer Hose bei den kaiserlichen Hoheiten etwas unangenehm aufgefallen ist.«
Zunächst ist Holm noch erbost, muss dann aber selbst schmunzeln.
»Nun, mit dieser Hose würde ich mich auch nicht an die kaiserliche Tafel setzen.«
»Eben! Nichts für ungut, Chef. War diesmal nichts gegen Sie persönlich.«
Holm ist überrascht, hat Piet doch seit ihrem Gespräch im Dienstzimmer kaum mit ihm geredet. Er wirkt insgesamt sehr aufgeräumt in den vergangenen Tagen.
Sie gehen gemeinsam ihrer Arbeit nach, bis Holm die Verabredung mit Annegret wieder einfällt. Es wird Zeit, sich auf den Weg zu machen.
»Sie gehen schon, Chef?«, fragt Piet mit leichter Ironie in der Stimme nach.
Holm fühlt sich in Erklärungsnot, hatte er in der Vergangenheit Piets Unzuverlässigkeit doch immer bemängelt.
»Ja, ein wichtiger Termin.«
Piet nickt – kein Kampf heute.
»Eine Frage noch! Nur aus reinem Interesse: Wer war dieser Gast mit der Pumphose?«
Die Männer schauen sich an und beginnen dann wieder zu kichern.
Piet deutet mit seinen Händen einen fülligen Leib an.
»Der Zwilling von Prinz Eitel: der fette Göring!«
*
Die Wartezeit auf der Bank ist kurz. Bald nach ihm erscheint Annegret mit dem Fahrrad.
»Ich sehe, Sie halten sich an Abmachungen«, sagt sie.
»In der Regel schon.«
Die junge Frau setzt sich zu ihm. Sie sitzen schweigend nebeneinander und schauen der Sonne beim Untergehen zu.
»Nun, was ist Ihre Geschichte?«, beginnt Holm schließlich.
»Was wollen Sie wissen?«
»Zum Beispiel, warum Sie so gut Deutsch sprechen.«
»Das ist einfach: Deutsch ist meine Muttersprache, ich bin in Deutschland geboren.«
Das erstaunt Holm wenig. In seiner Zeit in Doorn hatte er von zahlreichen Deutschen gehört, die seit Jahren in den Niederlanden lebten.
»Das hätten wir also geklärt«, stellt er fest. Bevor er weitersprechen kann, hat Annegret ihn unterbrochen.
»Ich denke, jetzt bin ich an der Reihe.«
»In Ordnung, fragen Sie nur.«
»Gibt es eine Familie in Ihrem Leben? Man sieht Sie immer nur allein.«
Volltreffer, denkt Holm.
Er kommt in Erklärungsnotstand, sucht nach Antworten, erwägt und verwirft Erläuterungen. Holm entscheidet sich für die Wahrheit – in eng gezogenen Grenzen.
»Die gab es«, sagt er möglichst vieldeutig.
Annegret sieht ihn aufmerksam an, kann jedoch keine Gefühlsregungen ausmachen.
»Sie sind dran«, sagt sie.
»Warum nehmen Sie diesen gottverlassenen Weg am Wald entlang?«, fragt Holm. »Ist das nicht gefährlich, gerade abends in der Dunkelheit? Jemand könnte Ihnen auflauern.«
Annegret lacht. »Herr Leinstermann, wir haben vielleicht nur ein paar Minuten für ein Gespräch – und Sie fragen mich nach meinem Arbeitsweg?«
»Meine Frage. Was ist Ihre Antwort?«
»Man trifft kaum jemanden – von Ihnen einmal abgesehen. Aber eigentlich ist es so: Dort bin ich im Dienst«, sie zeigt nach Doorn, »hier bin ich frei.« Sie öffnet ihr noch gebundenes Haar und lässt es durch die Finger gleiten. »Viele können diese Freiheit nicht akzeptieren! Sie müssen wissen, offene Haare werden von den Männern hier gerne als Einladung für Annäherungen verstanden.«
»Ich verstehe. Warum können ...«
»Nein, ich bin an der Reihe!«
Holm gefällt ihre Schlagfertigkeit. Sie genießt das Spiel offensichtlich.
»Warum gerade Doorn?«, fragt Annegret.
»Meine letzte Arbeit war abgeschlossen, ich suchte nach etwas Neuem«, erklärt er. »Dann gab es einen Artikel in einem Fachblatt für Gärtner, der Gartenwelt. Nichts Weltbewegendes, aber interessant.«
»Worum ging es da?«
»Das ist schon Ihre zweite Frage ...« – Annegret schaut ihn künstlich beleidigt an – »... aber ich will nicht so sein. Es ging um den Besuch einer Delegation aus New York in Doorn. Ich glaube, im Frühjahr des vergangenen Jahres.«
»Daran kann ich mich gut erinnern!«, sagt Annegret. »Ihre Arbeiter waren eine ganze Weile damit beschäftigt, wie verrückt Blumenzwiebeln zu pflanzen.«
Holm nickt und kramt in seinem Gedächtnis. »Ich glaube, es war die Horticultural Society, genau. In dem Artikel wurde über den möglichen Export von holländischen Blumenzwiebeln nach Amerika berichtet.«
»Was würde besser passen, als den Damen und Herren Huis Doorn im Blütenmeer zu präsentieren? Ich fand es wunderbar! Sogar schwarze Tulpen waren dabei«, schwärmt sie. »Übrigens haben die Amerikaner als Geschenk einige seltene Pflanzen mitgebracht, die Ihr Vorgänger im Hermo-Garten gepflanzt hat. Aber: Das ist doch nicht der wirkliche Grund für Ihr Kommen, oder?«
»Natürlich. Was glauben Sie denn?«
»Jeder Deutsche, der hier anheuert, will doch nur ein bisschen vom Glanz vergangener Tage! Zumindest, was die älteren deutschen Herren betrifft.«
»Älter? Danke für das Kompliment! Und: Nein, auf so etwas gebe ich nichts. Was soll ich mit Glanz?«
Annegret lacht. »Ein bisschen Glanz würde Ihnen vielleicht ganz gut zu Gesicht stehen.«
Holm rümpft die Nase. »Eines Tages werde ich Ihre schonungslose Offenheit wahrscheinlich vermissen. Ich glaube, ich mache mich jetzt auf den Rückweg!«
»Nun seien Sie doch nicht gleich eingeschnappt, Herr Leinstermann! Ich räume die Möglichkeit ein, dass Sie anders sein könnten als die anderen, was Ihre Motive betrifft. In Ordnung?«
Holm nickt. Während er seine nächste Frage überlegt, fällt sein Blick auf Annegrets Hände; sie sind von Arbeit gezeichnet, voller Hornhaut, Schwielen und kleiner Risse.
Nicht anders als seine – nur sauberer.
»Da Sie nun wissen, was mich nach Doorn führt: Warum arbeiten Sie dort?«
Sie gibt sich betont gelangweilt: »Das ist wieder keine besonders kreative Frage, Herr Leinstermann.«
Beide müssen schmunzeln.
»Also gut: Der Kaiser bezahlt sehr gut, und durch den Abenddienst habe ich die Möglichkeit, noch etwas extra zu verdienen.«
Holm will zu einer Nachfrage ansetzen, hält sich aber dann doch an ihr Prinzip.
Annegret schmunzelt, während sie ihre nächste Frage stellt: »Wie kommen Sie mittlerweile mit den Gartenarbeitern zurecht?«
»Derzeit ganz ordentlich! Oh, ich habe es bisher versäumt, Ihnen für das Überbringen der Einladung neulich zu danken.«
»Keine Ursache«, sagt Annegret in Erwartung seiner nächsten Frage.
Holm überlegt einen Moment. Das Sonnenlicht färbt sich in der kälter werdenden, klaren Luft langsam orange; es bleibt ihnen nicht mehr viel Zeit.
»Wie ist das Leben in den Niederlanden für Sie?«
Sie staunt über die seltsame Frage, hat sie doch anderes erwartet. »Zunächst einmal ist das hier unsere Heimat.«
»Inwiefern? Ich denke, Sie sind Deutsche?«
»Nein, ich sagte, ich wäre in Deutschland geboren. Meine Familie hat dort nichts mehr gehalten. Das heißt, mein richtiger Vater ist früh gestorben, Mutter ist dann mit mir nach Holland gegangen. Sie hat hier wieder geheiratet und noch drei Mädchen zur Welt gebracht. Ihr zweiter Mann war ein Eisenbahnarbeiter aus Maarn. Aber leider währte auch dieses Glück nicht ewig. Sein Name ist ... war Braam. Braam Dijkstra.«
»Hören Sie, ich wollte nicht ...«
»Nein, das ist schon in Ordnung.« Annegret legt Holm sanft die Hand auf den Arm. Die Berührung kommt für ihn überraschend, ist aber nicht unangenehm.
»Jetzt sind wir mit Mutter fünf Weiber und schlagen uns durch, so gut es geht. Vater ist vor drei Jahren bei einem Unfall im alten Stellwerk schwer verletzt worden. Eine Woche später war er tot.«
Sie sitzen schweigend beieinander, während das Sonnenlicht immer schwächer wird und die abendliche Kälte in die Kleidung zieht.
»Ich muss jetzt gehen«, sagt Annegret und wendet sich zum Fahrrad. Holm gerät in Hektik: Er würde gerne noch etwas sagen, kann aber keinen hilfreichen Gedanken finden. Während Sie sich schon auf ihr Gefährt schwingt, ruft er: »Hören Sie, es tut mir leid!«
»Kein Problem, Herr Hofgärtner! Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder!«
Dann fährt sie mit wehendem Haar in das letzte bisschen Sonnenlicht – und lässt Holm ratlos zurück.
*
Als Holm am Abend seine Tagesnotizen noch einmal liest, kann er die heutigen Erlebnisse und Begegnungen nicht recht zuordnen. Immerhin, die Arbeit mit Piet ist in den letzten Tagen positiv verlaufen – auch das hält er fest. Aber der Rest?
Folgerichtig ist die Nacht unruhig für ihn. Die Themen des Tages verweben sich zu einem wirren Traum, der Holm einmal mehr unglaublich real erscheint:
Als Seine Majestät mit dem Gast bedächtig zum Holzhackplatz schlendert, ist ihr lebhaftes Gespräch bereits wieder in vollem Gange. Wirkte der letzte Besuch noch von Distanz und Argwohn geprägt, glänzen jetzt die Augen Seiner Majestät, und sein rechter Arm wird nicht müde, seinen Gedanken durch umfassende Gesten Nachdruck zu verleihen.
Schließlich kommen sie auf die Juden zu sprechen. Dieses Thema scheint den Gast besonders zu interessieren; durch geschickte Nachfragen und Anregungen versteht er es, dass der alte Kaiser seinen Gedanken und Ideen freien Lauf lässt und ganz offen spricht.
»Wenn ich erst wieder auf meinem von Gott vorgesehen Platze bin, wäre es mir am wohlsten, sie würden gänzlich verschwinden.«
»Da bin ich ganz Ihrer Ansicht«, entgegnet der Gast, »und seien Sie versichert, auch der Führer teilt diesen Gedanken aus tiefstem Herzen.«
»Es gibt einfach in dieser Welt ein paar Dinge, von denen man die Menschheit befreien müsste ...« Der Blick Seiner Majestät wandert über die Rhododendren des Hermo-Gartens. »Die Presse, die Kommunisten, die Juden – die sind doch wie eine biblische Mückenplage!«
»Nicht zu vergessen die Sozialdemokraten!«, wendet der andere mit erhobenem Zeigefinger ein.
Der Ex-Kaiser hört nicht zu, sondern betastet mit prüfendem Blick die abgestorbenen Rhododendronblüten.
Diese verdammten Schädlinge! Gibt es denn keine Möglichkeit, den Pilzbefall auf Hermos Lieblingen aufzuhalten? Wie oft hatte er sich schon anhören müssen, dass er ein ganzes Heer von Gartenarbeitern beschäftigt, inklusive Obergärtner! Und trotzdem kann niemand dem Pflanzensterben Einhalt gebieten!
Gedankenverloren, mehr zu sich selbst sagt er: »Vielleicht sollte man Gas probieren ...«
»Gas? Wie meinen Sie bitte?«
Der alte Kaiser schreckt auf, hatte er seinen Besuch doch für einen Moment aus den Augen und aus dem Sinn verloren. »Ach, ich war ganz in Gedanken, wie ich vielleicht ein drängendes Problem lösen könnte, das mir zurzeit viel Ärger bereitet.«
Göring, heute wieder in Pumphosen, lächelt und nickt.
»Interessanter Gedanke. Das sollte ich vielleicht bei Gelegenheit mit dem Führer besprechen.«
Als Holm erwacht, schüttelt er den Kopf.
Was für ein schräger Traum!