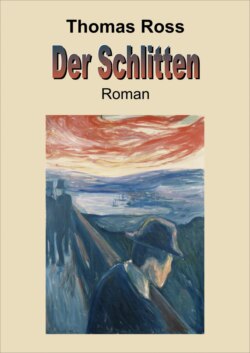Читать книгу Der Schlitten - Thomas Ross - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8
ОглавлениеDem Untersuchungsbericht der Rechtsmedizin war zu entnehmen, dass „die Tatmerkmale mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein sexuell motiviertes Tötungsdelikt schließen lassen.“ Die Leichtfertigkeit, mit der dieses Schriftstück den Leidensweg meiner Tochter auf wenige kalte Zeilen reduzierte, war entsetzlich, doch nicht minder entsetzlich war die Leere, die sich hinter den Worten dieser seelenlosen Technokratensprache verbarg. Die Funktionäre haben der Sprache die Seele geraubt, sie haben ihr die Kraft der gesunden, reinen Empfindung genommen, entkernt wie die Pflaumen fürs Kompott. Im öffentlichen Raum ist kein Platz für echte Freude, für geteiltes Leid, für ungeheuchelte Anteilnahme? Der Objektivität des Urteils oder der Vernunft wegen, die Empfinden als eine Art Gift begreift? Das ist in höchstem Maße lächerlich. Denn liegt es nicht in der Natur des Menschen, objektiv Erfahrbares stets im Lichte eines Gefühls wahrzunehmen, das jeden auch nur halbwegs komplexen Sinnesreiz so notwendig begleitet wie die Hitze das Feuer?
Es waren Gedanken wie diese, die in den Tagen, als aus der Bangigkeit Gewissheit wurde, meinen Kopf fluteten, ich war ungehalten, ungeduldig, überdreht. Die Polizei machte ihre Arbeit durchaus so, wie man es von ihr erwarten durfte, aber mir ging alles viel zu zögerlich voran, und am liebsten hätte ich die Ermittlungen selbst in die Hand genommen, was natürlich unmöglich war. Das zuständige Kommissariat setzte einen Spezialisten ein, der versuchte, mich nach allen Regeln der psychologischen Kunst zu beschwichtigen. Vergebens. Meinen Beschuldigungen und Beschimpfungen hielt er zwar leidlich stand, am Ende aber siegte die Verzweiflung. Immerhin leistete er mir für einige Zeit Gesellschaft; ich nehme an, er tat es der Befürchtung wegen, ich könnte mir das Leben nehmen.
Man hatte mir Informationen über den Fortschritt der Ermittlungen zugesichert, die jedoch kaum über den Inhalt gewöhnlicher Pressemitteilungen hinausgingen. Die polizeiliche Ermittlungsarbeit dürfe nicht behindert werden, hieß es lapidar.
Die Polizei beauftragte eine Sondereinheit, setzte sich mit den umliegenden Gefängnissen und forensischen Krankenhäusern in Verbindung. Es galt, Hinweise über etwaige Geflohene zu erhalten. Am Tatort wurden Profiler eingesetzt, die Tat- und Tatumgebungsmerkmale mit wissenschaftlichen Erkenntnissen über das Persönlichkeitsprofil des Täters in Verbindung zu bringen suchten. Man erbat sich Amtshilfe aus anderen Bundesländern und durchforstete alle verfügbaren Datenbanken über Sexualstraftäter. Hundestaffeln wurden in die umliegenden Wälder geschickt, brauchbare Spuren wurden aber nicht gefunden. Die Polizei des benachbarten Auslands wurde in Alarmbereitschaft versetzt. Im Laufe der Ermittlungen gingen zahlreiche Anzeigen ein, die aber alle ins Leere führten, darunter auch eine eilends in Auftrag gegebene Genanalyse von mehreren hundert Männern.
Jenseits der polizeilichen Arbeit erwies sich die Suche nach dem Mörder als Possenspiel. Die Presse und das Fernsehen taten, was sie in solchen Fällen immer tun: Sie belieferten das schaulustige Volk mit dem Stoff, der die voyeuristische Gier nach fremdem Leid befriedigt. Der eigenen, von ängstlicher Unlust beherrschten, unscheinbaren Existenz muss der Schrecken der Vergänglichkeit genommen werden, sie muss um jeden Preis an Wert gewinnen. Gemeinhin erreicht man dieses Ziel über die Relativierung der eigenen an der noch größeren Misere anderer – eine aufgeklärten Menschen unwürdige, aber weit verbreitete Form des Umgangs mit der tief verankerten, die Schutzwälle philosophischer und religiöser Betrachtung niederreißenden und damit unerträglichen Befürchtung, dieses Leben könnte tatsächlich, an und für sich, sinnlos sein.
Kurzum, die Berichterstattung über die Jagd nach dem Phantom war unerträglich.
Natalie und ich waren bald auf uns allein gestellt. Mit Ausnahme der zahlreichen Anrufe neugieriger Sensationsjournalisten, die ich brüsk zurückwies, wagte niemand einen ernsthaften Kontaktversuch. Es blieb ja nicht aus, dass man sich irgendwann auf der Straße begegnete, aber wer es auch war, sie blickten verlegen zur Seite und machten sich schleunigst davon. In der allgemeinen Hilflosigkeit tat niemand das Notwendige. Ein Kopfnicken, eine freundliche Hand zum Gruß oder eine flüchtige Berührung hätten genügt, um daraus Anteilnahme abzuleiten, denn es bedarf nicht vieler Worte, um bei Menschen zu sein, die leiden, und noch weniger bedarf es der Worte, wenn der Grund für das Leid so schrecklich, so unfassbar ist.
Aber sie sind alle geflohen und haben uns allein gelassen, weil sie nicht wussten, wie man großem Leid begegnet. Es gibt keine Schulen für diese Kunst. Viel später erst habe ich begriffen, dass sie gar nicht anders konnten.