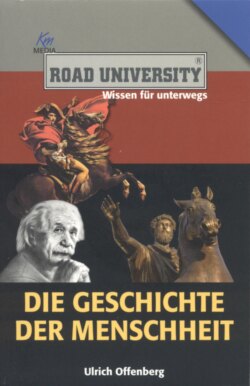Читать книгу Die Geschichte der Menschheit - Ulrich Offenberg - Страница 44
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die untergegangenen Völker und Reiche
ОглавлениеSelbst wenn nicht bekannt ist, in welcher Region in früheren Zeiten ein bestimmtes, längst untergegangenes Volk gelebt hat, können Wissenschaftler mittlerweile dessen genetischen Fingerabdruck in der heutigen Bevölkerung nachweisen. Im Selbstverständnis der Franzosen spielt die Erinnerung an das Kulturerbe der Gallier eine wesentliche Rolle. Die Glorifizierung der dakischen Ursprünge des Rumänentums nahm unter dem Diktator Ceausescu groteske Züge an. Die Goten sind im Dienste unterschiedlichster kultur- oder machtpolitischer Ambitionen vereinnahmt worden. Es waren zum Teil kulturell hochstehende, faszinierende Völker, die auf der historischen Welt-Landkarte ausradiert wurden.
Die Akkader. Sie gehörten zu den alten Kulturvölkern des Vorderen Orients. Als semitisches Volk mit kulturellem und sprachlichen Eigenprofil treten sie im 3. Jahrhundert vor Chr. im nördlichen Mesopotamien auf. Ihren Namen haben die Akkader von der Stadt Akkad, die von König Sargon um 2400 vor Chr. gegründet worden war. Das „Reich von Akkad“ hatte bis etwa 2255 v. Chr. Bestand. Danach ging die politische Macht an Assyrien, später an Babylonien über. Eine der zentralen Technologien war der Gebrauch der Keilschrift, deren System von den Akkadern perfektioniert wurde. Akkadisch war nicht nur als Literatursprache, sondern auch als Wissenschaftssprache in Gebrauch. Als Kanzleisprache fungierte es in Assyrien und Babylon. Als Sprache der internationalen Diplomatie reichte der Einfluss des akkadischen sogar bis nach Ägypten.
Aksum. Im Verlauf des 1. Jahrhunderts v. Chr. wanderten Migranten aus dem Süden der arabischen Halbinsel ins Abessinische Hochland ein. Dort kam es zur ethnischen Fusion der arabischen Bevölkerunggruppen mit der einheimischen kuschitischen Bevölkerung. In der Gegend des historischen Aksum in Nord-Äthopien sind die Reste monumentaler Stelen – bis zu 33 Meter hoch – zu sehen, die aus vorchristlicher Zeit stammen. Aksum wurde zum Mittelpunkt eines Reiches, das zeitweilig auch Gebiete auf der arabischen Halbinsel beherrschte. Das Reichsgebiet erstreckte sich im Westen bis ins Grenzgebiet zum Sudan und im Osten bis ans Rote Meer.
Der Hafen Adulis war der wichtigste Umschlagplatz für den Fernhandel über See. Unter König Esana, er herrschte im 4. Jahrhundert n. Chr., verbreitete sich das Christentum. Seit dem späten 7. Jahrhundert geriet Aksum wegen der Expansion des Islam mehr und mehr in Isolation. Der Niedergang des Reiches erfolgte im 10. Jahrhundert.
Die Amoriter. Dieses Volk lebte um 2000 vor Chr. im nördlichen und westlichen Grenzgebiet Mesopotamiens. In den ersten Berichten aus dieser Zeit werden sie als wilde, unzivilisierte Krieger beschrieben. Die Amoriter siedelten auch im Ostjordantal, wo sie mit den Israeliten in Kontakt kamen. Die berühmteste und einflussreichste Stadt, die zeitweilig von Amoritern regiert wurde, war Babylon.
Der bekannteste aller amoritischen Herrscher ist Hammurabi, dem Babylon die entscheidende Ausdehnung seines Machtbereichs verdankt. Die vermutlich größte Kulturleistung der Amoriter für die Nachwelt ist Hammurabis Rechtskodex, die älteste umfassende Sammlung von Gesetzen, in denen erstmals in der Geschichte der juristischen Kodifizierung zwischen den Bereichen Strafrecht, Zivilrecht und Wirtschaftsrecht unterschieden wird. Die lex talionis – „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ – ist ein amoritisches Rechtsprinzip.
Anasazi bedeutet in der Sprache der Navaho-Indiander „die Alten“. Dies ist ein Sammelname für die Vorfahren der modernen Pueblo-Indianer, die bereits vor der Zeitenwende im Südwesten der heutigen USA siedelten. Um 100 v. Chr. beginnt die Kulturentwicklung der Anasazi. Sie waren sesshafte Ackerbauern, die zunächst in halb unterirdischen Rundhäusern oder im Schutz von Felsüberhängen wohnten, später dann rechteckige Steinhäuser bauten.
Die Anasazi waren die ersten Indianer Nordamerikas, die stadtähnliche Siedlungen bewohnten. Die Häuser waren bis zu fünf Stockwerke hoch. Etwa gegen 1300 n.Chr. wurden die nördlichen Siedlungen verlassen. Zum einen trockneten Dürreperioden das verfügbare Ackerland immer stärker aus. Zum anderen gerieten die Anasazi in kriegerische Auseinandersetzungen mit den von Nordwesten nach Süden vordringenden Apachen und Navaho.
Die Aramäer. Seit dem 2. Jahrhundert vor Chr. zeigen die Aramä-er als ein semitisches Volk Eigenprofil mit eigener Kultur und eigener Sprache. In assyrischen Texten wurden seit dem 14. Jahrhundert v. Chr. die Ahlamu erwähnt, die von der modernen Forschung als ein Stamm der Aramäer identifiziert worden sind. Von cirka 700 bis 200 v. Chr. war das Aramäische als Kultursprache, Staatssprache und als Verständigung in der internationalen Diplomatie verbreitet. In weiten Teilen des Vorderen Orients wurde das Aramäische erst im 7. Jahrhundert n. Chr. vom Arabischen verdrängt. Der Einfluss des Aramäischen reichte bis nach Nordwestindien. Auch Jesus sprach aramäisch.
Die Chaldäer. Aller Wahrscheinlichkeit waren die Chaldäer Semiten. Sie übernahmen eine Zeitlang die Macht in Babylon. Um 770 v. Chr. bestieg der Chaldäer Eriba-Marduk den babylonischen Königsthron. Seine Verbündeten waren Elam im Osten und das Reich Juda unter König Hiskia im Westen. Der berühmteste der chaldäischen Könige war der in der Bibel erwähnte Nebukadnezar II., auf dessen Befehl hin die Stadt Babylon großzügig ausgebaut wurde. Der Perserkönig Kyros II. eroberte Babylon im Jahre 539 v. Chr. Damit endete nicht nur die Herrschaft der Chaldäer, sondern auch die Existenz des Königreichs Babylon.
Chimú. Die Zivilisation der Chimú, deren Anfänge auf etwa 1200 n. Chr. zurück reichen, gehört zum Kreis der vor-inkaischen Kulturen Perus. Das Chimú-Reich erstreckte sich gegen des 14. Jahrhunderts von Ecuador im Norden bis zum Rimac-Tal im Süden. Lange Zeit behielt das Chimú-Reich seine Unabhängigkeit, trotz der Erstarkung des Inka-Reichs im Süden. Im Jahre 1463 n. Chr. wurde das Territorium der Chimú von Topa Inka Yupanqui erobert.
Auf eine straff organisierte Verwaltung der Landesteile weist das ausgeklügelte Bewässerungssystem und ein verzweigtes Straßennetz hin. Die Chimú unterhielten ein Netz reger Handelsbeziehungen zwischen den einzelnen Regionen. Waren wurden mit Lamas über Land und mit Balkenflößen an der Küste entlang transportiert. Die Metallurgie war hoch entwickelt, insbesondere Techniken des Kalthämmerns. Die Chimú-Metallurgen beherrschten aber auch Schmelztechniken und konnten Gold-Silber-Legierungen und Bronze herstellen. Eine besondere Rolle spielte die Herstellung von Textilien, in die mythologische Motive eingewebt waren.
Die Hethiter. Um 2000 v. Chr. werden die Hethiter, ein indoeuropäisches Volk, erstmals in assyrischen Texten erwähnt. Der historische Siedlungsraum in Anatolien mit dem Kernland in Kappadokien ist nicht ihr Ursprungsgebiet. Woher die Hethiter kamen und weshalb sie nach Anatolien wanderten, ist bis heute ungeklärt.
Bald schon fand ein Machtwechsel in der Stadt Hattusa statt, wo zwischen 2500 und 2000 v. Chr. eine hattitische Urbevölkerung lebte. Als Folge avancierte Hattusa zum Zentrum der politischen Macht der hethitischen Könige. Im 16. Jahrhundert v. Chr. gründete Hattusili I. das Alte Reich, das bis um 1450 v. Chr. Bestand hatte.
Nach einer politisch unruhigen Zwischenperiode konsolidierte sich unter Suppiluliuma I. das „Neue Reich“. Dessen Einflussgebiet erweiterte sich in den Nordwesten Kleinasiens sowie nach Südosten und Süden. In der Schlacht von Kadesch brachen die Hethiter die Vormacht der Ägypter in Syrien. Während der Regierungszeit von Suppiluliuma II. wurde die hethitische Gesellschaft durch eine Wirtschaftskrise erschüttert. Diese Schwächung hatte zur Folge, dass das Reich ungenügend für die militärische Auseinandersetzung mit der Allianz der Seevölker vorbereitet war, unter deren Ansturm es schließlich zerbrach.
Mit dem Verlust ihrer politischen Macht versanken die Hethiter in historische Bedeutungslosigkeit. Die hethitische Restbevölkerung ging im Volkstum der Nachfolgekulturen auf. Damit erlitten sie das gleiche Schicksal wie die seinerseits von ihnen assimilierten Hattier.
Die Lyder besiedelten die historische Landschaft Lydien im Westen Kleinasiens. Ihnen gelang es, im 7. Jahrhundert v. Chr. die Grenzen ihres Königreichs mit der Hauptstadt Sardes in Kriegen gegen die griechischen Kolonien an der ionischen Küste und gegen die Kimerier im Inland bis an den Fluss Halys auszudehnen. In jener Zeit avancierte Lydien zur stärksten Wirtschaftsmacht Kleinasiens. Damals standen die griechischen Seestädte unter lydischer Kontrolle. Dort begann die Geschichte der abendländischen Münzprägung mit der Ausgabe der ersten Goldmünzen, der so genannten „Elektronmünzen“. Sie bestanden aus einer Gold-Silber-Legierung. Der mächtigste Herrscher der Mermnaden-Dynastie war Kroisos – 560 bis 547 vor Chr. – der wegen seines sprichwörtlichen Reichtums berühmt wurde. In seiner machtpolitischen Verblendung begann Kroisos einen Feldzug gegen das Perserreich. Die Perser blieben siegreich, besetzten Lydien und beendeten die Herrschaft der Mermnaden-Dynastie.
Als persische Provinz war Lydien ab 547 v. Chr. zwar nominell ein Teil Persiens, behielt aber faktisch eine weitgehende Selbstverwaltung.
Die in der Antike thematisierte Beziehung zwischen den Lydern und den Etruskern ist bis heute mythisch verklärt geblieben. Der bekannteste Bericht, in dem die Herkunft der Etrusker aus Lydien beschrieben wird, ist eingewoben in Herodots neunbändigem Werk „Histories Apodeixis“. Herodot nennt Lydien als ursprüngliche Heimat der Etrusker. Bei ihm ist auch die Rede von einer Migration nach Italien auf dem Seeweg.
Ursprünglich stammen die Nabatäer aus dem Norden der Arabischen Halbinsel. Von dort sind sie im 6. Jahrhundert v. Chr. nach Edom, ins Gebiet südlich des Toten Meeres, ausgewandert. Im 4. Jahrhundert v. Chr. formierte sich in jener Region das Königreich der Nabatäer. Das Reichsgebiet erweiterte sich zusehends und umfasste außer dem Kerngebiet den zentralen Negev, die Halbinsel Sinai und zeitweise den Südwesten Arabiens. Seit 169 v. Chr. war Petra die Hauptstadt des Reiches. In diesem Gebiet kreuzten sich die wichtigsten Handelsrouten des Nahen Ostens. Die Nabatäer kontrollierten auch den Fernhandel mit Indien. Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. verloren sie aber ihren Handelsstützpunkt Gasa an die Juden.
Unter Aretas III. wurde Damaskus erobert, das fortan als Handelsplatz diente. Als sie dem militärischen Druck des jüdischen Staates nicht mehr standhalten konnten, unterstellten sie sich der römischen Oberhoheit.
Unter den Herrschern der Spätzeit, Obadas II. und Aretas IV. Philodemos erlebte das Nabatäerreich seine größte Blüte. Rabel II. Soter konnte die Auflösung seines Reiches aber nicht mehr verhindern. Er hatte keinen Nachfolger. Der römische Kaiser Trajan annektierte das verbliebende Territorium des Nabatäer-Reiches und integrierte es als Provinz Arabia mit dem administrativen Zentrum Bostra. In jener Zeit verlor Petra seine einmalige Rolle als Knotenpunkt der Karawanenstraßen an Palmyra in Syrien. Die Sprache der Nabatäer war ein stark vom Arabischen überformtes Aramäisch.
Die Sabäer. Von den frühen lokalen Königreichen, die sich zu Beginn des 1. Jahrtausends v. Chr. in Südarabien konstituierten, ist das von Saba am bekanntesten. Seine weltweite Bekanntheit verdankt Saba zweifellos dem biblischen Bericht über den Besuch der Königin von Saba bei König Salomon in Israel.
Die besonders begehrten Produkte des Fernhandels waren Weihrauch und Myrrhe. Beides hatten die Ägypter im 2. Jahrtausend v. Chr. aus dem sagenumwobenen Reich Punt importiert. Die Sabäer traten die Nachfolge von Punt an, das um 1200 v. Chr. aus den Annalen verschwindet.
Das Königreich von Saba, dessen Hauptstadt zunächst Sirwa, später Marib war, erstarkte im 6. Jahrhundert v. Chr. und dehnte seine Herrschaft sukzessive auf die anderen lokalen Königreiche aus. Dazu gehörten die Reiche Main, Qataban und Hadramaut.
Im 1. Jahrhundert v. Chr. verloren die Sabäer die Kontrolle über die Karawanenstraßen. Dies war der Beginn des wirtschaftlichen Niedergangs und der Schwächung der politischen Macht. Es war aber auch die Zeit, als sich ausländische Mächte bemühten, Südarabien zu kontrollieren. Die Römer versuchten im Jahre 24 v. Chr. vergeblich, Marib zu erobern.
Zwischen 325 und 360 n. Chr. dehnte das Reich Aksum in Äthopien seinen Herrschaftsbereich bis nach Südarabien aus. In jener Periode verbreitete sich dort das Christentum. Um 570 n. Chr. wurde Südarabien Provinz des persischen Sassaniden-Reichs. Der letzte Statthalter der Region trat im Jahre 628 zum Islam über.
Die ältesten Erwähnungen der Skythen stammen aus dem 6. Jahrhundert v. Chr.. Der Dichter Anakreon erwähnt die Sitte der Skythen, Wein pur und nicht mit Wasser vermischt wie die Griechen zu trinken.
Die Skythen waren kein einheitliches Volk, sondern ihre ethnische Identität stellte sich im Profil eines lockeren Bundes von verschiedenen Stammesgruppen dar. Die Anfänge der skythischen Geschichte gehen auf den Beginn 1. Jahrtausends v. Chr. zurück, als nomadische Volksstämme – Träger der Andronovo-Kultur – in mehreren Migrationsschüben aus Nordwestasien nach Europa einwanderten. In einem Areal, das im Westen vom Don, im Norden von der Wolga und im Süden vom Kaukasus begrenzt wurde, gewann die skythische Kultur Eigenprofil.
Die Expansion der Skythen wurde vom dem Erfolg ihrer Reiterei getragen, deren nomadische Kriegstaktik Täuschungsmanöver und Überraschungsangriffe einschloss. Als Bogenschützen wurden sie von ihren Feinden gefürchtet und von ihren Verbündeten geschätzt. Zu den Reiterverbänden der Skythen gehörten auch weibliche Krieger, die im Ruf standen, ebenso hart und tapfer zu kämpfen wie die Männer. König Atheas gründete im 5. Jahrhundert v. Chr. das zweite skythische Reich, das schon bald unter den militärischen Druck der Mazedonier im Westen und der Sarmaten im Osten geriet. Letztere verdrängten im Verlauf des 3. und 2. Jahrhunderts v. Chr. die Skythen, die sich auf die Krim zurückzogen und dort das dritte und letzte der Skythen-Reiche gründeten. Dieses Staatswesen hatte bis zur Invasion der Goten im 3. Jahrhundert n. Chr. Bestand. Das skythische Volkstum ist schließlich im Verlauf des Mittelalters in dem des iranischen Volks der Osseten aufgegangen.
Die materielle Kultur der Skythen, vor allem der aristokratischen Elite, ist bekannt aus den reichen Beigaben der zahlreichen Grabhügel. Vom Skythischen, das schriftlos blieb, sind nur spärliche Zeugnisse überliefert. Dazu gehören etwa 200 Einzelwörter, außerdem Namen von Personen und Gottheiten, die sich in griechischen Quellen finden.
Versunkene Völker, versunkene Reiche. Perser, Griechen, Ägypter – sie hatten ihren Zenit längst überschritten. Am Mittelmeer, dem Nabel der antiken Welt, war es an der Zeit für ein neues Volk machtvoll die Bühne der Menschheit zu betreten: Die Römer. Ein kleiner Staat im Zentrum Italiens. Glänzend organisiert von Führern mit gewaltigen Visionen. Das Reich der Römer, so mächtig wie noch nie ein anderes zuvor, zerbrach erst 1000 Jahre nach seiner Gründung. Es hatte die Tugenden vergessen, die es einst so groß gemacht hatten.