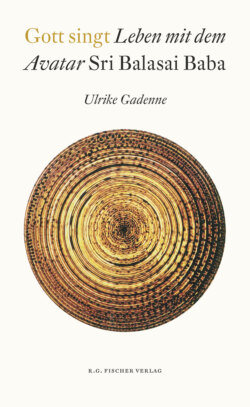Читать книгу Gott singt - Ulrike Gadenne - Страница 37
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Am anderen Ufer
ОглавлениеJanuar 1999 – Nachdem meine Mutter sich von der Operation erholt hatte und stabil genug war, wieder ihren Haushalt selbständig zu führen, packte ich meine Koffer, und konnte schon vor Balasai Babas Geburtstag am 14. Januar wieder in Indien sein.
Ein paar Tage nach meiner Ankunft in Kurnool verabrede ich mich mit einer Besucherin, zum Sonnenaufgang auf die andere Flussseite zu fahren. Als wir losgehen, spiegelt sich der rote Himmel auf der Wasseroberfläche. Es ist noch dunkel, aber in allen Häusern brennt Licht und die Menschen sind mit ihren morgendlichen Tätigkeiten beschäftigt. Die Hauseingänge und schmalen Straßen sind sauber gefegt und mit Wasser besprengt. Mit farbigen oder weißen Pulvern streuen oder malen die Frauen neue Mandalas – kunstvolle, teils schwierige verflochtene geometrische oder florale Muster, die als Schutzzeichen dienen. Auch das Waschen und Zähneputzen findet in der Öffentlichkeit statt, zum Teil an mehr als schmutzigen Wasserstellen; allerdings sind die Geräusche beim Reinigen des Nasen- und Rachenraumes für den Europäer gewöhnungsbedürftig. Zusätzlich suchen sich Esel, Schweine, Ziegen und Hühner ihre Nahrung. Selbst in dem winzigen Shiva-Tempel oben auf der Flussböschung, den man nur gebückt betreten kann, brennen schon die Öllampen und Räucherstäbchen – die beiden Frauen winken uns und geben uns ein Stück Kokosnuss als Prasad –, unser erstes Frühstück. Auf dem kleinen abgegriffenen Nandi, dem Reittier Shivas, liegen frische Blumen.
Am Fluss ist es noch still, aber der Betrieb wird bald einsetzen. Als der Fährmann uns sieht, schiebt er das runde, geflochtene Korb-Boot ins Wasser, und wir setzen uns auf den bequemen Rand. In der Mitte liegt ein großer Autoreifen, der verhindert, dass unsere Füße im Wasser stehen. Mit ruhigen Bewegungen senkt der Fährmann die lange Stange ins seichte Wasser und das Boot setzt sich in Bewegung. Um diese Jahreszeit ist der Fluss, im Gegensatz zur Regenzeit, wenn man das gegenüberliegende Ufer kaum erkennen kann, ein schmales Rinnsal. Alles ist ruhig, nur das Flechtwerk des Bootes knirscht leise, das Wasser gurgelt, ein kreischender Wasservogel, in der Ferne bellt ein Hund, über uns der halbe Mond.
Meine Gedanken schweifen ab. Bei uns im Westen ist der Fährmann eine mythische Gestalt: In der griechischen Sage fährt Charon die verstorbenen Seelen ins Totenreich, im Märchen von Goethe setzt der Fährmann die Reisenden vom Reich der grünen Schlange über ins Reich der weißen Lilie – er verbindet zwei Bereiche, die getrennt sind. Hier sind die Bereiche des Lebens und des Todes nicht getrennt, man weiß, dass der Tod nur für den physischen Körper gilt …
Der Sand am anderen Ufer ist noch kühl. Am Ufer steckt ein Lingam, ein schmuckloser Stein im Sand, das Symbol von Shiva und Shakti, die jeweils das höchste kosmische Bewusstsein und die Energie der Manifestation darstellen, aber die morgendliche Opferhandlung ist schon vorbei und das Öllämpchen verloschen, nur das rote Kum Kum-Pulver und die frischen Blumen zeugen davon, dass jemand schon in aller Herrgottsfrühe dem Kosmos ein Opfer gebracht hat. Über trockene Algen gehen wir am Flussufer entlang zurück, bis sich gegenüber die hohe Flussmauer des Ashrams erhebt. Jetzt schiebt sich der orange-rote Sonnenball über den Horizont und steigt schnell höher. Der weiße, schlichte Tempel des Ashrams mit seinem Turm und den Fenstern von Babas Privaträumen wirkt von hier im Zwielicht der Dämmerung noch märchenhafter als aus der Nähe. Die ersten Sonnenstrahlen erhellen die Spitze des Eingangsturms, im Ashram ist noch alles still. Meine Begleiterin macht den Sonnengruß, wobei sie schon gehörig ins Schwitzen kommt. Scharen von weißen Reihern fliegen flussaufwärts.
Jetzt belebt sich das Flussbett: Die Menschen, die im gegenüberliegenden Dorf wohnen, streben der Fähre zu, um ihre Arbeitsplätze in Kurnool zu erreichen. Ehe wir zurückfahren, sitzen wir noch eine Weile am Ufer und sehen dem bunten Treiben zu. Man redet nicht viel, das Ein- und Aussteigen geht flüssig. Wir sprechen über die Botschaft der Bindungslosigkeit in der Bindung aus der Runde mit Baba am Vorabend: »Seid verbunden, aber nicht voneinander abhängig! (Be connected, but not attached.) Das Boot soll im Wasser sein, nicht das Wasser im Boot!« Schwieriger für uns ist es, den Sinn des anschließenden Steinchenspiels zu erkennen. Wir sind beide berührt, weil diese kleine Szene beispielhaft zeigte, wie unaufdringlich, spielerisch und wie »nebenbei« Baba lehrt. Baba begann gestern Abend das Spiel, indem Er mit kleinen Steinchen auf Teetassen, die in einiger Entfernung standen, zielte. Am Klang war zu hören, dass fast jeder Schuss ein Treffer war. Eine junge Besucherin neben Ihm fühlte sich angeregt, auf die danebenstehende Teekanne zu zielen. Unbemerkt von ihr warf Baba gleichzeitig und man hatte den Eindruck, dass die Besucherin traf, weil es jedes Mal einen Klang gab, auch wenn sie deutlich daneben warf. Babas Kommentar: »So ist es auch in Wirklichkeit: Wenn es so aussieht, dass jemand trifft, macht Gott es hinter dem Vorhang!« Aber bevor wir endgültig die Frage lösen können, wer dann »in Wirklichkeit« handelt, vertreibt uns die einsetzende Morgenhitze.
Mit uns steigt ein Bauer mit seinen Ziegen ins Boot, die das Ritual schon zu kennen scheinen, so selbstverständlich springen sie hinein und schauen erwartungsvoll ans andere Ufer, wo sie sich dann über das saftige Gras am Ufer hermachen. Wir gehen den Weg zurück und sehen jetzt erst, dass kurz vor dem Ashram ein großer Kuhstall mit etwa zwanzig Wasserbüffelkühen ist, die gerade gemolken werden. Der Melker sitzt auf dem Boden und zielt mit dem Milchstrahl in einen kleinen Behälter voll mit schäumender Milch. Der Stall ist sauber und es stinkt nicht. Am Eingang warten Frauen mit kleinen Milchkannen – die Milch der Wasserbüffel ist die kostbarste, gesündeste und fettreichste Milch. Sie bestaunen uns und winken, als wir weitergehen. Mich wundert, warum ich diesen großen Stall so in der Nähe noch nicht entdeckt hatte, aber Wasserbüffel »muhen« nicht. Die massigen Tiere werden einmal am Tag an den Fluss getrieben, wo sie genießerisch im Wasser liegen, das ihrer empfindlichen Haut gut tut, ansonsten fressen sie oder käuen wieder. Alles geschieht langsam und still. Wenn eine Herde über die Straße geht, hat man den Eindruck, als bewege sie sich in einer anderen Dimension, schreiende Menschen und hupender Verkehr veranlassen sie nur ausnahmsweise, ihre Richtung oder Geschwindigkeit zu ändern. An einem Nachmittag auf der Flussmauer hatte Baba auf eines dieser eindrucksvollen Tiere mit den ausladenden Hörnern und den trotz aller Schwerfälligkeit geschmeidigen und stetigen Bewegungen, das unter uns am Ufer graste, gezeigt und bemerkt: »Gott ist wie ein Wasserbüffel, er zeigt seine Kraft nicht, sondern dient den Menschen still und hingebungsvoll.« Später kam der Besitzer und schlug die Büffel mit einem Stock, um sie in die andere Richtung heimzutreiben. Dazu bemerkte Baba: »So geht es auch Gott. Er ist auch voller Energie, aber Er macht sich zum Sklaven und lässt sich von den Menschen schlagen.«