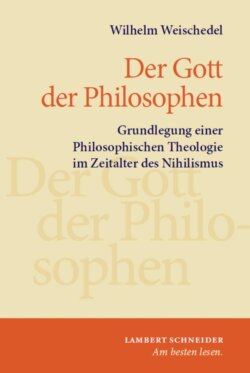Читать книгу Gott der Philosophen - Wilhelm Weischedel - Страница 75
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Gottesbeweis
ОглавлениеDas erste Problem, das sich im Rahmen der Philosophischen Theologie des Augustinus stellt, ist die Frage nach dem Dasein Gottes. Sie ist freilich für ihn persönlich nicht von entscheidender Bedeutung: „Ich habe immer geglaubt, daß du bist und für das Unsrige Sorge trägst, auch wenn ich weder wußte, was über dein Wesen zu denken sei, noch welcher Weg zu dir führte oder zurückführte“ (C VI 5, 8). Gleichwohl enthebt sich Augustinus nicht der Aufgabe, einen Beweis für das Dasein Gottes zu versuchen.
Dieser findet sich in der Frühschrift „De libero arbitrio“ (L II, 5, 12, – 39, 155). Im Beginn des Gespräches ist sich Augustinus mit seinem Partner Euodius darüber einig, daß die Frage nach dem Dasein Gottes im Grunde durch das Faktum des Glaubens entschieden ist. Und doch wendet Euodius ein: „Aber wir begehren doch, das, was wir glauben, auch zu erkennen und einzusehen.“ Das ist für den systematischen Ort des Gottesbeweises des Augustinus charakteristisch. Es geht nicht um eine Reflexion über das Dasein Gottes aus eigenem philosophischem Ursprung, sondern – entsprechend der Grundposition des Augustinus – um die nachträgliche denkerische Besinnung auf etwas, was schon von vornherein für den Glauben gewiß ist; infrage steht nur, „wie offenbar werden kann, daß Gott ist, obschon es aufs beharrlichste und festeste zu glauben ist“.
Den Ausgangspunkt des Beweises bildet die – genuin griechische – These, daß die Vernunft das Höchste im Menschen und überhaupt in der ganzen Weltwirklichkeit ist: höher als das Leben, das auch den Lebewesen, und das Sein, das überhaupt allem Seienden zukommt. Charakteristisch augustinisch ist die Begründung dieses Vorranges der Vernunft. Er zeigt sich insbesondere darin, daß diese alles andere in der menschlichen und weltlichen Wirklichkeit beurteilt, während sie selbst deren Urteil nicht unterliegt; „es ist keinem zweifelhaft, daß der, der urteilt, besser ist als der, über den er urteilt“.
Von da ausgehend stellt Augustinus die Frage, ob es etwas gibt, das „vorzüglicher als unsere Vernunft selbst“ ist. Ihm müßte die Vernunft unterlegen sein, während es selbst nichts anderem unterlegen wäre. Berücksichtigt man ferner, daß die menschliche Vernunft wandelbar ist, so müßte – entsprechend dem Vorrang des Immerseienden im antiken Denken – jenes Vorzüglichere „ewig und unveränderlich“ sein. Gibt es etwas dergleichen, so könnte es mit Recht, wie Augustinus vorsichtig formuliert, entweder selber als Gott bezeichnet werden, oder, falls es etwas noch darüber Stehendes gibt, so wäre dies Gott. Die Frage ist also, ob die Vernunft von sich selber her auf etwas sie in dieser Weise Übersteigendes deutet.
Augustinus setzt die Frage so an, daß er zunächst untersucht, „ob sich etwas findet, das alle vernünftig Denkenden, ein jeder mit seiner Vernunft und mit seinem Geiste, gemeinsam sehen“ und das zugleich „unverderbt und unversehrt bleibt“. Etwas von dieser Art erblickt er in der „Beschaffenheit und Wahrheit der Zahl“, die wir nicht durch die leiblichen Sinne, sondern „durch Einsicht“ erkennen. Augustinus macht sich also den platonischen Gedanken zueigen, daß „die Beschaffenheit und die Wahrheit der Zahlen … unverrückbar und unversehrt bestehen“.
Nun „könnte noch vieles andere begegnen, was den vernünftig Denkenden gemeinsam und gleichsam auf allgemein zugängliche Weise gegenwärtig ist … und was unverletzt und unveränderlich bleibt“. Aber Augustinus verzichtet darauf, das Ganze des Bereichs des Immerseienden zu entfalten. Stattdessen fragt er zunächst, ob das an den Zahlen Gefundene auch für die Weisheit gilt; dementsprechend, daß ja die Philosophie ihrem Wesen nach Liebe zur Weisheit ist.
Zunächst wird das Problem der Allgemeinheit der Weisheit erörtert: „Meinst du, daß die je einzelnen Menschen ihre je einzelnen Weisheiten haben? Oder ist in Wahrheit eine allen gemeinsam gegenwärtig?“ Augustinus bestimmt die Weisheit als „die Wahrheit, in der das höchste Gut gesichtet und erfaßt wird“. Er versteht also – ganz im griechischen Sinne „ unter der Weisheit nicht ein bloß theoretisches Wissen, sondern die Einsicht in das, was für den Menschen in letzter Hinsicht gut ist, worauf es also in seinem Dasein entscheidend ankommt. Eben darin liegt nun auch – wie Augustinus, wiederum im Sinne der griechischen Tradition, ausführt – das Glück des Menschen.
Die Frage nach der Gemeinsamkeit der Weisheit führt demnach auf das Problem, ob es im Blick auf das, worauf es im Dasein ankommt, also auf das höchste Gut, eine Übereinstimmung unter den Menschen gibt. Augustinus bejaht dies ohne weiteres. Mag auch jeder einzelne sein höchstes Gut je anders bestimmen, so kommen die Menschen doch darin überein, daß sie überhaupt auf ein höchstes Gut und auf das damit verbundene Glück aus sind. Das gehört sogar zum Wesen des Menschen. „Bevor wir glücklich sind, ist doch schon unserem Geiste der Begriff des Glückes eingeprägt; denn durch diesen wissen wir und sagen es zuversichtlich und ohne irgendeinen Zweifel, daß wir glücklich sein wollen.“
Besteht nun nach dem oben Dargelegten die Weisheit in der Wahrheit über das höchste Gut, dann muß auch das Streben nach der Weisheit allen Menschen zukommen. „Wie … unserem Geiste, bevor wir glücklich sind, doch schon der Begriff des Glückes eingeprägt ist …, so haben wir auch, ehe wir weise sind, den Begriff der Weisheit im Geiste eingeprägt, durch den ein jeder von uns, wenn er gefragt würde, ob er weise sein wolle, ohne irgendeinen Nebel von Zweifel antworten würde, er wolle es.“
Nachdem Augustinus so das Verhältnis zur Weisheit im Wesen des Menschen verankert hat, kann er die leitende Frage wieder aufnehmen. Er wendet sich an Euodius: „Ich möchte nunmehr, daß du mir sagst, ob du dafür hältst, daß die Weisheit so wie die Beschaffenheit und die Wahrheit der Zahl sich allen vernünftig Denkenden gemeinsam darbietet, oder ob du meinst, da es so viele Menschengeister gibt, wie es Menschen gibt, … daß es auch so viele Weisheiten gibt, wie es Weise geben konnte.“ Euodius antwortet ganz im Sinne des bis dahin Erörterten: „Wenn das höchste Gut für alle eines ist, dann muß auch die Wahrheit, in der es gesichtet und erfaßt wird, das heißt die Weisheit, für alle eine gemeinsame sein.“
Euodius bekennt freilich, nicht völlig überzeugt zu sein; der Augenschein zeige ja doch, daß die Menschen je Verschiedenes für die Weisheit und für das höchste Gut halten. Daher muß Augustinus nun einen konkreteren Aufweis der Einheitlichkeit der Weisheit versuchen. In dieser Absicht bringt er Beispiele für Weisheiten, in denen alle Menschen übereinstimmen. Von solcher Art ist schon dies, „daß es die Weisheit gibt oder daß alle Menschen weise und glücklich sein wollen“ und daß man sich deshalb „um Weisheit zu mühen hat“. Dazu gehört ferner, „daß man gerecht leben, das Schlechtere dem Besseren unterwerfen, Gleiches mit Gleichem zusammenbringen und jedem das Seine zuerteilen muß“. Ein weiteres Beispiel ist schließlich, „daß das Unverdorbene besser ist als das Verdorbene, das Ewige als das Zeitliche, das Unverletzliche als das Verletzliche“.
Die Beispiele, die Augustinus bringt, betreffen vornehmlich das rechte Verhalten des Menschen. Aber er betont ausdrücklich, daß „all das, was wir Regeln und Lichter der Tugenden genannt haben, zur Weisheit gehört“; denn die geschilderten Haltungen einzunehmen, setzt Einsicht und also Weisheit voraus. Daher sind jene Lichter der Tugend zugleich „Regeln der Weisheit“.
Schon während der Aufzählung der Beispiele der Tugend und der Weisheit weist Augustinus ständig darauf hin, daß all dies „allen, die darauf hinblicken, gemeinsam gegenwärtig ist“. Das aber besagt, daß alle auch darin übereinstimmen müssen, daß, was in diesen Hinsichten die Weisheit ausmacht, unzweifelhaft wahr ist. Augustinus nennt es daher „das Wahre“, „das höchst Wahre“, „das höchst Gewisse“. Der Wahrheit aber – wie Augustinus sie, ganz im griechischen Sinne, versteht – eignet, daß sie nicht einmal so und einmal anders sein kann, sondern daß sie immer sich selbst gleich ist. Das gilt daher auch von jenen wahren Weisheiten; „wer, wenn er gesteht, (etwas von ihnen) sei wahr, würde es nicht auch als unveränderlich einsehen“. Jenen Weisheiten kommt also, nicht anders als den Zahlen, das Immersein zu. Oder, wie Augustinus den gleichen Sachverhalt ausdrückt: Die Wissenden „erblicken Zahl und Weisheit in der Wahrheit selbst“; Zahl und Weisheit befinden sich „in der geheimsten und gewissesten Wahrheit“.
Nunmehr kann Augustinus den Schluß aus seinen vielverschlungenen Überlegungen ziehen. Er stellt fest, „daß es eine unveränderliche Wahrheit gibt, die all das, was unveränderlich wahr ist, enthält, von der du nicht sagen kannst, sie sei dein oder mein oder irgendeines Menschen, sondern (von der wir sagen müssen), sie sei allen, die das unveränderliche Wahre sichten, wie ein in wunderbaren Weisen gesondertes und doch allgemein zugängliches Licht gegenwärtig und biete sich gemeinsam dar“.
Das für die Möglichkeit eines Gottesbeweises entscheidende Problem ist nun, ob diese unveränderliche und allen gemeinsame Wahrheit in der Tat der menschlichen Vernunft überlegen ist, ob sie also „vorzüglicher ist als unser Geist“. Augustinus wendet zur Beantwortung dieser Frage das oben angeführte Prinzip an, wonach dasjenige das Höhere ist, was über das Niederere urteilt. Von jener Wahrheit nun gilt, daß sie sich nicht nach unserer Vernunft richtet, sondern daß diese sich nach ihr zu richten hat; „wir urteilen ihr gemäß auch über unseren Geist selbst, während wir über sie auf keine Weise urteilen können“. Zudem hat sie dem menschlichen Geiste gegenüber den Vorzug der Unveränderlichkeit; „denn unser Geist … bekennt, veränderlich zu sein, während jene in sich bleibend, … unversehrt und unverderbt“ ist. Daraus folgt: Die Wahrheit ist unserem Geiste gegenüber „höher und vorzüglicher“, „erhabener als unser Geist und unsere Vernunft“.
Nunmehr muß Augustinus den entscheidenden Schritt tun: von der für sich selber bestehenden, unveränderlichen und über die menschliche Vernunft erhabenen Wahrheit hin zum Erweis des Daseins Gottes. In der Tat versucht er dies, freilich in einer dem Bisherigen gegenüber auffälligen Kürze. Er behauptet schlichtweg, jene Wahrheit sei „unser Gott“. Im weiteren Verlauf drückt sich Augustinus dann keineswegs so eindeutig aus. Er sagt zu seinem Gesprächspartner: „Du … hattest mir zugestanden: Wenn ich zeigen würde, daß es etwas über unserem Geiste gibt, würdest du bekennen, Gott sei, sofern es nichts noch Höheres gebe. Ich hatte dies dein Zugeständnis angenommen und gesagt, es genüge, daß ich dies bewiese. Wenn es nämlich etwas Vorzüglicheres gibt, dann ist jener umso eher Gott; wenn aber nicht, dann ist die Wahrheit selber bereits Gott. Mag also jenes zutreffen oder nicht, du wirst dennoch nicht leugnen können, daß Gott ist.“
In der Unbestimmtheit, mit der sich Augustinus hier ausdrückt, kommt das Unbefriedigende dieses letzten Schrittes, in dem es um die mögliche Identifikation Gottes mit der Wahrheit geht, zu deutlichem Ausdruck. Das wird noch dadurch bestätigt, daß Augustinus nun sofort wieder zum Glauben übergeht, der den „Vater der Weisheit“ lehrt und behauptet, „daß dem ewigen Vater die Weisheit, die von ihm gezeugt ist, gleich sei. Daher dürfen wir nichts weiter fragen, sondern müssen (das Gesagte) mit unerschütterlichem Glauben festhalten.“ Offensichtlich ist auch hier, in der Frage des Gottesbeweises, das, was die eigentliche Gewißheit gibt, nicht die Vernunft, sondern der Glaube. Augustinus ist sich dessen auch durchaus selber bewußt. Er drückt sich über das Ergebnis seines Versuches, das Dasein Gottes zu erweisen, aufs vorsichtigste aus. „Das halten wir jetzt nicht allein als Unbezweifelbares, soweit ich meine, im Glauben fest, sondern wir rühren auch mit einer gewissen, obgleich bisher höchst schwachen Art von Erkenntnis daran.“
Sieht man genauer zu, so ist, was Augustinus erwiesen hat, überhaupt nicht das Dasein Gottes, sondern höchstens das Dasein einer an sich bestehenden, vom erkennenden Subjekt unabhängigen Wahrheit. Nicht einmal, daß diese den Charakter der Unveränderlichkeit und des Immerseins trägt, ist eigentlich aufgewiesen; es wird als selbstverständlich aus der platonischen Tradition übernommen. Das aber besagt: der Versuch eines Gottesbeweises, wie ihn Augustinus unternimmt, scheitert. Und doch ist er für die spätere christlich bestimmte Philosophische Theologie von hoher Bedeutung. Wo immer diese sich nicht in aristotelischen oder stoischen Bahnen bewegt, sondern den Weg des platonisch-augustinischen Denkens einschlägt, greift sie die Aufgabe, vom Gedanken einer in sich selber bestehenden Wahrheit her zur Erkenntnis des Daseins Gottes zu gelangen, auf.