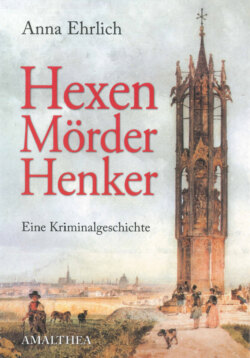Читать книгу Hexen, Mörder, Henker - Anna Ehrlich - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Kriminalisierung des Strafrechts
ОглавлениеBei der Durchsicht der Quellen über Hinrichtungen im österreichischen Raum fällt auf, dass im Mittelalter ganz andere Tatbestände als schwere Verbrechen galten als heute. Landesverrat, Heeresflucht, Homosexualität, Schadenszauber und Majestätsverbrechen an Gott oder am Herrscher galten als besonders strafwürdig. Hingegen verfielen Menschen, die nach heutiger Ansicht Verbrecher waren, keineswegs dem Henker. Blutige Warlords, wie Gamaret Fronauer, die über Jahre hinweg ganze Landstriche tyrannisierten, wurden zur »Befriedung« mit Burgen und Gütern belehnt und so vom Herzog in das herrschende System von Rechten und Pflichten eingebunden, für ihre Untaten also regelrecht belohnt. »Gewöhnliche« Mörder und Diebe wurden verbannt, »geächtet« und dadurch »elend«2, aber hingerichtet wurden sie nicht. Hand in Hand mit der Bevölkerungszunahme und der aufkommenden Stadtkultur im Hoch- und Spätmittelalter stieg die Zahl der Hinrichtungen, denn immer mehr Tatbestände wurden zu todeswürdigen Verbrechen erklärt. Aus dem Vorgehen der Gemeinschaft gegen »landschädliche« Leute entwickelte sich die Verfolgung aller Straftäter »von Amts wegen«. Ein ausgeklügeltes System von Leibesstrafen trat an die Stelle des alten Wergelds.
Gab es ursprünglich nur Freie und Unfreie, so wandelte sich die Gesellschaftsstruktur während des Hochmittelalters grundlegend, da Waffen sehr teuer waren und der Kriegsdienst, zu dem ursprünglich alle Freien verpflichtet waren, viel Zeit kostete. Viele Männer unterstellten sich daher dem bewaffneten Schutz eines Adeligen und traten in seine Grundherrschaft ein, womit sie ihre Freiheit aufgaben, ihr Waffenrecht verloren und sich seiner niederen, nicht für Leib und Leben zuständigen Gerichtsbarkeit gleich unfreien Hörigen unterwarfen. Hingegen trugen ursprünglich unfreie Knechte, die »Ministerialen« des hohen Adels, wegen ihrer persönlichen Kriegsdienste Waffen und verschmolzen mit dem alten Ritterstand zum neuen niederen Adel, der seine Ansprüche durch die Ritterfehde zu sichern verstand. Da die Bevölkerung sehr unter den Fehdehandlungen litt, veranlasste die Kirche deren Einschränkung durch beschworene Verträge, die »Gottesfrieden« (Treuga Dei). Wurden die darin festgelegten Regeln verletzt, so drohte dem Täter der Kirchenbann. Die »Landfrieden« der deutschen Könige verfolgten denselben Zweck. Den ersten Reichslandfrieden verkündete Kaiser Heinrich IV. 1103 auf vier Jahre. Er trug auch in Österreich Gesetzescharakter. Der Mainzer Reichslandfrieden von 1235 legte für das gesamte Reich fest, dass die Fehde nur unter Rittern erlaubt, den Bauern jedoch strengstens verboten war und stets mit einer Ansage, der »diffidatio«, eröffnet werden musste. Ein gerichtlicher Sühneversuch sollte vorausgehen. Die Tötung des Gegners sowie Fehdehandlungen an bestimmten Festtagen, an Sonntagen und den drei letzten Wochentagen wurden verboten. Bestimmte Personen, Kaufleute, Juden, Kleriker, Bauern hinter dem Pflug, aber auch Orte, Plätze und Straßen standen unter einem Sonderfrieden, der »pax«. Wer die Bestimmungen missachtete, galt als Raubritter. Die Landfrieden der Herzöge übernahmen diese Bestimmungen, die somit auch in Österreich galten. So begann die Gesetzgebung das Gewohnheitsrecht allmählich zu verdrängen.
Die Gesetze richteten sich vor allem gegen die zahlreichen Verbrecherbanden, die das ganze Land unsicher machten. Sie hatten ihre Schlupfwinkel im Wald und bei den »ehrlosen Leuten«, fanden aber auch bei den armen Bauern Unterstützung, ein Problem, das trotz aller Bestimmungen bis ins 19. Jahrhundert nicht zu bewältigen war. Eine der letzten berüchtigten Banden war die des »Räuberhauptmanns Hansjörgl«, von Johann Georg Grasel, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Waldviertel ihr Unwesen trieb.
Aus dem alten Handhaftverfahren entwickelte sich das Festnahmerecht, das es im Frühmittelalter noch nicht gegeben hatte. Wurden »landschädliche Leute« vor Gericht gebracht, so verfuhr man gegen sie wie gegen handhafte Täter. Der Kläger brauchte nur mit sechs Eideshelfern im »Übersiebnungsverfahren« ihre Schädlichkeit und Gefährlichkeit zu beschwören, und schon war ihnen der Reinigungseid verwehrt. Dieses Verfahren war in Österreich üblich: »Die landrihter suln vrag haben schedelicher leute und swer ubersagt wirt, uber den sol man richten als recht ist.«3 Die neuen Gesetze drohten mit barbarisch harten Strafen, die aber keine abschreckende Wirkung hatten, sondern immer mehr Menschen in den Kreis der Gewohnheitsverbrecher trieben. Neben die Todesstrafe, für die – auch durch östlichen Kulturimport der »frommen« Kreuzfahrer angeregt – immer grausamere Formen entwickelt wurden, traten Leibes- und Verstümmelungsstrafen wie das Abhacken von Hand oder Fuß, das Ausreißen der Zunge, Ausstechen der Augen, Abschneiden von Nase oder Ohren, das Kastrieren und Brandmarken. Wer durch den Henker verstümmelt oder gebrandmarkt wurde, war gezeichnet und musste weitere Verbrechen begehen, um zu überleben, bis er letztlich am Galgen landete. Mit der immer häufigeren Verhängung von Todes- und Verstümmelungsstrafen, mit dem »Talionsprinzip« Aug’ um Auge, Zahn um Zahn, bekam das mittelalterliche Strafrecht seinen grausamen Charakter.
Gemildert wurde es nur durch das »Asylrecht«: In Kirchen, Klöstern oder an anderen dafür bestimmten Plätzen waren Verbrecher vor der peinlichen Strafe geschützt, um ihnen den Abschluss eines Sühnevertrages zu ermöglichen – vorausgesetzt, sie verfügten über das nötige Vermögen. Da dadurch die Justiz stark behindert wurde, versuchten einige Landesfürsten das Asylrecht einzuschränken. Seit Herzog Rudolf IV. (reg. 1358–1365) war es in Wien nur noch auf dem Areal von Hofburg, Schottenkloster und Stephansdom gültig, doch erst Maria Theresia (reg. 1740–1780) schaffte es mit Patent vom 15. September 1775 völlig ab. Unter ihrem Sohn Josef II. (reg. 1780–1790) verschwanden die letzten Spuren dieses Rechts. In Wien erinnert nur der Name der Freyung noch daran.