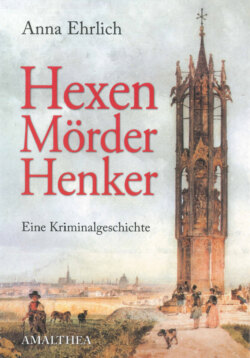Читать книгу Hexen, Mörder, Henker - Anna Ehrlich - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Inquisitionsprozess und Folter
ОглавлениеBis zum 13. Jahrhundert war in Österreich das im Alltag geltende Gewohnheitsrecht nur durch ehrbare Laien, die es sich durch Übung angeeignet hatten, mündlich »gewiesen« worden. Allmählich wurden die Rechtsgewohnheiten schriftlich zusammengefasst. Der Schwabenspiegel stellte eine Sammlung des süddeutschen Rechts, also auch für den österreichischen Raum, dar und war vom Sachsenspiegel beeinflusst. Auch die »Weistümer«,10 ursprünglich mündlich vorgetragene Rechte und Pflichten von Herrschaft und dörflichen Untertanen, wurden aufgezeichnet und jährlich einmal öffentlich verlesen. Hierher gehört das »Wiener Stadtrechtsbuch«, eine Ende des 13. Jahrhunderts angelegte Sammlung, die unter anderem strafrechtliche Bestimmungen und Gewohnheiten enthält.
Da seit dem 13. Jahrhundert die Zahl der Rechtsfälle durch die immer häufigere Verfolgung der Verbrechen von Amts wegen rasant anstieg, waren hauptberufliche Richter bald zwingend nötig. Sie erhielten ihre Ausbildung an den Universitäten, wo sie mit Römischem Recht und Kirchenrecht vertraut gemacht wurden, das sie übernahmen (»rezipierten«), der Vorgang wird als »Rezeption des Römischen Rechts« bezeichnet. Bald verdrängten die gelehrten Herren im Doktorentalar, aus dem sich der heutige Richtertalar entwickelte, die alten Laienrichter, suchten nach objektiven Beweisen für die Schuld der Angeklagten und gestalteten das ursprünglich mündliche Verfahren zu einem schriftlichen um. Nur noch das geschriebene Wort war für den Prozess von Bedeutung. Was nicht im Akt stand, wurde nicht beachtet, »quod non est in actis, non est in mundo«. Akten konnten natürlich leicht liegen bleiben oder mussten verschickt werden, etwa an eine juridische Fakultät, was nicht gerade der Beschleunigung der Urteilsfindung diente. Dieses neue, nicht öffentliche, schriftliche und von Amts wegen eingeleitete Verfahren nannte man »Inquisition«.11
Die kriminalistischen Methoden waren nicht weit entwickelt, daher durfte der Richter das Beweismaterial nicht frei werten. Er war an starre Beweisregeln gebunden und konnte niemanden nur auf Grund von Indizien verurteilen. Sofern nicht zwei Tatzeugen vorhanden waren, musste ein Geständnis vorliegen. Waren ausreichende Verdachtsmomente vorhanden, erzwang man das Geständnis durch die Folter. Laut einer Erwähnung in Wiener Neustadt aus dem Jahre 1235 war sie damals in Österreich bereits üblich. Sie war Beweismittel und nicht Strafe: Der Gefolterte hatte sogar dankbar zu sein, denn die Folter verhalf ihm zum Geständnis, die Strafe brachte ihn zur Reue und diese in den Himmel! Gefoltert wurde zwar seit Urzeiten, dass die Folter aber zu einem Beweismittel werden konnte, war eher eine Verlegenheitslösung. Mit den alten Beweismitteln kam man bei den Hexenprozessen nicht weiter, weil es ja keine wirklichen Beweise für die Folgen der Zauberei gab, und Eideshelfer fanden sich aus Angst, selbst verfolgt zu werden, bald keine mehr. Verstocktheit wurde als teuflische Besessenheit angesehen, es galt sie zu brechen, und man hielt die Folter für das einzig geeignete Mittel. Sie hatte nach bestimmten Regeln zu erfolgen, war nicht nur ein bloßes Zufügen von Schmerz, sondern vielmehr eine eigene Kunst. Im
15. Jahrhundert entwickelte sich die Stufenfolge der Foltergrade. Vor der Folter musste die »Foltertauglichkeit« festgestellt werden, damit während der Folter keine bleibenden Gesundheitsschäden entstanden. Sollten Angeklagte wider Erwarten freigesprochen werden, so sollten ihre Wunden vollständig heilen. Schwangere galten nicht als foltertauglich. Bei den Hexenprozessen blieben diese Vorgaben jedoch oft unbeachtet.
Mit der Anwendung der Folter wandelte sich die Struktur des Strafverfahrens. Hatte früher das Gericht der weisen Männer im Freien, etwa unter der Linde, getagt, wobei jeder zuhören konnte, so untersuchten nun gelehrte, sonderbar gekleidete Juristen oder Inquisitoren in geschlossenen Amtsräumen die Tatbestände, die Öffentlichkeit war ausgeschlossen. Das neue Verfahren war bei weltlichen und geistlichen Gerichten üblich und erweckte beim Volk erhebliches Misstrauen, daher musste das Geständnis durch den Angeklagten beim »endlichen Rechtstag« öffentlich wiederholt werden, was sich aber schon bald auf eine bloße Formalität beschränkte. Denn die bei der Folter anwesenden Zeugen konnten die dort vernommene Aussage des Angeklagten jederzeit beschwören.