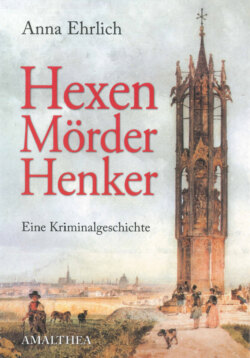Читать книгу Hexen, Mörder, Henker - Anna Ehrlich - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. VOM WERGELD ZUR TODESSTRAFE Wergeld, Gottesurteil und landschädliche Leute
ОглавлениеDas Strafrecht war ursprünglich kein öffentliches Recht. Jede Sippe übte die Strafgerichtsbarkeit über ihre eigenen Mitglieder aus, der Hausherr und Familienvater übte die Strafgewalt über Ehefrau und Kinder aus, der Herr über seine Unfreien, der Schutzherr über seine Schutzbefohlenen. Delikte, die sich gegen einen Einzelnen richteten, waren Privatangelegenheit der Beteiligten, die Fehde das Mittel zur Durchsetzung ihrer Rechte. Kein König, Herzog oder Graf mischte sich da als Richter ein.
Jeder Täter hatte Anspruch darauf, seine Schuld durch Sühnegeld, das »Wergeld« (wer, lat. vir, bedeutet Mann), an die beleidigte Sippe zu büßen, das heißt abzulösen. Das Geld konnte gerichtlich eingeklagt oder durch feierlichen Sühnevertrag, die Urfehde, außergerichtlich festgelegt werden. Eigene Bußkataloge bestimmten die Höhe. Nur wer ungehorsam war oder gar seine Tat verheimlichte, ein »Neidingswerk« beging, oder aber flüchtig oder »landschädlich« war, beziehungsweise wer Verbrechen gegen die Allgemeinheit verübte, durchschnitt damit das Sippenband und wurde geächtet. Niemand durfte einen solchen Verbrecher aufnehmen, »hausen und hofen«, jeder durfte ihn, den »Wer«wolf, töten. Wurde er vor Gericht gebracht, musste er mit der Todesstrafe rechnen.
Der oberste Richter war stets der deutsche König, nur er konnte anderen Personen das Recht verleihen, über Leib und Leben zu richten, das heißt, er belehnte seine Fürsten und Richter mit dem »Blutbann«. Der österreichische Markgraf, ab 1156 der Herzog, genoss eine Sonderstellung: »der Markgraf dingt bei eigener Huld«. Der König hatte nicht das Recht, sich in die Rechtsangelegenheiten des neuen Herzogtums einzumischen.1 Dreimal jährlich hielt der Markgraf beziehungsweise Herzog an den drei Gerichtsstätten Korneuburg, Tulln und Mautern das »Landtaiding« ab, bei dem unter seinem Vorsitz die »maiores et meliores terrae«, die Großen und Besten des Landes, als Urteilsfinder fungierten. Jedes Strafverfahren war damals öffentlich, wurde mündlich ausgetragen und folgte strengen Regeln.
Auch der Beweis wurde in formaler Weise erbracht und es war Sache des Beklagten, seine Ehre durch den »Reinigungseid« wiederherzustellen. Seine »Eideshelfer«, meist Sippengenossen, hatten zu beschwören, dass der Eid des Beklagten rein sei. Sie setzten sich damit nur für dessen Glaubwürdigkeit als Person ein, ohne den Sachverhalt kennen oder seine Unschuld bezeugen zu müssen. Der Sachverhalt selbst wurde nicht erforscht. Nur im Falle, dass ein freier Mann bei der Begehung einer Tat festgenommen wurde, im »Handhaftverfahren«, hatte der Kläger den Beweis zu führen: auf sein »Gerüfte«, das Zetergeschrei, kamen Leute herbei, die damit seine »Schreimannen« wurden und seinen Eid vor Gericht beschworen.
Der Zweikampf als Gottesurteil folgte bestimmten Regeln.
Neben dem Eid war das Gottesurteil oder »Ordal« als Beweismittel zulässig: Die Götter oder Gott sollten die Unschuld des Beklagten erweisen, etwa durch die »Kreuzprobe«, bei der man einander mit ausgebreiteten Armen gegenüberstand. Wer die Arme früher sinken ließ, galt als schuldig. Auch ließ man den Beschuldigten ein »heißes Eisen« anfassen: heilten die Wunden rasch, war er unschuldig. Oder man warf ihn in reines Wasser: nahm es ihn auf, dann war er unschuldig, schwamm er hingegen, so galt seine Schuld als erwiesen. Die Kirche sah in den Gottesurteilen eine »Versuchung Gottes« und lehnte sie ab, konnte sich damit aber nicht durchsetzen. Jeder Ritter hatte das Recht, Verleumdungen und schwere Beschuldigungen durch Anrufung des Gottesgerichtes zurückzuweisen. In feierlicher Form wurden dann vor Zeugen die Bedingungen des Zweikampfes mit dem Kläger festgelegt. Kranke und kampfuntüchtige Ritter konnten ebenso wie adlige Frauen einen Stellvertreter bestimmen. Vor dem Kampf schworen beide Kämpfer auf ein Kreuz oder eine Reliquie, dass ihre Aussage der Richtigkeit entspreche. Wurde die Klägerpartei besiegt, galt die Unschuld der beklagten Partei als erwiesen. Den Kläger traf nun die gleiche Strafe, die dem Beschuldigten im Falle seiner Niederlage gedroht hätte.
Ein weiteres Ordal war die »Bahrprobe«, bei der die Wunden des Opfers bluten sollten, wenn der Täter beim Schwur die Hand auf den Leichnam legte. Eine solche mittelalterliche Bahrprobe fand noch 1601 in Waidhofen an der Ybbs statt: Als die ledige Dienstmagd Margarete Krämer ein totes Kind geboren hatte, wurde sie des Kindsmords angeklagt. Da sie ihre Schuld selbst auf der Folter leugnete, wurde eine Bahrprobe auf dem Friedhof anberaumt. Man legte das tote Kind auf eine Bahre, die Mutter berührte mit Daumen und Zeigefinger ihrer rechten Hand die entblößte Brust des Kindes und wiederholte dreimal mit lauter Stimme den Eid, den ihr der Stadtrichter Matthias Till vorsprach: »Ich Margaretha schwer zu Gott im Himel vnd allen Heiligen, daß ich Mutter am Todt dißes alda liegendten meinem Khindts nicht schuldig bin; da es nicht also ist, so well es ain Zeichen von sich geben, so war mir Gott helff vnd all seine heiligen.« Da kein Zeichen erfolgte, wurde die Magd für schuldlos erklärt. So berichtet das Ratsprotokoll von Waidhofen, das dort im Stadtarchiv aufbewahrt ist.