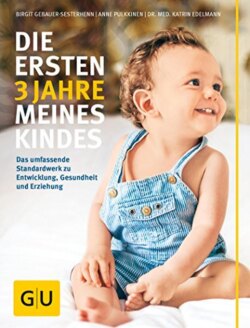Читать книгу Die ersten 3 Jahre meines Kindes - Anne Pulkkinen - Страница 36
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Bewegungsentwicklung vom 9. bis 12. Monat
ОглавлениеIn den kommenden Wochen sollten Sie beobachten, ob Ihr Kind krabbeln (kann) oder nicht, denn Krabbeln im Kleinkindalter ist extrem wichtig. Will Ihr Kind nicht von alleine krabbeln, empfiehlt sich ein Besuch beim Osteopathen, um zu klären, ob eine Blockade diesen Entwicklungsschritt verhindert (>).
Vom Robben zum Krabbeln
Gegen Ende des zehnten Monats wandert auch Babys Hinterteil allmählich in die Höhe, sodass aus dem Robben ein Kriechgang wird. Auf den Händen und Knien kann das Baby nun vor- und zurückschaukeln. Ist es erschöpft, setzt es sich auf seine Unterschenkel. Es kriecht nun auch, anstatt zu robben.
Sobald sich das Gesäß im Kriechgang auf Schulterhöhe befindet, spricht man vom Krabbeln. Anfangs wirkt alles noch etwas unkoordiniert, schließlich muss das wechselseitige Vorwärtssetzen von Hand und gegenüberliegendem Bein erst noch geübt werden. Doch schon bald können sich die meisten Babys im harmonischen Rhythmus vorwärtsbewegen: rechter Arm, linkes Bein, linker Arm, rechtes Bein … Mit täglichem Training wird die gekreuzte Koordination von Mal zu Mal schneller und flüssiger.
WARUM KRABBELN SO WICHTIG IST
Alle gesunden Babys lernen irgendwann, zu stehen und die ersten Schritte zu gehen. Die einen sind dabei etwas fixer und schaffen es bereits mit zehn Monaten, während andere sich etwas mehr Zeit lassen und erst im Alter von 18 Monaten alleine gehen. Jedes Kind entwickelt sich nach seinen Möglichkeiten und bringt dabei sein eigenes Tempo mit. Wenn Eltern dies stets im Hinterkopf haben, erleben sie die Entwicklung ihres Kindes deutlich gelassener. Es ist nämlich gar nicht so bedeutend, wann ein Baby alleine laufen kann. Viel wichtiger ist, welche Fortbewegungstechniken ein Baby vor dem Laufen entwickelt hat – genauer gesagt, ob ein Baby krabbeln kann oder nicht. Denn Krabbeln ist eine wichtige Fertigkeit.
Krabbeln führt nicht nur dazu, eine harmonisch zusammenarbeitende Rücken- und Bauchmuskulatur auszubilden und Bewegungsabläufe zu koordinieren. Ein Kind mit stabilem Schultergürtel wird auch in Zukunft seinen Stift lockerer halten können. Und mehr noch: Es gibt Hinweise darauf, dass Kinder, die als Kleinkind kaum oder gar nicht gekrabbelt sind, ein erhöhtes Risiko haben, später Lernschwierigkeiten zu entwickeln, weil die beiden Gehirnhälften noch nicht ausreichend geschult werden konnten, optimal zusammenzuarbeiten.
Zwar entwickelte sich um die Jahrtausendwende der Trend, dass jedes Kind die Chance haben sollte, seine eigene Fortbewegungstechnik zu entwickeln, und die motorische Entwicklung nicht streng nach Lehrbuch verlaufen müsse (robben, Vierfüßlerstand, krabbeln, laufen). Wenn ein Baby fortan mit abgespreizten Beinen vorwärtsrobbte, ein Bein nachzog, auf einer Pobacke durch die Wohnung rutschte, sich über den Teppich rollte oder gar schlängelte, werteten Eltern, Freunde und Verwandte dies als drolligen und eigenwilligen persönlichen Stil, der auf die selbstbewusste Persönlichkeit des Babys hinweise. So weit, so gut.
EIN VERGLEICH AUS DEM TIERREICH
Wenn Sie ein Fohlen sehen, das beim Laufen ein Hinterbein nachzieht oder sonst eine eigentümliche Fortbewegungstechnik entwickelt hat, würden Sie dann vermuten, dass sich dieses Jungtier aufgrund seiner eigenwilligen Persönlichkeit anders fortbewegt als seine Altersgenossen? Oder würden Sie nicht eher darauf tippen, dass es ein Problem mit seinem Hüftgelenk oder seinem Hinterbein hat und tierärztliche Hilfe benötigt? Tatsächlich zeigt die Erfahrung, dass sich auch bei Babys hinter ungewöhnlichen Fortbewegungstechniken sehr oft Blockaden im Bereich der Halswirbelsäule und/oder im Schulter- und Beckenbereich verbergen. Die Kinder haben kaum eine andere Möglichkeit, auf herkömmliche Art und Weise mobil zu werden. Daher empfiehlt es sich bei Bedarf, einen Osteopathen zu konsultieren, der diese Blockaden durch eine entsprechende Behandlung lösen kann. Eine krankengymnastische Behandlung (nach Bobath oder Vojta) kann dem Baby zusätzlich Reize fürs Krabbeln liefern. Hier bekommen Sie auch Tipps, wie Sie Ihr Kind zu Hause unterstützen können, sich auf allen Vieren fortzubewegen. Diese therapeutischen Maßnahmen können sehr wirkungsvoll sein.
INFO
Schon als Baby zum Therapeuten?
Kein Zweifel: Ein Kind ist kein Automat, den man einfach an- und ausschalten kann. Und so legt jedes Baby in Sachen Entwicklung und Fortschritt sein eigenes Tempo an den Tag. Als Eltern sollten Sie sich daher auch beim Krabbeln nicht zwingend an Zeitplänen und Tabellen orientieren. Die einen sind etwas schneller, die anderen etwas langsamer.
Bei einer Frage jedoch scheiden sich die Geister: Ist Krabbeln notwendig für die weitere Entwicklung? Die einen beschwichtigen, dass Kinder, die nicht krabbeln, später trotzdem auf beiden Beinen stehen und laufen können. Die andere Partei kontert: »Stimmt. Um später laufen zu können, ist Krabbeln nicht zwangsläufig notwendig. Aber es ist ungemein hilfreich, die Zusammenarbeit beider Gehirnhälften zu unterstützen.« Trotzdem müssen sich Eltern von Nicht-Krabblern immer noch rechtfertigen, wenn sie ihr Kind bereits im Säuglingsalter zum Therapeuten bringen. Zu Unrecht: Jedes gesunde Baby bringt die Voraussetzung zum Krabbeln mit – und sollte dieses aus oben beschriebenen Gründen auch wahrnehmen dürfen. Notfalls mithilfe einer kurzen therapeutischen Unterstützung.
KRABBELN: TRAINING FÜRS GEHIRN
Unser Gehirn besteht aus zwei Hälften (Hemisphären), die nicht nur unterschiedliche Aufgaben haben, sondern auch auf ihre jeweils eigene Weise Informationen sammeln und verarbeiten. Klares oder effektives Denken ist nur möglich, wenn die beiden Gehirnhälften gut zusammenarbeiten (synchronisieren).
Beide Gehirnhälften sind über einen Steg verbunden. Dieser Corpus callosum besteht aus einer Ansammlung von markhaltigen Nervenfasern, über die eintreffende Informationen von der einen Gehirnhälfte in die andere geleitet und die Funktionen der beiden Hemisphären koordiniert werden. Sämtliche Sinneseindrücke der linken Körperseite werden zur rechten Gehirnhälfte geleitet und dort verarbeitet. Zugleich steuert die rechte Gehirnhälfte die Muskulatur der linken Körperseite. Im Gegenzug ist die linke Hemisphäre für die Verarbeitung der Sinneseindrücke zuständig, die von der rechten Körperhälfte kommen. Gleichzeitig steuert sie die Muskeln auf dieser Körperseite.
Bewegungen, bei denen wir gleichzeitig die Muskulatur der rechten und linken Körperseite benutzen – die Extremitäten also nicht parallel zueinander, sondern überkreuz »arbeiten« –, aktivieren und fördern die Zusammenarbeit der beiden Gehirnhälften. Je früher und flüssiger diese Überkreuzbewegungen erlernt und trainiert werden (so wie das beim Krabbeln der Fall ist), desto rascher funktioniert der Informationsfluss zwischen rechter und linker Hemisphäre. Außerdem tragen die Überkreuzbewegungen von Armen und Beinen dazu bei, dass im Gehirn neue Nervenschaltstellen angelegt werden.
Vom Krabbeln in den Stand und zum ersten Schritt
Vom Krabbeln ist es nicht mehr weit zum nächsten Entwicklungsschritt: Die Kinder heben ihre Knie vom Boden, indem sie das Gesäß noch höher nehmen, und laufen im Vierfüßler-oder Bärengang über den Boden – lediglich Hand- und Fußflächen berühren den Boden. Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis das Kind sich traut, in den Stand zu kommen. Der ist zwar anfangs noch recht wackelig. Doch weil die Tragfähigkeit der Beine täglich wächst, kann das Kind mit etwa zehn Monaten über eine Minute auf seinen Beinchen stehen. Weil ihm jedoch auch das noch nicht genügt, widmet es seine volle Aufmerksamkeit all den Dingen, an denen es sich hochziehen kann – egal ob es sich dabei um eine Tischkante, einen Stuhl, einen Karton oder eine Treppenstufe handelt. Sobald es sich dabei einigermaßen sicher fühlt, beginnt das Baby, seitlich entlang der Kante zu gehen. Zum Zeitpunkt ihres ersten Geburtstages können 90 Prozent aller gesunden Babys in beiden Richtungen an Möbeln entlanggehen.
Sobald Sie Ihrem Kind Ihre Hände hinhalten, greift es danach, richtet sich aus dem Sitz auf und stellt sich auf die Beine. Wenn Sie es nun an die Hand nehmen, folgen die ersten Gehversuche. Die breitbeinigen Schritte wirken anfangs zwar noch etwas unkoordiniert und wackelig. Doch je weniger Stütze Sie Ihrem Baby dabei anbieten, desto eher lernt es, seinen Rumpf und Kopf selbstständig über den Beinen auszubalancieren. Geben Sie daher nicht zu viel Hilfestellung. Auch hier gilt: Übung macht den Meister, sodass rund 60 Prozent aller Kinder bis zu ihrem ersten Geburtstag die ersten eigenen Schritte ohne weitere Hilfe machen können.
TIPP
Krabbeln lernen
Wenn Sie sehen, dass Ihr Kind sich immer wieder in den Vierfüßlerstand begibt, sich aber nicht weiter traut, können Sie ihm helfen, das Krabbeln zu lernen. Wie? Machen Sie es ihm schmackhaft, und krabbeln Sie mit. Zögern Sie nicht, sich ebenfalls auf alle viere zu begeben, und ermuntern Sie Ihr Kind, es Ihnen gleichzutun. Eine andere Möglichkeit: Strecken Sie Ihrem Baby Ihre Hand oder einen attraktiven Gegenstand (zum Beispiel einen Holzlöffel, einen Ball oder eine kleine Box) entgegen, damit es sich aus reiner Neugierde auf den Weg macht: »He, was ist denn das?«
Sollte Ihr Baby trotz allem keine Anstalten machen, sich aus dem Vierfüßlerstand zu bewegen, hilft vielleicht dieser Trick: Führen Sie ein größeres Handtuch der Länge nach unter dem Brustkorb des Kindes hindurch, und legen Sie die Enden über seinem Rücken zusammen. Heben Sie dann das Handtuch gerade so weit an, dass die Handflächen und Knie des Babys noch am Boden bleiben. Geben Sie nun einen sachten Impuls in Richtung Vorwärtsbewegung, indem Sie das Handtuch ganz sanft nach vorne bewegen – es genügt dabei, das Tuch zu halten, Sie müssen nicht damit »spazieren gehen«.
Sitzen
Mittlerweile bewegen sich die meisten Babys so routiniert, dass es ihnen immer häufiger und leichter gelingt, sich allein aus der Rückenlage über den Vierfüßlerstand und Seitsitz oder über den Gartenzwergsitz aufzusetzen. Sobald sie dann sitzen, strecken sie ihre Beine lang nach vorne aus, wobei die Wirbelsäule in der Regel vollkommen gestreckt ist. Experten nennen diese Haltung Langsitz – eine stabile Position, in der sich ein Baby sicher aufgehoben fühlt und eine Weile spielen kann. Erblickt es in greifbarer Nähe einen Gegenstand, zögert es nicht, sich nach vorne oder zur Seite zu beugen, um danach zu fassen. Dabei kann das Kind Schräglagen mittlerweile gut ausgleichen. Liegt der Kuschelhase dagegen etwas weiter entfernt, verlagert das Baby das Gewicht zur Seite, dreht sich in den Vierfüßlerstand und krabbelt darauf los.
In den kommenden Wochen trainiert das Baby die Fähigkeit, schneller in den Sitz zu kommen, sein Gleichgewicht zu halten und weitere Bewegungen aus dieser Position zu erlernen. Wenn es das Gefühl hat, umzukippen, stützt es sich prompt mit gestreckten Armen in die entsprechende Richtung ab.
Einen krönenden Abschluss in der Entwicklung des Sitzens bildet die Fähigkeit des Kindes, sein Gleichgewicht so ideal auszubalancieren, dass es nicht umkippt, wenn seine Beinchen im Langsitz angehoben werden.
Das Greifen
In den kommenden Wochen wird der Scherengriff (>) immer weiter ausgefeilt, bis er schließlich zum Pinzettengriff wird. Der feine Unterschied: Beim Scherengriff liest das Baby einen feinen Gegenstand zwischen ausgestrecktem Daumen und Zeigefinger auf. Beim Pinzettengriff pickt es selbst kleinste Krümel mit den Kuppen von Daumen und Zeigefinger auf.
Zwischen dem elften und zwölften Monat wird aber sogar der Pinzettengriff nochmals verfeinert und abgelöst: Mit dem Zangengriff fasst das Kind einen winzigen Gegenstand zwar weiterhin mit Daumen- und Zeigefingerkuppe, der Zeigefinger ist dazu jedoch noch gebeugt. Spätestens ab diesem Moment erwacht in Ihrem Baby die Liebe zum Detail: Von nun an erweckt jeder noch so winzige Gegenstand die kindliche
Neugier und muss genauestens untersucht werden, egal ob es sich um eine Wimper in Mamas Gesicht handelt, eine Fluse auf dem Pullover, ein Papierschnipselchen auf dem Teppich oder einen Kuchenkrümel neben dem Teller. Das schult die Feinmotorik enorm.
Die Koordination der Hände klappt gegen Ende des zehnten Monats so gut, dass das Baby sie auch dann vor dem Körper zusammenführen kann, wenn es in beiden Händen etwas hält (zum Beispiel zwei Löffel). Genauso gut kann es den einen Gegenstand näher betrachten, während die andere Hand den Gegenstand einfach nur festhält.
CHRONOLOGISCHE ENTWICKLUNG DES GREIFEN-LERNENS
• Greifreflex: Von Geburt an packt das Baby mit allen Fingerchen fest zu, sobald etwas seine Handinnenfläche berührt.
• Palmares Greifen: Bereits einige Wochen später ist das Baby in der Lage, gezielt und mit der gesamten Handfläche inklusive dem gestreckten Daumen nach einem Gegenstand zu greifen, zum Beispiel nach einem Würfel oder einem Bauklotz.
• Scherengriff: Nach und nach entwickelt sich der Scherengriff, bei dem das Baby mit leicht gebeugten Fingern und gestrecktem Daumen greifen lernt, etwa nach einem Stift.
PINZETTENGRIFF
Gegen Ende des 10. Lebensmonats pickt das Baby auch kleinste Krümel mit den Kuppen von Daumen und Zeigefinger auf.
• Pinzettengriff: Das Baby »pickt« mit den Kuppen von Daumen und Zeigefinger nach winzigen Dingen, etwa einer Wimper oder einer Brotkrume.
ZANGENGRIFF
Gegen Ende des 11. bis 12. Lebensmonats des Babys ist der Zeigefinger beim Greifen gebeugt.
• Zangengriff: Das Baby greift einen Gegenstand mit der Kuppe des gebeugten Zeigefingers und Daumens.
INFO
Das kann ein Baby bis zum Ende des zwölften Monats
Es krabbelt koordiniert und geplant vorwärts.
Es sitzt selbstständig mit nach vorn ausgestreckten Beinen.
Es spielt im Sitzen mit einem Gegenstand.
Es steht auf, indem es sich zum Beispiel an einem Möbelstück hochzieht.
Es gelangt über den »Bärenstand« zum Stehen.
Es läuft seitlich an Möbeln und Ähnlichem entlang oder geht sogar die ersten Schritte alleine.
Es beherrscht den Scheren-, Pinzetten- und Zangengriff.