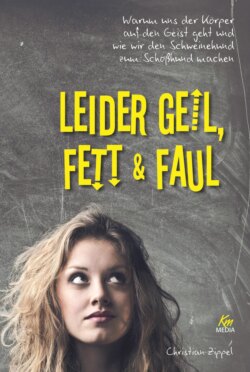Читать книгу Leider geil, fett & faul - Christian Zippel - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Operibus credite et non verbis – Glaube Taten und nicht Worten
ОглавлениеAristoteles verwendete den Begriff „Seele“, wobei er die Seele als das verstand, was einen Körper erst lebendig werden und ihn die Welt wahrnehmen lässt. Kein Körper und doch ein Teil von ihm. Ein Teil, der bewegt und alle Regungen von Geist und Gefühl umfasst. Der Geist ist für Aristoteles „die Kraft der Seele, welche denkt und Vorstellungen bildet.“
In diesem Buch tauchen Begriffe auf, die schwer zu greifen sind – wie Bewusstsein, bewusst, unbewusst, Geist, Seele, Wille o.ä. Diese Begriffe stichhaltig zu definieren ist schwierig und sie allgemeingültig zu definieren ist unmöglich, weil sie allesamt immer nur in bestimmten Paradigmen bzw. Weltbildern Sinn haben.
Der Begriff „Geist“ bedeutet für einen Theologen etwas anderes als für einen Neurobiologen. Bei der Seele wird es ganz schwierig, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Für spirituelle Menschen ist sie alles, für andere nur ein Hirngespinst. Der Begriff „bewusst“ bzw. „unbewusst“ wurde vor allem von Sigmund Freud geprägt und als Aspekt der Psychoanalyse betrachtet. Heute gehört er zur Alltagssprache; die Menschen reden von Selbstbewusstsein, sind gerne umweltbewusst und handeln meist unbewusst.
Dabei neigen wir alle zur Hypostasierung bzw. Verdinglichung. Wir gehen den Wörtern auf den Leim und objektivieren alles, was wir nur denken können. Wir neigen dazu anzunehmen, dass etwas als Ding existiert, nur weil es auch einen Begriff dazu gibt. Doch dieser Wortzauber hat keinerlei Grundlage. Viele Etikette hängen in der Luft.
Erstens ist jeder Begriff abstrakt und somit nicht identisch mit der Realität, zweitens gibt es keine universellen Begriffe, die in jedem Paradigma das Gleiche bedeuten würden, und drittens könnte man so jedem Hirngespinst eine eigene Realität zusprechen, nur weil man es denken kann.
Da die Menschen aber eher unkritisch und die Gedanken frei sind, wurden im Laufe der Jahrtausende unzählige von Begriffen erdacht, die nur in ihrem jeweiligen Gedankensystem Sinn haben, aber inzwischen bunt durcheinander gewürfelt verwendet werden, obwohl völlig verschiedene Weltbilder dahinter stehen – so wie wenn man ein Haus bauen würde und statt Ziegelsteinen allein auch den ein oder anderen Brotlaib einmauern würde, wohingegen der Bäcker etwas Zement in seinen Kuchen mischt. Bei diesen Zünften fällt es schnell auf, wenn man einen Werkstoff außerhalb seines Geltungsbereiches verwendet. Bei der Sprache ist das weniger der Fall.
Viele Begriffe sind bereits zu sehr mit der Alltagssprache verwachsen – und so bauen wir oft auf Brot und beißen in Zement. So entstehen viele Scheinprobleme, an denen sich schon Generationen von Philosophen die Zähne ausgebissen haben, weil sie keine Entsprechung in der Realität haben, sondern eine Verwirrung des Denkens sind. Ludwig Wittgenstein sah die Heilung von dieser Krankheit als die wahre Aufgabe der Philosophie:
„Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache.“
Jeder benutzt Begriffe wie „Seele“ oder „Bewusstsein“, aber meist ohne Bezug zum ursprünglichen System und ohne über eine gemeinsame Definition zu verfügen. So sprechen die Menschen aneinander vorbei, da sie keine Ordnung in ihren Begriffen haben. Im schlimmsten Fall entstehen Streitigkeiten und Probleme; nicht weil sie existent wären, sondern weil die Begriffe miteinander unverträglich sind und zusammenpassen wie ein Zahnrad und die Pizza.
„Geist“ lässt sich schwer definieren – besonders in all seinen Schattierungen. Je stichhaltiger wir ihn definieren, desto mehr schneiden wir ab, was vielleicht doch zu ihm gehört und desto beschränkter denken wir. Ich mag es, wenn wir frei und unkastriert mit dem Begriff umgehen. Lieber eine Wolke an Möglichkeiten, als ein Splitter vom Sein. Für unser Unterfangen ist es einerlei, ob der Geist immanent, transzendent, objektiv, subjektiv, extrinsisch, intrinsisch, frei, determiniert, eine Ausgeburt der Materie oder ihr Erdenker ist. Von mir aus kann er auch Gottes Furz oder eine Werbeaktion von Coca Cola sein.
Ich nähere mich ihm bildlich: Er ist unfassbar wie ein Krümel im Barthaar, denkend wie ein Prozessor, gern übermenschlich wie ein Regenschirm, blind gegenüber dem Körper und anfällig für die Triebe – doch vor allem trocken und abstrakt wie metaphysischer Zwieback. Er ist weniger Gegenstand, sondern eher Prozess – wie auch der Körper kein wirklicher Gegenstand, sondern eher Prozess ist. Nichts am Körper bleibt ewig, alles fließt heran, zusammen und trennt sich wieder. Blut, Fleisch, Knochen, Staub, Moleküle. Selbst die Atome, aus denen er besteht, sind keine Gegenstände, sondern energetische Prozesse, die auf Quantenebene zerfließen; in ein energetisches Meer von Möglichkeiten, in dem selbst die Grenzen von Raum und Zeit sich aufheben.
Ja, auch die Physik hat bereits die Welt des Gegenständlichen verlassen. Einzig unsere Sprache hält uns noch an der Welt der Gegenstände fest. Sie ist geprägt von unserer Art der Wahrnehmung, die die Welt in Subjekte und Objekte teilt – weil sie so von unserem Gehirn konstruiert werden. Dabei haben wir nie wirklich auf den Tisch gehauen oder jemanden geküsst.
Materie besteht zu 99,9% aus leerem Raum und die winzigen Elektronen, die in gewaltiger Entfernung um die Atomkerne kreisen, folgen dem sog. Pauli-Prinzip. Das heißt, sie können nie zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein. Da sie negativ geladen sind, stoßen sie sich gegenseitig ab, was wiederum durch Austauschprozesse (in diesem Fall „Photonen“) geschieht. Sie berühren sich also nie wirklich, denn da wäre auch nichts Gegenständliches zum Berühren.
Das klassische Modell der Teilchenwelt, in dem Teilchen aufeinander stoßen wie Billardkugeln, hat ausgedient. Es gibt in der gesamten Welt nur energetische Prozesse, die miteinander durch andere Prozesse wechselwirken. Dass wir dennoch die Tischplatte spüren und die Lippen des Partners ist ebenso Konstruktion unseres Gehirnes wie der Schmerz des angestoßenen Fußes im Traum.
Unsere Sprache kann diese wissenschaftliche Revolution kaum erfassen. Sie ist geprägt von Gegenständen, von Subjekten und Objekten. Es wäre auch unpraktisch, da unsere naive Weltsicht nun einmal in einer konstruierten Wirklichkeit von Gegenständen stattfindet. Deswegen ist es sinnvoll, so zu leben und zu reden, als wäre all das real – aber wenn wir anfangen, es auch zu glauben, und beginnen, auf dieser Ebene zu philosophieren und zu definieren, dann dreht das Denken frei und kommt nicht weiter. Das ist der Grund dafür, dass sich abstrakte Philosophie seit über 2.000 Jahren im Kreis dreht, statt voran zu schreiten – und sich ans Wesentliche zu halten.
Geist, Körper und Trieb sind erst einmal nur Begriffe. Das wissen wir, alles andere glauben wir. Dahinter stecken wahrscheinlich verschieden stark fassbare komplexe, energetische Prozesse, die dazu fähig sind, sich gegenseitig zu beeinflussen. Alle drei wollen etwas: Der Geist will schaffen und sich erheben, der Körper will funktionieren und leben und der Trieb will herrschen und für immer überleben, selbst wenn er sich dafür erniedrigen muss. Der Geist zieht, der Körper schiebt, der Trieb strebt. So scheint es.
Tatsächlich sind alle starken Regungen – auch die von Körper und Geist – Emanationen des Triebes. Der Geist kultiviert ihn; der Körper realisiert ihn. Ohne ihn, wären sie kraftlos wie ein Auto ohne Benzin. Ohne sie wäre er flach und flüchtig wie Furz im Weltall.
Sicher lässt sich all das weiter ausdifferenzieren, doch das würde mehr verwirren als klären. Wenn wir schon denken, dann nicht um zu denken, sondern um zu lenken. Dieser spielerische Zugang soll uns reichen. Bilder sollen uns helfen. Um die für uns wichtigen Aspekte zu verdeutlichen, verwende ich das Bild des Marionettenspielers für den Geist und das der Marionette für den Körper bzw. das des Herrchens und des Hundes für Geist und Trieb.
Zum Trieb
Den Trieb bezeichne ich zeitweilig als Tier, um das Tierische im Trieb zu verdeutlichen und die Kurve zum Hund zu bekommen. Dabei sollten wir uns bewusst sein, dass es eine platte Annahme vom Tier ist. Kaum ein Tier ist wirklich so tierisch, wie wir diesen Begriff in unserer Kultur für etwas Triebgesteuertes oder gar Bestialisches verwenden. Meist sind es fehlgeleitete Menschen, die „tierisch“ sind. Menschen, die keineswegs im Inbegriff sind, den Abgrund zum Übermenschen zu überwinden. Friedrich, wie schriebst Du es noch in Zarathustras Vorrede?
„Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Was habt ihr getan, ihn zu überwinden? Alle Wesen bisher schufen etwas über sich hinaus: und ihr wollt die Ebbe dieser großen Flut sein und lieber noch zum Tiere zurückgehen, als den Menschen zu überwinden?
Was ist der Affe für den Menschen? Ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham. Und ebendas soll der Mensch für den Übermenschen sein: ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham. Ihr habt den Weg vom Wurme zum Menschen gemacht, und vieles ist in euch noch Wurm. Einst wart ihr Affen, und auch jetzt noch ist der Mensch mehr Affe, als irgend ein Affe.“
Ich spucke in den gleichen Abgrund wie Nietzsche; den Abgrund zwischen Tier und Übermensch, über dem der Mensch als Seil hängt. Es ist gut, den Übermenschen zu lehren. Er ist nichts anderes, als der weise Mensch – das Ziel dieses Buches, die Bestimmung unseres Wesens, der Name unserer Spezies – Homo sapiens.
Jeder selbstbeherrschte Mensch ist ein Verächter des Nebensächlichen und Verehrer des Wesentlichen. Ein Pfeil der Sehnsucht nach dem anderen Ufer, den Abgrund zu überwinden. Doch der heutige Mensch ist impotent und schwach, traut sich nicht mehr nach vorne, oben, hinauf zu streben. Er hat das Seil gekappt und fällt zurück ins „Tierische“.
Doch kein Tier ist tierisch wie der gefallene Mensch. Natürlich gibt es im Tier auch verschiedene Wesen (Körper, Geist und Trieb) und verschiedene Ströme – je nachdem, wie komplex es ist. Aber Tiere sind stabiler, in-dividueller. Sie leben, streben und haben weit weniger innere Probleme. Weil sie nicht so hoch stehen, so geistig und komplex sind wie wir, können sie sie auch nicht so tief fallen, zweifeln und abstumpfen.
Genug der Begriffe, zurück zum Fleische.