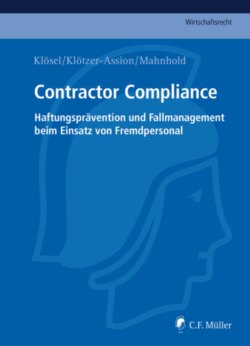Читать книгу Contractor Compliance - Christoph LL.M. Frieling - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. Teil Der Arbeitgeberbegriff in der deutschen Rechtsordnung › 1. Kapitel Definition des arbeitsrechtlichen Arbeitgeberbegriffs › II. Abgrenzungskriterien
II. Abgrenzungskriterien
6
Auch wenn die Abgrenzungsfrage in beiden Fällen nicht vollkommen identisch ist, sind die entwickelten Abgrenzungskriterien bei dem Einsatz von Fremdpersonal in Zwei- und Dreipersonenverhältnissen nahezu deckungsgleich. Kurz zusammengefasst besteht das gemeinsame Merkmal von Fremdpersonaleinsätzen – unabhängig davon ob sie im Zwei- oder Dreipersonenverhältnis ausgeführt werden – darin, dass in beiden Fällen konkrete Dienst- oder Werkleistungen den Vertragsgegenstand bilden, die dann im Rahmen einer eigenständigen Organisation entweder durch den Werkunternehmer selbst oder durch seine eigenen Mitarbeiter als dessen Erfüllungsgehilfen erbracht werden; im Fall von Arbeitsleistungen – ebenfalls unabhängig davon ob sie im Zwei- oder Dreipersonenverhältnis ausgeführt werden – bildet dagegen keine konkrete Dienst- oder Werkleistung den Vertragsgegenstand, sondern lediglich die geschuldete Arbeitsleistung (Zweipersonenverhältnis/Arbeitsverhältnis) bzw. die Überlassung von Arbeitnehmern zur Verrichtung dieser Arbeitsleistungen (Dreipersonenverhältnis/Arbeitnehmerüberlassung).[1]
7
Mit Blick auf den jeweils unterschiedlichen Vertragsgegenstand („konkrete Werk-/Dienstleistungen“ vs. „Arbeitsleistungen“) sind die in Bezug auf die Abgrenzung der genannten Rechtsverhältnisse durch das BAG in ständiger Rechtsprechung entwickelten Grundsätze nahezu identisch:
8
| – | Ständige Rechtsprechung BAG zum Zweipersonenverhältnis: |
„Ein Arbeitsverhältnis unterscheidet sich von dem Rechtsverhältnis eines Werkunternehmers zudem maßgeblich durch den Grad der persönlichen Abhängigkeit. Arbeitnehmer ist, wer auf Grund eines privatrechtlichen Vertrags im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist. Das Weisungsrecht kann Inhalt, Durchführung, Zeit, Dauer und Ort der Tätigkeit betreffen. Arbeitnehmer ist derjenige Mitarbeiter, der nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann der Grad der persönlichen Abhängigkeit hängt dabei auch von der Eigenart der jeweiligen Tätigkeit ab. Dagegen ist der Werkunternehmer selbstständig. Er organisiert die für die Erreichung eines wirtschaftlichen Erfolgs notwendigen Handlungen nach eigenen betrieblichen Voraussetzungen und ist für die Herstellung des geschuldeten Werks gegenüber dem Besteller verantwortlich.
9
Ob ein Werkvertrag, ein Dienst- oder ein Arbeitsverhältnis besteht, zeigt der wirkliche Geschäftsinhalt. Zwingende gesetzliche Regelungen für Arbeitsverhältnisse können nicht dadurch abbedungen werden, dass Parteien ihrem Arbeitsverhältnis eine andere Bezeichnung geben; ein abhängig beschäftigter Arbeitnehmer wird nicht durch Auferlegung einer Erfolgsgarantie zum Werkunternehmer.“[2]
10
| – | Ständige Rechtsprechung BAG zum Dreipersonenverhältnis: |
„Von der Arbeitnehmerüberlassung zu unterscheiden ist die Tätigkeit eines Arbeitnehmers bei einem Dritten auf Grund eines Werk- oder Dienstvertrags. In diesen Fällen wird der Unternehmer für einen anderen tätig. Er organisiert die zur Erreichung eines wirtschaftlichen Erfolgs notwendigen Handlungen nach eigenen betrieblichen Voraussetzungen und bleibt für die Erfüllung der in dem Vertrag vorgesehenen Dienste oder für die Herstellung des geschuldeten Werks gegenüber dem Drittunternehmen verantwortlich. Die zur Ausführung des Dienst- oder Werkvertrags eingesetzten Arbeitnehmer unterliegen den Weisungen des Unternehmers und sind dessen Erfüllungsgehilfen. (…) Entsprechendes gilt für Dienstverträge. Solche Dienst- oder Werkverträge werden vom AÜG nicht erfasst.
11
Über die rechtliche Einordnung des Vertrags zwischen dem Dritten und dem Arbeitgeber entscheidet der Geschäftsinhalt und nicht die von den Parteien gewünschte Rechtsfolge oder eine Bezeichnung, die dem tatsächlichen Geschäftsinhalt nicht entspricht. Die Vertragsschließenden können das Eingreifen zwingender Schutzvorschriften des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes nicht dadurch vermeiden, dass sie einen vom Geschäftsinhalt abweichenden Vertragstyp wählen. Der Geschäftsinhalt kann sich sowohl aus den ausdrücklichen Vereinbarungen der Vertragsparteien als auch aus der praktischen Durchführung des Vertrags ergeben. Widersprechen sich beide, so ist die tatsächliche Durchführung des Vertrags maßgebend, weil sich aus der praktischen Handhabung der Vertragsbeziehungen am ehesten Rückschlüsse darauf ziehen lassen, von welchen Rechten und Pflichten die Vertragsparteien ausgegangen sind, was sie also wirklich gewollt haben. Der so ermittelte wirkliche Wille der Vertragsparteien bestimmt den Geschäftsinhalt und damit den Vertragstyp. Einzelne Vorgänge der Vertragsabwicklung sind zur Feststellung eines vom Vertragswortlaut abweichenden Geschäftsinhalts nur geeignet, wenn es sich dabei nicht um untypische Einzelfälle, sondern um beispielhafte Erscheinungsformen einer durchgehend geübten Vertragspraxis handelt.“[3]
12
Diesen Rechtssprechungs-Grundsätzen ist zu entnehmen, dass es bei der Abgrenzung entsprechend des gemeinsamen Vertragsgegenstandes einer verabredeten Werk- bzw. Dienstleistung vor allem darum geht, dass der Werk- oder Dienstleister – unabhängig davon ob er die Leistungen in Person oder durch eigene Arbeitnehmer erbringt – selbstständig die für die Erreichung eines wirtschaftlichen Erfolgs notwendigen Handlungen nach eigenen betrieblichen Voraussetzungen organisiert und für die vertragliche Herstellung des geschuldeten Werks gegenüber dem Besteller verantwortlich ist. Die entscheidende Frage ist also: Wer hat die Verantwortung für die Erstellung der Werk-/Dienstleistung und wer haftet aus der Konsequenz der übernommenen Verantwortung?
13
Zur Konkretisierung dieser Grundsätze hat die Rechtsprechung mit Blick auf eine unüberschaubare Anzahl von Einzelfällen eine ganze Reihe von Abgrenzungskriterien entwickelt, die im Rahmen einer „wertenden Gesamtbetrachtung“ zu berücksichtigen sind. Diese Rechtsprechung wurde zuletzt auch im Rahmen des Referentenentwurfs durch den Gesetzgeber aufgegriffen und sollen nunmehr in § 611 BGB-E gesetzlich verankert werden, allerdings ohne die Kriterien im Einzelnen zu benennen (vgl. hierzu 1. Teil Rn. 3). Mit Blick auf die beiden Fälle eines Fremdpersonaleinsatzes im Zwei- und Dreipersonenverhältnis lassen sich die wesentlichen Kriterien – jedenfalls idealtypisch für die einzelnen Fallgruppen – anknüpfend an unter § 611a BGB-E genannte Einzelaspekte – wie folgt zusammenfassen:
14
| Kriterium | Arbeitnehmer | Fremdpersonaleinsatz im 2-Personenverhältnis | Fremdpersonaleinsatz im 3-Personenverhältnis |
|---|---|---|---|
| 1) Weisungen (Inhalt, Ort, Zeit)[4] | Durch Einsatzunternehmen | Fehlanzeige | Durch den Anbieter der Werk-/Dienstleistungen |
| 2) Betriebliche Eingliederung | In die betriebliche Organisation des Einsatzunternehmens | Fehlanzeige | In die betriebliche Organisation des Anbieters der Werk-/Dienstleistungen |
| a) Leistungsort | Betriebsgelände des Einsatzunternehmens | Eigene Räumlichkeiten | Räumlichkeiten des Anbieters der Werk-/Dienstleistungen |
| (in der Praxis zuletzt aber oftmals in Form von sog. „Onsite-Werkverträgen“) | (in der Praxis zuletzt aber oftmals in Form von sog. „Onsite-Werkverträgen“) | ||
| b) Zusammenarbeit | Mit Arbeitnehmern des Einsatzunternehmens | Eigenständige Tätigkeit | Mit Arbeitnehmern des Anbieters der Werk-/Dienstleistungen |
| (ggf. auch durch Repräsentantenmodelle“ wie Ticketsysteme o.Ä. bei sog. „On-Site“ und/oder „On-Demand-Werkverträgen“) | |||
| c) Betriebsmittel | Nutzung der Betriebsmittel des Einsatzunternehmens | Nutzung eigener Betriebsmittel | Nutzung der Betriebsmittel des Anbieters der Werk-/Dienstleistungen |
| (ggf. auch durch sog. „Mietmodelle“ o.Ä.) | (ggf. auch durch sog. „Mietmodelle“ o.Ä.) | ||
| 3) Umfang der Tätigkeit | Hoher Umfang für Einsatzunternehmen | Geringer Umfang für Einsatzunternehmen/Weitere Tätigkeiten des Solo-Selbstständigen für andere Auftraggeber | Ohne relevante Bedeutung |
| 4) Unternehmer-Risiko | Fehlanzeige | Risikotragung durch Mängelgewährleistung etc. durch den Solo-Selbstständigen | Risikotragung durch Mängelgewährleistung etc. des Anbieters der Werk-/Dienstleistungen |
| 5) Sonstiges | Urlaubsgewährung, Stellung von Dienstkleidung etc. durch Einsatzunternehmen | Kein Urlaub, eigene Dienstkleidung etc. | Urlaubsgewährung, Stellung von Dienstkleidung etc. durch Anbieter der Werk-/Dienstleistungen |
15
Eine derart idealtypische Darstellung liefert allerdings nur einen groben rechtlichen Rahmen für eine Statusabgrenzung in der Praxis. Denn gerade in Grenzfällen ist es oftmals bereits problematisch, das Vorliegen einzelner Kriterien abschließend zu beurteilen. Selbst wenn dies möglich sein sollte, kommt es in der Regel dazu, dass einige der genannten Kriterien (in verschiedener Intensität) für einen Arbeitnehmerstatus sprechen, andere dagegen für eine Selbstständigkeit bzw. einen Werk- oder Dienstvertrag. Ein näherer Blick auf die einzelnen Abgrenzungskriterien sowie die für eine Gesamtwürdigung maßgeblichen Parameter bleibt deshalb unerlässlich.