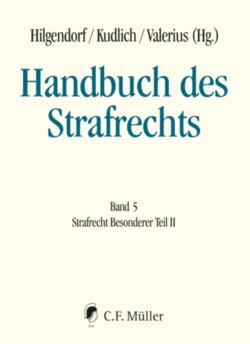Читать книгу Handbuch des Strafrechts - Bernd Heinrich, Dennis Bock - Страница 196
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Verhältnis des Raubes zu anderen Delikten
Оглавление174
Wie in der rechtshistorischen Betrachtung bereits ausgeführt (Rn. 3), geht die Frage nach dem Verhältnis von Raub und Diebstahl und damit, ob es sich beim Raub um ein delictum sui generis handelt, bis ins römische Recht zurück. Ist der Raub zwar im deutschen und österreichischen Recht als eigenständiges Delikt ausgestaltet, wird er in anderen Rechtsordnungen als qualifizierter Diebstahl verstanden. So etwa im französischen Recht, in dem der Raub als „erschwerter Diebstahl bzw. Diebstahl mit Gewalt“ bezeichnet wird. Im englischen Recht wird der Raub im Rahmen des Theft Act 1968 in einer eigenen Sektion behandelt. Dennoch setzt der Raubtatbestand die Begehung eines Diebstahls voraus, sodass er seinem Wesen nach einen erschwerten Diebstahl darstellt, wofür letztlich auch seine systematische Verortung zwischen der Kodifikation der Tatbestände des Diebstahls und des Einbruchdiebstahls spricht.[791]
175
Schließlich stellt sich die Frage, wie das Verhältnis zwischen Raub und Erpressung in den verschiedenen Rechtsordnungen ausgestaltet ist. Vergleichbar zur deutschen Rechtslage, welche im Hinblick auf die Abgrenzungskriterien der beiden Tatbestände zahlreiche Ansichten hervorgebracht hat, gewinnt diese Frage im entsprechend ausgestalteten italienischen Recht auch auf Rechtsfolgenebene praktische Bedeutung. Denn für die Erpressung (estorsione, Art. 629 Codice penale) wird ein gegenüber dem Raub erhöhtes Strafmaß von fünf bis zehn Jahren Freiheitsstrafe statuiert.[792] Demgegenüber verzichtet etwa das österreichische Recht bewusst auf die „Zwitterform“ der räuberischen Erpressung und gliedert diese mit der Formulierung „wegnimmt oder abnötigt“ in den Raubtatbestand ein. Auch hier zeigt sich, wenn auch nur ausschnittsweise, die bereits oben angesprochene Bandbreite der Regelungsmöglichkeiten.
8. Abschnitt: Schutz des Vermögens › § 30 Raub › F. Strafverfahrensrecht