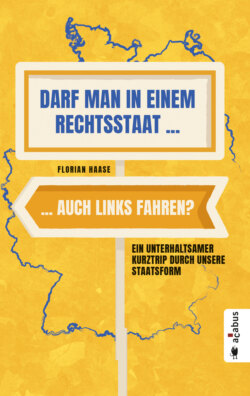Читать книгу Darf man in einem Rechtsstaat auch links fahren? - Florian Haase - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Unrecht im Recht?
ОглавлениеBetrachten wir schließlich das Beispiel (f), das an den sogenannten Schießbefehl in der ehemaligen DDR angelehnt ist. Die DDR entsprach in vielen Bereichen dem, was man gemeinhin einen Unrechtsstaat nennt und was sich in besonderer Weise in dem Befehl manifestierte, auf Flüchtlinge an den innerdeutschen Grenzen zu schießen. Im Jahr 2007 wurde im Magdeburger Außenarchiv der damaligen sogenannten Birthler-Behörde (offiziell: Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik) ein historisches Dokument gefunden, in dem es hieß: „Zögern Sie nicht, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen, auch dann nicht, wenn die Grenzdurchbrüche mit Frauen und Kindern erfolgen, was sich die Verräter schon oft zu Nutze gemacht haben.“ Obwohl der Schießbefehl, der von den seinerzeit politisch Verantwortlichen stets bestritten worden ist, damit in Form einer Dienstanweisung an die DDR-Grenzpolizei offenkundig geltendes Recht war, so haben Sie, lieber Leser, vermutlich eine natürliche Scheu davor, ihn als „Recht“ zu bezeichnen und ihn als solches anzuerkennen.
Kann Unrecht Recht sein? Kann Unrecht in einem Rechtsstaat vorkommen? Kann Ungerechtigkeit in einem Rechtsstaat vorkommen? Die letztgenannten Fragen wird man in praktischer Hinsicht leider bejahen müssen. Wie wir oben bereits gesehen haben, sind Recht und Gerechtigkeit zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Der Rechtsstaat sollte zwar nach Gerechtigkeit streben, aber er verwirklicht sie nicht zwangsläufig. Es gibt gelegentlich Situationen, die auch in einem Rechtsstaat aus übergeordneten Interessen als Unrecht hingenommen werden müssen.
Mit dem Unrecht im Allgemeinen verhält es sich nicht viel anders. Wird Unrecht in geschriebenem oder ungeschriebenem Recht manifestiert, so zählen auch diese Regelungen zum „Recht“, wenn wir es denn rein rechtlich, aber nicht theologisch oder philosophisch verstehen. Der Schießbefehl war geltendes Recht, mag er noch so sehr Unrecht gewesen sein. Theologisch bzw. philosophisch hingegen kann Unrecht niemals zu Recht werden, nur hilft einem im realen Leben diese Erkenntnis leider auch nicht weiter.
Der große Rechtswissenschaftler Gustav Radbruch hat den Konflikt zwischen Gesetz und Gerechtigkeit im Jahr 1946 nach seinen Erfahrungen in der NS-Zeit auf den Punkt gebracht. Die folgende Beschreibung wird zu seinen Ehren auch Radbruch’sche Formel genannt: „Der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit dürfte dahin zu lösen sein, dass das positive, durch Satzung und Macht gesicherte Recht auch dann den Vorrang hat, wenn es inhaltlich ungerecht und unzweckmäßig ist, es sei denn, der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit hat ein so unerträgliches Maß erreicht, dass das Gesetz als unrichtiges Recht der Gerechtigkeit zu weichen hat. Es ist unmöglich, eine schärfere Linie zu ziehen zwischen den Fällen des gesetzlichen Unrechts und den trotz unrichtigen Inhalts dennoch geltenden Gesetzen; eine andere Grenzziehung kann aber mit aller Schärfe vorgenommen werden: Wo Gerechtigkeit nicht erstrebt wird, wo die Gleichheit, die den Kern der Gerechtigkeit ausmacht, bei der Setzung positiven Rechts bewusst verleugnet wird, da ist das Gesetz nicht etwa nur unrichtiges Recht, vielmehr entbehrt es überhaupt der Rechtsnatur. Denn man kann Recht, auch positives Recht, nicht anders definieren denn als eine Ordnung und Satzung, die ihrem Sinne nach bestimmt ist, der Gerechtigkeit zu dienen.“
So verstanden wäre daher beispielsweise eine interne Anordnung bei der Berliner Polizei, wonach männliche, nicht aber weibliche Verdächtige in jedem Fall grundsätzlich auch körperlich zu untersuchen sind, grob gleichheitswidrig und auch in dieser Pauschalität unverhältnismäßig, aber diese Anordnung wäre immer noch Recht, die Anordnung eines pauschalen Schießbefehls hingegen nicht. Er stellt sich zu weit außerhalb der Rechtsordnung und der Verfassung, so dass man ihn nicht mehr als Recht betrachten kann. Diese Feststellung ist nicht nur abstrakter Natur – sie ist überaus bedeutsam, auch im heutigen praktischen Leben. Wer beispielsweise von Vorgesetzten Befehle oder Anordnungen erhält, die vielleicht sogar auf gültigen Gesetzen beruhen, die aber in dem vorgenannten Sinne so sehr gegen die Gerechtigkeit verstoßen, dass es den Befehlen oder den Anordnungen „quasi auf die Stirn geschrieben“ ist, der darf diesen Befehlen nicht nachkommen. In solchen Ausnahmesituationen besteht gewissermaßen sogar die Pflicht zum Widerstand. Wenn ein Vorgesetzter bei der Polizei seinem Untergebenen befiehlt, den Verdächtigen X zu erschießen, dann kann sich der Untergebene in einem späteren Prozess nicht darauf berufen, es habe einen Befehl gegeben. Er würde vielmehr wegen Totschlags oder sogar wegen Mordes verurteilt. Genau dies ist in den sogenannten Mauerschützen-Prozessen, die Teile des Unrechts der ehemaligen DDR aufgearbeitet haben, auch geschehen, und genau dies geschieht gegenwärtig auch in den Prozessen gegen die letzten Verbliebenen des NS-Regimes.