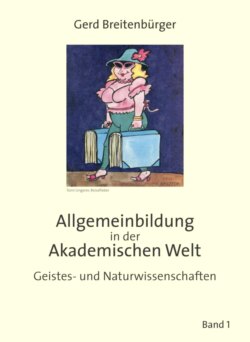Читать книгу Allgemeinbildung in der Akademischen Welt - Gerd Breitenbürger - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2.3 Scharniere der Welt
ОглавлениеDas Streben nach Wissen nennt der Theologe sapientia, für ihn die wichtigste Art des Wissens, nämlich die von Gott. Es geschieht immer auf dem Hintergrund, eine ganze Welt aufhellen zu können. Alles andere, was den meisten so wichtig ist, wird von der curiositas ins Auge gefasst, die eher weltlich und partiell (anteilig, in Teilstücken) neugierig ist. Wenn das Bild denn stimmt, dass der forschende Mensch sich asymptotisch der Wahrheit seiner Welt nähert, umso mehr kann er sich freuen, dass er sich, wenn ein anderes Bild denn stimmt, von ihr gleichzeitig als Folge seines immer konstruktiven Geistes entfernt. Denn wächst sein Wissensschatz, was bremst ihn da eine Wandtafel, vollgeschrieben mit der Weltformel und dem Letzten Wort "Finis" (Ende). Wissenschaft ist das, was immer weiter geht. Ihre Wahrheiten sind immer nur auf ihre aktuelle Situation bezogen. Carl Friedrich von Weizsäcker, der Philosoph und Physiker, hat eine griffige Formulierung gefunden:
Es gibt einen immer schon erschlossenen Bereich, in dem man sich gut genug verständigen kann, um – auf das dort herrschende Verständnis aufbauend, – neue Bereiche zu erschließen.
(C. F. von Weizsäcker, Die Einheit der Natur, S. 82).
Welten, auch wenn sie sich als ein System der menschlichen Sinngebung und richtigen Lebensführung verstanden haben, sind nicht computertauglich und können nicht unter das Gesetz des Seriellen gebracht werden, auch für den nicht, der gerne, wenn auch diskret, uns ein Typenschild anheften möchte. Nach der "Wende der Philosophie" erhebt die neue Logik erst gar nicht einen ganzheitlichen Anspruch. Der Positivismus im 19. Jahrhundert, der sich im Gegensatz zu Idealismus und Metaphysik sah, hat mit Auguste Comte (gest. 1857) behauptet, dass das Schicksal des Einzelnen von race, milieu, temps, von Abstammung, Milieu und Epoche deterministisch bestimmt ist. Der Neopositivismus hundert Jahre später will vor allem Erkenntnis methodisch und sprachlich sicherstellen. Logik, nicht Sinngebung durch Metaphysik, ihr Erbfeind, soll das ermöglichen. Alles muss kausal begründet werden können, Kausalität heißt ihr Schlachtruf. Was den Gesetzen der Logik zu widersprechen scheint, bleibt solange Gegenstand der Forschung, bis eine befriedigende Lösung gefunden wird. Typisch für die naturwissenschaftliche Erkenntnis ist ihr Verzicht auf jede ethische Bewertung. Dafür ist ihre Forschungslogik in der Lage, Schlüsse zu ziehen, die rein formal wahr oder falsch sind, egal, ob deren oberer Behauptungssatz überhaupt zutrifft oder nicht. Alle Menschen sind sterblich. Oskar ist ein Mensch. Dann ist Oskar sterblich. Hier trifft der obere Behauptungssatz zu. Alle Menschen sind weiblich. Oskar ist ein Mensch. Dann ist Oskar weiblich. Der Behauptungssatz ist falsch, die Schlusssfolgerung aber nicht. Hier erfolgt das Schließen unabhängig vom Inhalt. Da liegt eine Überleitung zur Logistik, wo es noch formeller zugeht. Sie untersucht die Verbindungen von Aussagen durch Junktoren. Sagt Elvira, Oskar oder Paul, muss sie, wenn sie sich auch im Leben logisch einwandfrei entscheiden will, zwischen "oder" = "vel" (im gleichstellenden Sinn, beide Terme kommen in Frage) und "aut" im ausschließenden Sinn, wenn der eine, dann der andere Term eben nicht, entscheiden. Bei "aut" muss sie sich endgültig entscheiden, Oskar oder Paul, bei "vel" kommen beide weiterhin in Frage, wie auch immer. Was ihre Liebe zur Logik festigen könnte.
Es ist nicht mehr die alte, klassische Logik. Seit Leibniz erkannt hat, dass diese nicht mehr ausreicht, hat man die neue Logik entwickelt. Sie, als Logistik und mit ihren Folgen bis zum Formalismus, schafft Klarheit an schwierigen Stellen, aber natürlich keine Welten. Sie hat fundamentale Bedeutung für die wissenschaftliche Erkenntnis. Aber sie selbst ist nicht die Welt.
Alle Urteile über die Realität sind durch Erfahrung begründet, sie können ein Weltbild, das auf Wesenheiten angewiesen ist, nicht zweifelsfrei definieren. Nur persönliche Gewissheit kann dies leisten. Die dogmatische Behauptung eines Weltbildes lehnt die wissenschaftliche Erkenntnis der neuen Zeit kategorisch ab. Der Neopositivismus zieht sich daher auf die Fachwissenschaften zurück. Sie sind computertauglich, ein Gesamt-Weltbild ist das eben nicht. Dieses ist nur auf dem Weg der Intuition zugänglich und der Hermeneutik (der Interpretationskunst), schließlich der Kunst. Naiv, subjektiv und ungefragt leitet ein solches Weltbild das Individuum, das auch zu den Wissenschaften einen akademischen Zugang hat. Es bleibt dabei seine Last, dass die obersten Werte und Normen, denen er folgen möchte, durch eben diese wissenschaftliche Erkenntnis nicht begründet werden können. Fundierungen fundieren die Wissenschaften, nicht, ob Elvira einen Junktor wie "aut" oder "vel" bei der schwierigen Partnerwahl zum Einsatz kommen lassen soll. Das spezifische Gewicht von Gold ist dem Individuum aber weniger wichtig, als die Frage, soll ich opportunistisch-unmoralisch handeln oder nicht. Der Neopositivismus verneint radikal jede theoretische Philosophie. Lediglich die Lehre von der Erkenntnis bleibt ihr ureigenes Gebiet. Was ist Erkenntnis, mit welchen Methoden lässt sie sich bewerkstelligen, respektieren die Fachwissenschaften konsequent die Logik. Wissenschaftslogik statt Welterkenntnis. Nur im Verein mit den Fachwissenschaften wird schon mal gehofft, dass Philosophie zu einem Einheitssystem der Erkenntnis, zu einem Weltbild gelangt, das nicht nur physkalistisch zu nennen wäre. Der Neopositivismus hat gezeigt, dass das nötig, aber selbst auf der Ebene der Begriffslogik nicht möglich ist.
Umwelten, die die Soziologen in künstliche (der Mensch/das Tier hat sie gestaltet) und natürliche (der Fuchs findet sie im Wald vor) einteilen, halten die Wissenschaften grundsätzlich für messbar, mit Hilfe ihrer szientifischen Instrumente Maß und Zahl. Man will vollständig die Merkmale einer Umwelt angeben können, um so zum Beispiel auch sagen zu können, was sie belastet. Um dann aus der so zerlegten Welt doch wieder eine ganze Welt zu machen oder ihre Welt als eine ganze zu bewahren, sagen sie vereinfachend und mit Überzeugung, dass der Richard Tauber von etwas singt, das es nicht geben kann. Die Methode, für die man sich entscheidet, sagt, was wichtig ist und sagt auch, was man ignorieren möchte.
Es gibt immer nur einen individuellen Blick auf das Wissen und ein individuelles Teilnehmen an Wissensbeständen. Sie werden von uns interpretiert, bewertet und synoptisch zusammengefasst zu einer Wissenswelt, die uns persönlich gehört. Selbst ein Fachmann ist nicht in der Lage, zum Beispiel alles, womit sich thematisch die Psychologie-Richtungen beschäftigen, zu überblicken. Unser Verstand ist aber so strukturiert, dass wir erst mit einer holistischen Gesamtschau zufrieden sind und ist zwangsläufig darauf angewiesen, solche strukturierende Synopsen, die das leisten, zu erstellen. Es ist nicht nur reizvoll, mit Hilfe von Strukturanalogien über die Fachgrenzen hinweg von Quantitäten zu einer übergeordneten Qualität zu kommen, das eigene Fach gewinnt auch noch durch die Außenansicht an Kontur.
Goethe hat das im Auge, was man eine Kontingenz nennen muss: Eine schöne Möglichkeit, die eine Unmöglichkeit bleiben wird.
Wer nicht von 3000 Jahren
Sich weiss Rechenschaft zu geben,
Bleibt im Dunkeln unerfahren,
Mag von Tag zu Tage leben.
Zwar bleiben die Bildungsenthusiasten, die nicht so streng wie der Klassiker Goethe Unmögliches verlangen, offen für eine lässigere Forderung an sich selbst. Unverkennbar bleibt aber, dass hier eine geradezu aristokratische Bildungskonzeption ihren Anspruch vorführt, der sich sicher ist, nicht bei Lücken ertappt zu werden. Das kann man als Hinweis dafür nehmen, dass es späteren Generationen in manchen Dingen im Laufe der Zeit doch besser ergangen ist, man denke statt an Homer und Dante an die Medien der Kommunikation. Wer den Schweizer Käse liebt, sieht die Löcher, hält sie aber nicht für einen "dunklen" Makel. Im Gegenteil, dieser Käse wäre ohne Löcher nicht das, was er ist. Bildung braucht die Klugheit, Akzente setzen zu können und das heißt auch: Das, was nicht da ist, gehört schon immer dazu.
Die "Welt" ist ein schillernder Begriff. Es muss sich dabei um Quantifizierbares handeln, sagen wir doch "das kostet nicht die Welt". Das stimmt schon, Quantitatives ist in ihr enthalten, aber auch das sogenannte Qualitative, das immer ganz anders bewertet wird. So geht es mit dem Begriff "Kultur". Eine Anzahl Bakterien in der Petrischale wird so quantitativ bezeichnet, einschließlich der Eigenschaft, dass sie wachsen können. Aber auch die Zeit, in der Bandkeramik in Europa auftauchte und "blühte". Wir kennen eine Wohnkultur, eine Esskultur oder schlicht einen kultivierten Menschen. "Kultur" ist nicht "Natur". "Kultur" soll den Menschen begleiten und sein Leben steigern, "Natur" will er – nach nicht zu korrigierendem Konzept der Bibel und des uneingeschränkten Egoismus – beherrschen.
Das Tier hat eine "Welt", ein Habitat, der Mensch hat seine Welt (ohne Anführungszeichen). Und er lebt in einer oder mehreren Welten. So eben auch in der akademischen. Sie ist integriert in eine Gesellschaft, die ebenso beanspruchen kann, die Horizonte einer umfassenden Welt zu besitzen. Eine gewisse Struktur haben diese Welten, aber auch Wertmaßstäbe, auch Emotionen von der Sehnsucht bis zum Glück. Korsettstangen der Gesellschaft, die eine Welt ermöglichen, gehören wie die Studienbedingungen zu einem Studium. Die Funktionssysteme, für die sich die Wissenschaften engagieren, leuchten mit ihrer Relevanz sofort ein. Wirtschaft, Recht, Religion, Wissenschaft und Kunst, die Reihenfolge ist hier nicht erheblich. Man sieht sogleich, dass diese Bereiche Gegenstände akademischer Studien sind. Die akademische Welt bezieht sich, was ihre Wissenschaftlichkeit angeht, auf das elementare Gelingen unserer Gesellschaft. Sie ist alles andere als ein nur zufällig agglomeriertes (anhäufen, zusammenballen) Gebilde. Über kein Thema wird mehr nachgedacht, in keine Welt wird mehr Geistesarbeit investiert als in diese positivistisch nicht auszuschöpfende Welt.