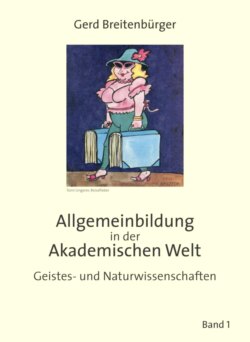Читать книгу Allgemeinbildung in der Akademischen Welt - Gerd Breitenbürger - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INHALTSVERZEICHNIS
ОглавлениеTeil 1
1 DIE AKADEMISCHE WELT
1.1 Wahrheit und Phantasie
1.1.1 Original oder Plagiat
1.1.2 Plagiat und Fachtermini
1.1.3 Das Plagiat ist penetrant anhänglich
1.2 Viele Welten, eine Welt
1.2.1 Die Teilwelten
1.2.2 Die Welt der Philosophie
1.2.3 Scharniere der Welt
1.2.4 Erste Schritte in die akademische Welt
2 SELBSTVERWIRKLICHUNG
2.1 Kultur und Bildung, Halbbildung
2.1.1 Halb- und Hochgebildet
2.1.2 Die zwei akademischen Welten
2.1.3 Bildung ist holistisch und lebt von der Freiheit
2.1.4 Bildung und Wissen
2.1.5 Auch reduktiv ist produktiv, sogar kreativ
2.1.6 Selbstverwirklichung – was willst du noch mehr
2.1.7 Der Bildungskanon für die Unsicheren
2.1.8 Bildung, mal ernst, mal heiter
2.1.9 Halbbildung, Vorstufe zur Vollbildung?
2.1.10 Ein gutes Gedächtnis
2.1.11 Bildung hat ein persönliches Profil
2.2 Zauber mit Muffen
2.2.1 Neue Chancen
2.2.2 Zauber lieber ohne Muffen
2.2.3 Die Uni bietet neue Chancen
2.3 Lurchi und das Biotop
2.3.1 Umwelt, deren Grenzen kein Thema sind
3 ORIENTIERUNG IM UNI-LEBEN
3.1 Praktisch und rational
3.1.1 Rationalität ist ein Instrument
3.1.2 "Wahr" und "falsch": die Kriterien der Logik
3.1.3 Von den Inhalten zu den Strukturen
3.1.4 Lernen stärkt die Individualität
3.1.5 Transfer rationaler Strukturen
3.1.6 ANALYSE: Methodische Fehler bei Hausarbeiten
3.1.7 Ernst des Studiums – wo bleibt die Heiterkeit
3.2 Kosmische Suppe und die Kultursuppe
3.2.1 Beispiel: Cross-over als Analogie-Technik
3.2.2 Tanten beim Tee und dasselbe Bildungsbuch
3.2.3 Die Schicksalsfrage: Eintritt Ja oder Nein.
3.2.4 Praktische Orientierung
3.3 Wissenschaftliche Orientierungen
3.3.1 Der universale Zugang zu den Wissenschaften
3.3.2 Wissen und Wissenschaft, ein Vorgeschmack
3.3.3 Akademisches Leben: Intelligenz – Phantasie
3.3.4 Erklären heißt "Mach es erst einmal dir klar"
3.3.5 Einzelwissenschaften diversifizieren das Wissen
3.3.6 Entstörungsstelle Couch und der Erfolg
3.3.7 Modus Potentialis
3.3.8 Real und nicht real gegebene Gegenstände
3.3.9 Durch Ausschluss das Richtige finden
3.3.10 Helle Welt, nicht nur im Siècle de Lumière
3.3.11 Drinnen und draußen, Entdeckung der Höhle
3.3.12 ANALYSE: Wörter und Denken
3.3.14 "Ich doof, aber Präsident"
3.3.15 ANALYSE: Intelligenzplafond
3.3.16 Computer und seine Metapher
3.3.17 Geschichten füllen Begriffe mit Inhalt
3.3.18 Paradoxe Theorien: Ratchet-Effekt
3.4 Wissenschaft, zentral in unserer Kultur
3.4.1 Kritischer Realismus: Wissenschaft als Baustelle
3.4.2 Falsches Wissen: Wertvoll, auch wenn falsch?
3.4.3 Fehler und Kabarettistisches ohne Witz
3.4.4 "Er/sie hat sich bemüht"
3.4.5 Esoterischer Stil in den Wissenschaften
Teil 2
4 STUDIUM GENERALE UND KOMPETENZ
4.1 Ich bin der Amboss und der Hammer
4.1.1 ANALYSE: Die Phantasie bei Huysmans
4.1.2 Tu's für dich, tu's mal umsonst
4.2 Kompetenz mit Augenmaß
4.2.1 Berufswahl: ohne Selbstausbeutung
4.2.2 Mit Lust in die Überforderung
4.2.3 Studium generale – Zeitverschwendung?
4.3 Spielraum statt Verbissenheit
4.4 Fachkompetenz und soziale Kompetenz
4.4.1 Der Generalist
4.4.2 Zwei Studienfächer erleichtern den Erfolg
4.4.3 Die eigene wie die Kompetenz anderer einschätzen
4.4.4 Kompetenz mal anders: Wer kann muss ran
4.4.5 – wer kann, darf ran
5 DAS AKADEMISCHE STUDIUM
5.1 Ohne Abitur zum Studium
5.1.1 Bastel-Existenz
5.1.2 Zauber des Anfangs oder Absturz einer Illusion?
5.1.3 Versuch und Irrtum, in kleinen Dosen
5.1.4 Eintritt in die akademische Welt
5.1.5 Kulturelle Fragen und ihre agonale Würze
5.1.6 Funktionalität der Rationalität
5.1.7 Rationalität und die Lebensplanung
1.1.1 Die Wahl des Faches aus Neigung
1.1.2 Die traurige Gestalt des ewigen Studenten
5.2 Nischen für das akademische Leben
5.3 Monitoring: die universitäre Hilfestellung
5.3.1 Das Ergebnis heißt "Akademisch"
5.3.2 Bachelor-Master-System
5.3.3 Bachelor –Habilitation
5.3.4 Professor
5.3.5 Warum studieren und die Aussichten
5.3.6 Arbeitslos. Die Gegenwelt
5.3.7 Daneben und nicht arbeitslos
5.3.8 Triebverzicht = Kultur. Kulturverzicht= ?
5.3.9 Akademiker mit Berufsrisiko
5.3.10 Bedürfnispyramide "Was willst du noch mehr?"
5.3.11 Aspekte der akademischen Existenz
5.3.12 Ethos und Moral, rarissime?
5.3.13 Usus, Konvenienz und andere Regelsysteme
Teil 3
6 BASISWISSEN KULTUR
6.1 Orientierung und Phantasie
6.1.1 Positivismus
6.1.2 Studier- und Arbeitstechniken
6.1.3 Öffentliches Reden
6.1.4 Alltag und Brüchigkeit der Kausalketten
6.1.5 Kausalketten und die Phantasie
6.1.6 Phantasie und Poesie
6.1.7 Phantasie und existentielle Folgen: Eskapismus
6.1.8 Selbstbehauptung: Amöbe wie der Studierende
6.1.9 Lucy: Orientierung immer mit Risiko
6.1.10 Bummeln, Notwehr gegen Rationalität?
6.1.11 Die Begabungsreserven sind zu aktivieren
6.1.12 Vom Erwartungshorizont zum Naturgesetz
6.1.13 Vom Sammler zum Wissenschaftler
6.1.14 Fahrstuhlfahren mit Einstein.
6.1.15 Happy End in den Schlusspassagen
6.1.16 Schlusspassagen
6.2 Beliebte Topoi
6.2.1 Ursprungsdenken
6.2.2 Kulturelles Basiswissen
6.2.3 Fundiertes Wissen
6.3 Evolutionäre Erkenntnistheorie
6.3.1 Die Realität der Kontingenz
6.4 Das verschleierte Bild zu Sais
6.4.1 Wir brauchen das nicht existierende "Reale"
6.4.2 "Reale Bedrohung" ist real
6.4.3 Dichotomie, Antinomie, Extreme
6.5 Mathematische und andere Wahrheiten
6.5.1 Leitwährungen: Physik, Biologie, Physiologie
6.5.2 Die Sprache für alle, für alles
7 ANTHROPOLOGISCHES
7.1.1 Andere Möglichkeiten hätte es gegeben
7.1.2 Kausalität im Umkreis von Kontingenz
7.1.3 Dualistisches Weltbild
7.1.4 Dissoziieren als psychischer und physischer Akt
7.2 Das "Wesen" wollen wir finden
7.2.1 Das Wesen, die Quintessenz, das Geistige
7.2.2 Etymologie, ein Beitrag zum "Wesen"
7.2.3 Biologische Anthropologie
7.2.4 Meinung, Gewissheit
7.2.5 Schweigen ist Gold
7.2.6 Das Individuum, das sich wählt
7.2.7 Bedürfnisse nach Maslows Pyramide
7.2.8 Die Moral der Systeme ist Ideologie
7.2.9 Die Utopie und ihre wirtschaftliche Ideologie
7.2.10 Arbeitsleid für niemand: auch eine Utopie
Teil 4
8 GRUPPE UND MORAL
8.1 Wer "in" ist, weiß, was "out" bedeutet
8.2 Ethik für Anfänger
8.2.1 Das angekratzte Renommee
8.2.2 Lyssenko: Wissenschaft im Griff der Ideologie
8.3 Ideologie als Philosophie-Verschnitt
8.3.1 Ideologien
8.3.2 Ideologien schaffen Parteien
8.4 In der Gruppe: mitgegangen – mitgefangen
8.4.1 Die Gruppe bringt Vorteile und Nachteile
8.4.2 Gruppe und die positiven Sanktionen
8.4.3 Die Zukunft ist offen, nicht determiniert
8.4.4 Primärgruppen, Sekundärgruppen
8.4.5 Kohäsion der Gruppenelite wie bei den Makaken
8.4.6 ANALYSE: Gruppe: Bis dass der Tod
8.4.7 Moral oder machen wir nur Fehler?
8.4.8 Moral und das agonale Prinzip
8.4.9 Folterwerkzeuge vorzeigen
8.4.10 Der Einzelne, ohne Gruppe: einsam
8.4.11 Kasuistik: Moral maßgeschneidert
8.4.12 Szenarien – Phantasie und Kalkül
8.5 Anerkennung in der Gruppe
8.5.1 Fides: Vorteile durch Doppeldeutigkeit
8.6 Altruismus und Eigennutz
8.6.1 Moral oder lügen: Beides hat seinen Preis
8.6.2 Der Hohn des Marquis
8.7 Gemischte Moral-Strategie in der Natur
8.7.1 Spiegelneuronen, Magie oder fauler Zauber
8.7.2 Der Glaube ist dem Wissenschaftler nicht fern
8.7.3 Juliette auf dem Canapé promotion
8.7.4 Mobbing klingt gemütlich
8.7.5 Im Kloster und im Altersheim wird gemobbt
8.7.6 Kategorische Ethik aus einem Wort
9 WAHRHEIT – GLAUBWÜRDIGKEIT
9.1 Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit
9.1.1 Pragmatische, amoralische Lösungen
9.1.2 Der Kampf um die Glaubwürdigkeit
9.1.3 Recht und rechtsfreier Raum
9.2 Autorität: Tradition des Christentums
9.2.1 Akademische Autoritäten: Die Juristen
9.2.2 Akademische Autoritäten allgemein
9.2.3 Autonomie, Quelle für Autorität
9.2.4 Autorität und Kompetenzüberschreitungen
9.3 Autorität, ist sie transferierbar?
9.3.1 Autorität innerhalb des Faches
9.3.2 Autorität: Intellektuelle
9.3.3 Autorität: Probierstein und Treibsatz
9.3.4 Kirche und Galilei und ihre Glaubwürdigkeit
9.3.5 Glaubwürdigkeit und Autorität als Schutz
9.4 Man muss sie sich leisten können
9.4.1 Wahrhaftigkeit in der Politik und im System
9.5 Die Wahrheit geht voran
9.5.1 Ehrlichkeit lässt am längsten auf sich warten
9.5.2 Wahrhaftigkeit in der Gesellschaft
9.5.3 Vorschuss aus Autoritätsguthaben
9.6 Wahrheiten, absolut und relativ
Teil 5
10 ERKENNTNIS
10.1 Raffinierte Verhaltensweisen in der Natur
10.1.1 Mit affenartiger Intelligenz
ANALYSE: Neukaledonische Krähe
10.1.2 Passende Möglichkeiten
10.2 Der Mensch, ein Affe plus X ?
10.2.1 Logik – plane et distincte
10.2.2 Mephistopheles
10.2.3 Erkenntnis will Konsistenz, nicht Kuddelmuddel
10.2.4 Ausdifferenzierung der Welt in Symbolen
10.3 Weltformel, das Denken der Einheit
10.3.1 Phylogenetisch e Automatismen folgen Quasigesetzen
10.3.2 Assoziation und Automatismen
10.3.3 Model und Modell Lucy
10.3.4 Lucy differenziert die Ordnung
10.3.5 Vertrauen des Flughörnchens
10.3.6 Soziale Ordnung
10.3.7 Lucys Vertrauen in ihre Methoden
10.3.8 Lucy: Bedarf für die Signalsprache
10.3.9 Baumaffe: Sprache zum Tricksen
10.3.10 Mit Verzögerung ins Bewusstsein
10.3.11 Ein brauchbarer Wahrheitsbegriff
10.4 ANALYSE Julia war cool und logisch
10.4.1 Die Negation und der Widerspruch
10.4.2 Das Absprechen von Eigenschaften
10.4.3 Die emotionale Seite der Logik und der Wahrheitsfunktion
10.4.4 Definitionstypen
10.4.5 Definitionen kann man ändern
10.4.6 Fuzzy Logik
10.4.7 Die Schwäne und ihr Keuchhusten
10.4.8 Topos: Das Teil und das Ganze
10.4.9 Geistlose Substantivierungen
10.4.10 Intelligenz
11 ASSOZIATION UND DIE KAUSALKETTE
11.1 Gestaltpsychologie
11.2 Nuancen
11.2.1 Der Elativ hebt ab
11.2.2 Assoziationen ebnen und begleiten den Weg des Denkens
11.3 Denken geht ganz ohne Moral
11.3.1 Kausalketten
11.3.2 Kausalität mit Störfaktoren
11.3.3 Frühe kausale Evolution der Erde
11.3.4 Genauigkeit aus dem Geist der Phantasie
11.3.5 Fantasie gegen die Faktizität der Natur
11.3.6 Gesetzmäßigkeiten ohne Fantasie: ein Mottentanz
11.4 Wissen und automatischer Programmablauf
11.4.1 Wissen, wenn Meinungen nicht reichen
11.5 Begriffe und ihr gewagter Gebrauch
11.6 Präzision in der Natur – und in den Begriffen?
11.6.1 Präzision als ein Prinzip des Lebens
11.6.2 Im Kosmos gibt es Präzision, nicht Freiheit
11.7 Evolutionen, so viel man will
11.7.1 Animismus, die eingeforderte Kausalität
11.8 Geistige Abnutzungskausalität, durch Nivellierung
11.9 Denken als psychischer Akt: Kognitionen
11.9.1 Zahlen und Symbole
11.9.2 Die Evolution, passiv und aktiv
11.9.3 Die Methode des homo plastäs
11.9.4 Der monistische Ansatz
11.9.5 Der Topos vom Anfang und Ende
11.10 Theologie, Ideologie: riskantes Denken
11.10.1 Theologe/Ideologe: Der Mensch genügt sich nicht
11.10.2 Utopie, Strafe für das Denken
11.10.3 Gesellschaftordnung bei Platon und Aristoteles
11.10.4 Utopie als Niete: "We-can"
11.10.5 Rhetorik der Utopie: "we"
11.10.6 Die Utopie des Luxuslinken
11.10.7 Sozialdarwinismus und ideologische Neg-Utopie
11.10.8 Philosopheme reduziert auf Meinungen (Doxa)
11.11 System und seine Kontingenz
11.11.1 Der Bauchladen als frühes Handels-System
11.11.2 Elementare Volkswirtschaft
11.11.3 Stationäre Wirtschaft oder Wachstum
11.11.4 Wer Identität denkt, glaubt an die Differenz
11.11.5 Modell, Kasuistik und ceteris paribus