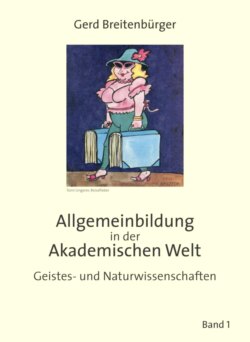Читать книгу Allgemeinbildung in der Akademischen Welt - Gerd Breitenbürger - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2 Viele Welten, eine Welt
ОглавлениеFür alle gilt aber in der akademischen Welt: Nimm, was du kriegen kannst. Darin steckt etwas Zügelloses, zunächst Ungeordnetes. Es bezeichnet den gierigen Aspekt von Wissenschaft wie auch den von jedem Sammeln. Wer seine Graugänse oder Leoparden wie Konrad Lorenz oder Bernhard Grzimek liebt, braucht ein ganzes Institut in schöner See-Lage oder sammelt für die Tiere Afrikas aus Passion bis er selbst voller Hingabe in diesen Weiten seinen Seelenfrieden findet. Dies sind Elemente seiner Welt, die er in sie integriert. Mit dem Begriff "Welt" ist dann ein Ganzes gemeint, das zu objektivieren dem Einzelnen nicht möglich ist. Aber es gibt auch Inhalte, also Teile des Ganzen, die sich nicht gut systematisieren lassen. Und das wird mit Bedauern festgestellt, wenn eine politische Welt substantiell verändert werden soll. Das gradualistische Vorgehen step by step in einem holistischen Supersystem, in einem ungewöhnlich großen Makrosystem, müsste zum Beispiel, sehr fein abgestimmt sein, wenn es, wie etwa in der Finanzkrise seit 2008, die Befugnisse der EZB für alle Länder entscheidend ausweitet. Eine ganze Welt hängt dann an einem oder zwei Drehknöpfen, wenn die Europäische Zentralbank sich entscheidet, verschuldete Staaten zu finanzieren, und zwar ohne Limit. Die zur Umstrukturierung einer ganzen Welt nötigen Zeiträume sind aber entweder zu knapp bemessen oder überfordern unsere Geduld und Möglichkeiten, wenn sie im Ganzen optimiert werden soll.
Wenn der Kopfinhalt und die Reichweite des Herzens die "Welt" eines Menschen umschreiben, dann kann man diese Welt nicht auf den Nenner einer Formel bringen. Noch nicht, sagt der Szientist. Wir arbeiten daran. Sogar wenn es stimmt: Wir sind in diesem Weltall nicht allein, so könnten Aliens von unserer Welt in der Weise einen Erlebnisbericht geben, dass wir nicht uns und unsere Welt besser verstehen, sondern nur sie, die Aliens. Sie werden uns intuitiv durch ihre Beobachtungen und Beurteilungen verständlich; denn wir messen sie an dem, was wir von uns wissen. Die Umwelt der Tiere, ihr habitat, ist sowieso kein Begriff, der mit unserer Welt "im Wesentlichen" kompatibel (vereinbar) wäre, da wir unsere Welt systematisch und historisch gestalten. Selbst Teilwelten von der ganzen Welt des Menschen, wie man sie schon in der Antike heraus selegierte (auswählte), "mundus mulieris" (lat., "Welt" oder auch "Schmuck" der Frau), oder hier "akademische Welt", bleiben – holistisch – immer ein Ganzes.
Mit einer quantitativen Aufzählung seiner Merkmale kann das Ganze, die Welt, nicht erschöpfend beschrieben werden, wie der Mensch nicht ausreichend beschrieben wird, dessen Baustoffe (Mineralien, Metalle, Spurenelemente) man nach Grammgewicht aufzählt. In der Vergangenheit hat man dem Begriff „Welt“ immer eine sehr hohe Qualität beigemessen, mit dem man ihre Struktur als allumfassend darstellen wollte. Die Griechen und Römer ästhetisierten sie, Kosmos ist die Welt und das Schöne, das ausgehende Mittelalter wies moralisierend auf die Vergänglichkeit hin, Welt als fragwürdiges Glück, das in der Allegorie einer Glücksgöttin auf dem Rad die Unbeständigkeit symbolsiert. Schließlich, mit einem makabren Bild, war die "Frau Welte" eine anziehende Eva in der Vorderansicht, in der Rückansicht voller Würmer, Kröten und Schlangen. Schon damals ist die Welt als hoffnungslose Zumutung, als ein Ganzes ohne Idealität gesehen worden. Mit dem Aufblühen der modernen Naturwissenschaften trifft seit Galilei eine betont nüchterne Weltauffassung auf eine traditionell religiöse Auffassung, eine genaue Beobachtung und Berechnung auf Transzendenz und Glauben. Zwischen beiden vermittelt ein residualer (restlicher) Glaube, dessen man sich aber bewusst ist. Es ist der Glaube an die Sterne, die Astrologie der Naturforscher, die ihnen das rätselhafte Geschick zu verstehen hilft. Der Anblick des Kosmos scheint dann aber heute alles zu vereinen, das Ästhetische mit dem Moralischen über den Gedanken an die Zeit, und selbst das Religiöse lässt sich nicht ganz von der Hand weisen.
"Welt" ist schließlich für den Forscher heute ganz sachlich die Umwelt plus ein je ne sais quoi. Von dort schließlich noch sachlicher, nur noch die Physik meinend, Welt als Metapher, aber ohne Gänsefüßchen:
„eine anfängliche RNA-Welt (wird münden) in vielen Fällen schließlich in eine RNA-Protein-Welt." Und Plural: "Eine Reihe von RNA-Welten ging möglicherweise auf der Erde zugrunde, weil der Zufall nicht die notwendige Mutation lieferte“.
(Christain de Duve, Aus Staub geboren, Leben als kosmische Zwangsläufigkeit, S. 143, ins Deutsche übersetzt von Sebastian Vogel).
Gemeint sind das „Helix-Modell“ und die Ribonucleinsäuren mit ihren unterschiedlichen Funktionen Messenger-RNA, TransferRNA und den Orten, an denen sie synthetisiert werden. Eine Art Ensemble mit Eigengesetzlichkeiten, eine noch nicht biologisch fabrizierende Fabrik, die aber erste präbiotische Substanzen herstellt.
Duves „Welten" bezeichnen chemische Reaktionswege mit ihren nicht auszuschließenden und von ihm berechneten Kontigenzen (Möglichkeiten). Vielleicht könnte man sie sogar als schön bezeichnen, als komplex und anbetungswürdig, weil sie das Leben auf der Erde vorbereiten. Was sie nicht mit Notwendigkeit mussten.
„Welt“ ist kein positivistischer Begriff für etwas das messbar und berechenbar wäre. Es ist eher ein poetischer Begriff, „Welt, du kannst mir nicht gefallen …“ (Albert Lortzing, Der Waffenschmied), ein Begriff wie Metaphysik, der im Positivismus keine Bedeutung hat.
Der Gebrauch, den de Duve von diesem Begriff macht, ist denn auch ein emotionaler. Es geht in dieser Phase der Evolution um sehr viel, um das, was präbiotisch geschah, bevor die erste Zelle entstand, wohl genauso spannend, wie die "selforganisation of matter" (Selbstorganisation der Materie zum Lebenden hin) selbst, die darauf folgte. Fragen, um seriöse Forscher ein Leben lang zu erregen. Aber es ist sehr häufig zu beobachten, dass Wissenschaftler ihre Zurückhaltung auch sprachlich ungewollt aufgeben können, wenn sie Großes meinen. "Welt" ist hier eine gewagte Metapher, eigentlich nur für "Umwelt" oder, noch schlichter, für ungenießbare "Suppe" stehend, die in Pfützen und Felsspalten das Ungeheuerliche vorbereitet. Wenn man boshaft wäre, könnte man sagen, die vorliegende Wortwahl drückt das aus, was ein monistischer, szientifischer Forscher gerade verbergen will: Dass da mehr geschieht als das, was er mit dürren Worten nicht zu beschreiben wagt, so etwas wie Ehrfurcht gebietende Schöpfung in statu nascendi (im Entstehen begriffen). Außerdem hat dieser Begriff "Welt" in einem naturwissenschaftlichen Zusammenhang geradezu eine klassische Brückenfunktion zur "Welt des Geistes". Es wird nicht behauptet, bei der Autopoesis (Selbsterschaffung des Lebens) sei Geist im Spiel, sie wird monistisch im materialistischen Sinne verstanden, aber über die Sprache ist er schon dabei. Der Geist, immer schon ein Schmuggelgut der Materie, bis er offensichtlich zum Thema wird.
Ob den Pithec (Affe) mit dem Homo sapiens ein Knochen verbindet (missing link) oder ein veritabler Hiatus (Lücke), ist vielleicht noch nicht die ganz richtig gestellte Frage. Eine Patchwork-Population ist vorstellbar, in der einige Hominiden-Mitglieder etwas können, was die anderen gar nicht können wollen. Statt der zwei Welten, die von einem missing link zu einer Welt verbunden werden müssen, haben wir es hier mit einer einzigen zu tun. Da gab es Unwillige, wie sie auch heute noch als wichtiges Ziel engagierter Bildungspolitik empfunden werden. Damals allerdings ließ man niemand, der nicht lernen wollte, mit dem Feuerstein umzugehen, in der Kälte stehen. Die Onkeln und Tanten wurden für die Sorge um den Gruppennachwuchs und im Genpool gebraucht. Sie mussten nur lieb sein, Feuer machten die anderen. Die Gruppe hat der unvermeidbaren Umwelt etwas hinzugefügt, was aus ihr eine Welt machte: Merkmale und deren Manipulierbarkeit. Der römische Dichter Vergil hat es sehr früh auf den Punkt gebracht. Die Bienen haben einen perfekten Staat, den der Mensch sich – als seine Welt – nur wünschen könnte. Aber zur Menschenwelt fehlt dem Bienenstaat ein weiteres Merkmal, für Vergil war es die Liebe. Damit hat der Mensch ein Schicksal, aber auch die Würde, um es zu bestehen, gegen alle Determinanten der Umwelt einschließlich eines perfekten Staatswesens.
Als klares geistiges Konzept mit den drei Welten hat Popper die Gesamtwelt zum System erhoben. In "Welt 1" finden wir alles Physikalische, die Alpen wie den Fixstern, in "Welt 3" die Kultur mit ihren geistigen Hervorbringungen (etwa Theorien, Religionen, ein Gedicht etc.), auch wenn sie sich in hergestellten Gegenständen wiederfindet (Kleidung, Bücher etc.). Der materialistische Monist würde sagen, diese zwei Popper'schen Welten sind im Grunde eine einzige Welt und sie genügt mir, da ich den Geist aus Welt 3 in Welt 1 nicht bequem, aber mit etwas Wagemut unterbringen kann. Der Commonsense könnte wohl auch sagen, zwar sind der Kugelschreiber und das Gedicht, das ich mit ihm schreibe, zwei verschiedene Dinge, auch Welten, und ich bin in der Lage, andauernd Dinge als von mir verursacht zu sehen, aber die Sprache erlaubt mir, von allen zu sagen, sie seien meine eine Welt. Es gibt also einen Weg, beide zusammenzufassen. Dieses Gedankenschema findet sich heute bei vielen Naturwissenschaftlern, wenn sie sagen, sie müssten den Begriff "Materie" so erweitern, dass der Geist noch hineinpasst und jeder Dualismus überflüssig wird.
Weder physikalisch noch psychologisch ist dann die Behauptung einer 2. Welt, einer vermittelnden Zwischenwelt bei Popper. Ein reiner Geist haust hier und vermittelt zwischen Kugelschreiber und Gedicht. Das ist reiner Dualismus, den kaum noch jemand heute vertritt (neben Popper der Neurophysiologe John Eccles, gest. 1997). Wer in einer Welt lebt, genießt Sicherheit, bis er sie zu bezweifeln anfängt oder gleich ganz verliert. Es ist die entscheidende Kulturleistung des Frühmenschen, seine Umwelt nicht einfach aufzugeben, indem er sie verlässt. Er lässt sie in einer Welt, die seine neue Errungenschaft ist, aufgehen, die qualitativ mehr ist. Er kann sie interpretieren und manipulieren. Er ist nun aber für seine Sicherheit selbst verantwortlich.
Der naturwissenschaftliche Ansatz traut sich zu, die Welt des Menschen, die er passend reduziert, aufgrund von Determinanten berechnen zu können und so zu objektivieren. Geht es um Systeme, erhalten die Aussagen Gesetzescharakter.
BZ: Haben Sie Hoffnung auf eine Erneuerung der politischen Kultur?Dimou: Ach, ich bin nicht sicher. Ich habe viele gute Leute gesehen, die in die Politik gegangen sind und in kürzester Zeit völlig verdorben wurden. Sie haben eine Wahl, wenn Sie in Griechenland Politiker werden: Entweder Sie spielen mit, und dann sind Sie einer von denen, oder Sie spielen nicht mit. Dann werden Sie vom System ausgespuckt.
(Dimou: Schriftsteller Nikos Dimou. "Griechen sind nicht rational", BZ-Interview, 21. 02. 2012).
Das ist eine krasse Formulierung zu dem allgemeinen Thema, was passiert in der beruflichen Sozialisation, wenn die relativen Freiheiten eines ungezwungenen Studentenlebens den neuen Gegebenheiten weichen. Ein soziales System der geschilderten Art determiniert den Menschen, weil es Abweichungen nicht zulässt. Wie ein Gesetz ohne Randbedingungen, genannt das "eherne Gesetz". Aber es besteht auch die Alternative, sich ihm zu entziehen. Denn ein Gesetz brauchen wir nur zuzulassen, wenn wir von sicheren Ausgangsbedingungen ausgehen müssen, sonst würde es nur als Fantasy die Lehrbücher schmücken. Wenn diese Bedingungen aber nur unter Unsicherheit eintreten und eingetreten sind, unsicher, da eben von menschlichen Handlungen abhängig, die nicht immer prognostizierbar sind, schüttet das Füllhorn seine allseits beliebte Gaben aus: Wir erhalten Möglichkeiten geschenkt, und, wie nicht anders zu erwarten, von der unterschiedlichsten Art. Da darf dann unsere persönliche Kultur entscheiden. Da darf sich unsere persönliche Kultur herausbilden in den Entscheidungen. Da können wir dann sagen, das, was ich da sehe, kommt in meiner Welt nicht vor.
Menschen, die sich nicht einfangen lassen von einem Habitat wie von schicksalhaften Sachzwängen hat es immer gegeben, in allen Varianten des Untergrunds bis zur Rebellion. Es ist dann immer der andere Mensch wie der letzte Held in George Orwells Schreckutopie "1984" und wie eine ganze Gruppe, die von sich behauptet hat "Wir sind das Volk". Auch im akademischen Bereich gibt es den Zwang, sich zu entscheiden, welcher Welt man angehören will, was dann besonders schmerzlich ist, wenn man nicht darauf vorbereitet war, tiefsinnige Selbsterforschung zu betreiben und akzentuiert moralisch sein zu müssen. Der Opportunismus ist ein starker Ratgeber, aber nicht einer, auf den man immer hören möchte.