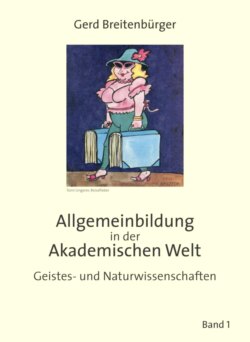Читать книгу Allgemeinbildung in der Akademischen Welt - Gerd Breitenbürger - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1.2 Die zwei akademischen Welten
ОглавлениеFolglich: Wer die akademische Welt, die ja auch eine Form der Bildung voraussetzt, mögen oder ablehnen will, muss sich in sie in jedem Fall hineinbegeben.
Diese Welt besteht aus zwei Hemisphären (Halbkugeln), wie erst in neuerer Zeit behauptet wird. Die eine wird von den Geisteswissenschaften und die andere von den Naturwissenschaften gebildet. Wenn man keine Angst vor Übertreibungen hat, kann man eine noch elementarere Unterscheidung vornehmen. Es gibt die Anthropologie und die akademische Anthropologie. Es gibt die Lehre vom Menschen und die vom akademischen Menschen. Der Homo academicus als Species sui generis (Species eigener Art), Teil der bürgerlichen Gesellschaft, mit einem Habitat, einer Lebenswelt, die einmalig unter der Sonne ist.
Da jede der hälftigen Welten für sich beanspruchen kann, als eine ganze Welt für sich genug zu sein, wird kein Mangel empfunden, wenn man sich in einer der beiden aufhält und wohlfühlt. Als Argument dient schlicht die Behauptung, jeder könne ohne den anderen, wäre sich selbst genug. Schließlich ist es nicht so, wie ein antikes Bild die Liebe beschreibt. Die Menschen waren in mythischer Zeit als eine Kugel von Mann und Frau zusammengewachsen, die sich in zwei Teile aufgespalten habe. Nunmehr suche ein jeder Teil die Hälfte, die zu ihm gehört und die ihm verloren gegangen sei. Eher wie ein gründlich zerstrittenes Ehepaar stehen sich heute Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft gegenüber und jeder beansprucht das ultimative Sagen. Sie denken nicht daran, Frieden zu schließen.
Auf der Metaebene (auf der übergeordneten Ebene) liegt der Kompromiss. Auf dieser Ebene hält man sich die störenden Einzelheiten vom Leib, ohne ihnen zu widersprechen oder sie auch nur zu ignorieren. Man erlaubt ihnen einfach nicht, durch Wahrheitsansprüche den Prozess zu unterminieren, der zu einer Einheit der Welt führt, in der man leben möchte. Dabei ist klar, dass die Naturwissenschaften es besonders schwer haben, weil sie alles so genau nehmen, sozusagen positivistisch, indem sie sich an die Schwere des Stofflichen halten und auch von ihm beschweren lassen. Und es ist klar, dass die Geisteswissenschaften es so schwer haben, weil sie sich an die nicht genau gekannte Welt des Ideellen halten, in der Materielles und Determinatives vorkommt. „Auch das Schöne muss sterben!“ (Nänie, Friedrich von Schiller), „dass das Volkommene stirbt.“
Nur die Bildung, die eine Brücke schlägt, bietet die Metaebene, auf der sich der Widerstandskoeffizient der widerstreitenden Wissenschaftskonzepte vermindern lässt. Und diese Ebene zu erreichen setzt eine gewisse Anstrengung voraus. Sie zu erbringen ist vor allem der bereit, der einen Gewinn darin vermutet, mehr von unserer Welt zu verstehen als einen fachlichen Ausschnitt der Natur und einen eher zufälligen Teil der Kultur.
Es ist die ideale Vorstellung von einer "Universalerkenntnis des Menschen" (so der Soziologe Helmuth Plessner, gest. 1985), die in den unteren Schichten des Physischen und Anorganischen ihren Ausgang nimmt, so der Philosoph Nicolai Hartmann (gest. 1950). Hartmanns vier Schichtenmodell soll dazu dienen, Natur und Kultur des Menschen verständlich zu machen, was schwierig ist, da auf allen Stufen Neues auftritt und man nicht nur beschreiben, sondern auch erklären möchte, wie das eine aus dem anderen hervorgehen soll. Plessner erkennt denn auch in seiner Anthropologie, dass bleibende Synthesen unmöglich sind. Das ist so vermutlich gar nicht einmal abschließend zu beantworten, wenn man sich nicht einigt, wie anspruchsvoll die anzuwendende Methode der Synthese sein soll. Das schöpferische Individuum könnte nur in seinen Strukturen "anvisiert" werden, wie man Tangenten um einen Kreis legen kann, um den Kreis auf diese Weise zu beschreiben.
Statt ein "Wesen", vorauszusetzen, das man definitiv wissen kann, etwa das Wesentliche des Gedichts „Nänie“ ist, dass auch das Schöne sterben muss, wie es der Geisteswissenschaftler tut, beobachtet der Naturwissenschaftler operationales Verhalten. Er geht von einem "wesenlosen Wesen" aus, das dann szientifisch untersucht werden muss, also messend, wiegend. Ohne "Wesen" kommt aber nur der Positivist aus. Seine Option für die Handlungen und Ereignisse ist noch lange nicht die für das pralle Leben, sondern die für die Reduktion. Was Philosophie und philosophische Anthropologie zum "Wesen" des modernen Menschen zu sagen haben, kann nicht mehr "Essentialismus"("das Wesentliche betreffend"), wie Aristoteles ihn begründet hat, sein, noch kann Induktion zu ihm hinführen, wie Popper in "Logik der Forschung" (S. 451) darlegt. Wer 500 weiße Schwäne gesehen hat, sagt, alle Schwäne sind weiß. Eine äußert gewagte Induktion. Wer 500 Studentinnen und Studenten gesehen hat, weiß überhaupt nicht, was er gesehen hat.
Popper fügt sehr beruhigend hinzu:
Das Plagiat ist penetrant anhänglich"Alles Wissen ist nur Vermutungswissen."
(Karl R. Popper, Logik der Forschung, S. 452)
also auch das als sicher angenommene operationale Wissen über den Menschen. Mit solch einem Wissen, ob in der Forschung oder angewandten Volkswirtschaftslehre, versteht der Mensch aber effizient umzugehen. Es ist ein Element seiner Zeitlichkeit, seiner historisch ablaufenden Existenz, die er ja auch nicht zu ändern vermag. Als endliches Wesen kann er nicht die Ketten seiner Beobachtungen ablaufen, da sie in der Unendlichkeit verschwinden. Pragmatisch, wie er ist und leichtsinnig, erlaubt er sich entsprechend, von zwei Beobachtungsfällen, ja von einem einzigen ausgehend, zu Schluss und Urteil zu kommen. Als Kompensation für seine Endlichkeit hat er sich eine zeitenthobene Begleitung geschaffen, Kultur und Wissenschaft.