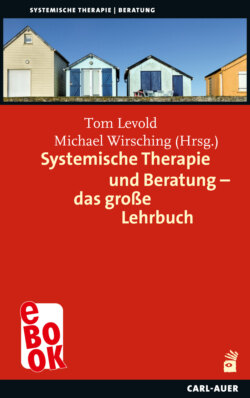Читать книгу Systemische Therapie und Beratung – das große Lehrbuch - Группа авторов - Страница 47
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3.8Narrative Therapie
ОглавлениеRudolf Kronbichler
Narrative Therapie im Kontext der Entwicklung systemischer Therapie entstand als Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Michael White (bis zu seinem Tod 2008 Leiter des Dulwich Centre in Adelaide, Australien) und David Epston (Koleiter des Family Therapy Centre in Auckland, Neuseeland) in den frühen 1980er-Jahren. »Narrativ« nannten sie ihre therapeutische Arbeit erst ab Erscheinen ihres Buches Narrative means to therapeutic ends (1990; dt. 2009: Die Zähmung der Monster).
Ausgehend von den Arbeiten Gregory Batesons, setzte sich Michael White später intensiv mit dem poststrukturalistischen Gedankengut von Michel Foucault auseinander, während David Epston sein Wissen über und sein Interesse für Kulturanthropologie in die gemeinsame Arbeit einbrachte.
Dies alles geschah im soziokulturellen Kontext der Familientherapie-Szene Australiens und Neuseelands, in der eine breite Diskussion sozialer und gesellschaftlicher Einflüsse auf Familien stattfand und feministische Ideen zunehmend Beachtung erlangten (Denborough 2009).
Narrative Therapie orientiert sich darüber hinaus – ebenso wie der kollaborative Ansatz von Goolishian und Anderson (vgl. Abschn. 1.3.7) – an Ideen und Konzepten, die ihren Ursprung in der postmodernen Literatur- und Philosophiekritik haben (Beels 2009).
Sie geht davon aus, dass wir unsere Erfahrungen mittels der für unsere Identität maßgeblichen Geschichten interpretieren. Diese Matrix an Selbsterzählungen formt und gestaltet unsere Erfahrungen und unser Erleben und konstituiert über einen Prozess der Selektion, was aus dem Bereich des Erlebens zum Ausdruck gebracht wird und was nicht. Welche Erfahrungen und welche Aspekte unseres Erlebens in welchem Kontext ausgedrückt werden können und damit eine »Stimme« haben und welche nicht, ist Ausdruck von diskursiven Bedingungen der lokalen und umfassenderen Kultur. Narrative Therapie befasst sich mit dem Neu- oder Wiederverfassen, dem Re-authoring (White 1995) alternativer Geschichten, die im Gegensatz zu den dominanten, einschränkenden Geschichten stehen, welche zu problemgesättigten Selbsterzählungen geworden sind. Dies geschieht mithilfe externalisierender Konversationen (White u. Epston 1990; White 2007), die zu einer sprachlichen Trennung von Person und Problem anregen und Raum für alternative Geschichten eröffnen durch die Beachtung des »Fehlenden, aber Impliziten« in den Äußerungen der Klienten (White 2000) sowie das Wiederzugänglichmachen der Grundlagen und Spuren bisher marginalisierter, aber bedeutsamer Aspekte von Lebensgeschichten.
Narrative Therapie orientiert sich an folgenden Grundkonzepten, die hier nur aus analytischen Gründen getrennt erörtert werden.