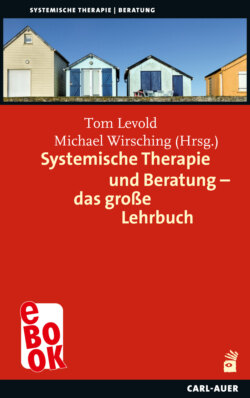Читать книгу Systemische Therapie und Beratung – das große Lehrbuch - Группа авторов - Страница 51
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3.9Der lösungsfokussierte Ansatz
ОглавлениеFerdinand Wolf
Das Konzept des lösungsfokussierten Ansatzes ist eng mit dem Namen Steve de Shazer (1940–2005) verbunden. Nach einem Kunststudium und dem Erwerb eines Mastertitels in Sozialer Arbeit kam de Shazer im Jahre 1973 mit der Gruppe um Gregory Bateson am Mental Research Institute (MRI) in Palo Alto in Kontakt (vgl. Abschn. 1.3.2). Vor allem seine Begegnung mit John H. Weakland war für seine weitere Entwicklung als Therapeut prägend.
1978 begründete er gemeinsam mit seiner Frau Insoo Kim Berg, Eve Lipchik, Elam Nunnally, Jim Derks, Marvin Weiner, Alex Molnar und Marilyn La Court das Brief Family Therapy Center (BFTC) in Milwaukee/Wisconsin, dessen Arbeit in vielen Publikationen ihren Niederschlag fand, in denen der lösungsfokussierte Ansatz mit seinen spezifischen sprachbezogenen und praxisorientierten Aspekten mittels präzise transkribierter Fallvignetten dokumentiert ist (u. a. de Shazer 1982, 1985, 1989, 1991, 1994; Jong u. Berg 1998; de Shazer, Dolan u. Korman 2007).
Von Beginn an legte de Shazer in seiner Arbeit den Fokus ausschließlich auf die spezifische Art von Kooperation, die sich zwischen Klienten und Therapeutinnen im Verlauf einer therapeutischen Konversation ergibt. Bis in die 1990er-Jahre wird in den von der Gruppe um de Shazer publizierten Arbeiten deutlich, wie sehr die Entstehung und Weiterentwicklung des lösungsfokussierten Ansatzes unter starker Bezugnahme auf den und letztlich auch immer in Abgrenzung zum Kurztherapieansatz des MRI erfolgt ist.
Während am MRI die Kombination von strategischen, hypnotherapeutischen und von der Kybernetik beeinflussten Modellen die therapeutische Praxis bestimmte, baute die Gruppe in Milwaukee ihr therapeutisches Vorgehen hauptsächlich auf zentralen Elementen der Hypnotherapie Milton H. Ericksons auf.
So wird etwa im MRI-Ansatz in Anlehnung an Watzlawicks Theorem »Die Lösung ist das Problem!« das vom Klienten präsentierte Problem als »Lösungsversuch« im Sinne einer Abfolge eines (fehlgeleiteten) »Mehr-desselben«-Musters (Muster = »pattern«) aufgefasst. Dementsprechend wird diesen von den Klienten präsentierten Probleminteraktionsmustern mit einer therapeutisch verordneten Musterunterbrechung (»pattern interruption«) begegnet.
Im Gegensatz dazu legt die Milwaukee-Gruppe den therapeutischen Fokus primär auf funktionale Bereiche des Alltagshandelns, um die darin bereits enthaltenen, aber eventuell nicht im Bewusstsein verankerten Lösungs- bzw. Veränderungsressourcen bewusstzumachen und zu aktivieren (»Betrachte das, was funktioniert, repariere es nicht, sondern mach mehr davon!«). Diese Vorgehensweise basiert auf der Annahme, dass es weniger darum geht, »Verhalten zu stoppen, welches das Problem verstärkt, sondern vielmehr den Lösungsprozess in Gang zu setzen« (de Shazer et al. 1986, S. 191). Konsequenterweise wandte sich die Milwaukee-Gruppe entgegen aller bisherigen therapeutischen Praxis zunehmend weniger der Problemgeschichte und auch der Problemsicht der Klienten als vielmehr vergangenen Episoden zu, in denen das Problem in geringerem Grade vorhanden war oder völlig fehlte, um damit die Beschreibung und Operationalisierung zukünftiger problemfreier Szenarien zu fundieren.
Bereits hier wird der Einfluss der hypnotherapeutischen Arbeit Milton H. Ericksons deutlich, auf dessen Arbeit Special techniques of brief hypnotherapy (1954) sich de Shazer explizit bezieht (1982). Vor allem haben die ericksonschen Prinzipien der »Utilisation« vorhandener Ressourcen und der »Zeitprogression« (etwa in der »Wunderfrage«) von Beginn an Eingang in die Entwicklung des lösungsfokussierten Ansatzes gefunden und die therapeutische Haltung mitbestimmt.
Dementsprechend besteht der »Kern der Kurztherapie« darin:
»das, was die Klienten mitbringen, nutzbar zu machen und ihnen zu helfen, es so zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse einzusetzen, dass sie ihr Leben aus eigener Kraft befriedigender gestalten können« (de Shazer et al. 1986, S. 183).
Das Prinzip der Kooperation anstelle des Widerstandskonzeptes in den Vordergrund der therapeutischen Überlegungen zu rücken geht ebenfalls auf das ericksonsche Utilisationsprinzip (»Arbeite mit dem, was der Klient mitbringt!«) zurück.
Darüber hinaus floss auch die Beschäftigung mit der Balancetheorie Fritz Heiders in die Überlegungen de Shazers ein. Während man ursprünglich von der Annahme ausgegangen war, dass das von einem Klientensystem präsentierte Problem auf einem Gleichgewichtszustand der Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern beruhe (was im von Don D. Jackson geprägten Begriff der »Familienhomöostase« zum Ausdruck kam), ergab sich aus de Shazers Beobachtungen in der therapeutischen Praxis, dass das Klientensystem kein geschlossenes System darstellt, sondern sich in ständiger Wechselwirkung mit dem Therapeuten bzw. dem therapeutischen System (Therapeutin plus Team hinter der Einwegscheibe) befindet und auf jegliche Aktion oder Reaktion des therapeutischen Teams in spezifischer Form antwortet.
Auf der Basis dieser Erkenntnisse verwarf er das Konzept des »Widerstands« (de Shazer 1982, 1984), da jegliches Klientenverhalten nur mehr als Produkt der aktuellen Interaktion von Klientin und Therapeut und ihres aktuellen Kontextes und nicht mehr als im Klienten lokalisiert betrachtet wurde.
Dieser Interaktionskontext wurde explizit – durchaus in Anlehnung an Gregory Bateson (2006) – unter den Begriff des »Ökosystems« subsumiert (der vollständige Titel von de Shazers erstem Buch, 1982, lautet im englischen Original Patterns of brief family therapy. An ecosystemic approach).
Über die ursprünglich vertretene Annahme hinaus, dass jegliches Verhalten des Klienten eine Manifestation einer spezifischen Art von Kooperation darstellt, die »der Therapeut (und das Team) zumindest durch Implikation entdeckt und beschreibt« (de Shazer 1991, S. 27; diese und die folgenden Übers.: F. W.), entwickelte sich die therapeutische Praxis des BFTC dahin gehend, spezifische Kooperationsstrategien durch die Therapeuten (und ihr Team) zu entwickeln, die mittels bestimmter, vorwiegend gegenwarts- und zukunftsorientierter Fragen und Botschaften (»messages«) Lösungen, d. h. Veränderungen zu initiieren versuchten. Diese Fragen und Botschaften weisen ebenso wie das Setting von Therapeut und Team hinter einer Einwegscheibe, einer Pause mit nachfolgender Kommentierung plus Abschlussintervention interessante Parallelen zur Arbeitsweise der Mailänder Schule um Mara Selvini Palazzoli auf.
Beide Vorgehensweisen sind – ungefähr zur gleichen Zeit (um die Mitte der 1970er-Jahre) und ohne voneinander Kenntnis zu nehmen – unter Bezugnahme auf den MRI-Ansatz entwickelt worden. De Shazer sieht die gemeinsamen Wurzeln dieser Entwicklungen in den jeweiligen Verbindungen zum MRI, personalisiert durch Paul Watzlawick und John Weakland. Gleichzeitig wird jedoch seitens der Milwaukee-Gruppe auf einen fundamentalen Unterschied zwischen dem lösungsfokussierten Ansatz und dem »systemischen« Mailänder Modell verwiesen, das stark an kybernetischen Konzepten sich selbst erhaltender familiärer homöostatischer Regelmechanismen und der Möglichkeit gezielter strategischer Interventionen ausgerichtet ist. De Shazer macht diesen Unterschied an der spezifischen Metaphorik der Mailänder Gruppe fest (»Paradoxon und Gegenparadoxon«), die im Gegensatz zur Sichtweise der Milwaukee-Gruppe (Klienten und Therapeuten agieren in wechselseitiger Abhängigkeit voneinander) das Verhalten der Familie in der Therapiesituation unabhängig vom aktuell gegebenen Kontext im Sinne eines »Beobachtungsgegenstandes« als Ausdruck einer Spielsituation mit Wettbewerbscharakter betrachtet, vor deren Hintergrund die Therapeuten strategische Interventionen vornehmen. Ziel dieser Interventionen ist es,
»die Macht des Therapeuten im Spiel gegen die Macht des homöostatischen Widerstandes des Familiensystems gegen Veränderung zu stärken« (1991, S. 80).
In seinen Arbeiten ab 1991 stellt de Shazer die seit 1978 in Milwaukee entwickelten und praktizierten therapiephilosophischen Konzepte in den Zusammenhang poststrukturalistischen Denkens. Während er an den konstruktivistischen Konzeptionen des MRI und den strategischen Konzepten der Mailänder Gruppe eine methodologische Trennung von Subjekt und Objekt zwischen Therapeut und Klient kritisiert, umfasst im lösungsfokussierten Ansatz das zu betrachtende System das gesamte therapeutische System: »Klient mit seinem Problem plus Therapeut« (ebd., S. 79).
Im Zuge der Weiterentwicklung des lösungsfokussierten Ansatzes spielen die sprachphilosophischen Überlegungen Ludwig Wittgensteins eine immer größere Rolle. Aus dieser Perspektive begreift de Shazer die Konversation in der Therapiesituation als Sprachspiel im Sinne eines öffentlichen und diskursiv etablierten Bezugsrahmens, ohne den wir Wittgenstein zufolge gar nicht über persönliche Erfahrungen sprechen können (ebd., S. 93). Für de Shazer ergibt sich die Sinnstiftung in der Psychotherapie aus dem, was von Klienten und Therapeuten gesagt wird, und nicht aus einem zugrunde liegenden interpretativ erschlossenen Erleben (de Shazer 2003, S. 98 f.). Mit der Konzeption der Sprachspiele (wie z. B. bezüglich Problemen, Ausnahmen von Problemen, Zielen einer Therapie, Lösungen etc.) nimmt de Shazer in Anspruch, therapeutische Prozesse vollständig beschreiben zu können, sodass sich die Notwendigkeit, Dingen auf den Grund gehen zu wollen, erübrigt – was vor dem Hintergrund psychotherapeutischer Traditionen keine leichte Aufgabe darstellt:
»Die lösungsorientierte Kurztherapie ist für den Klienten wie für den Therapeuten ein hartes Stück Arbeit, denn der Therapeut muss alles tun, um an der Oberfläche zu bleiben und nicht zu interpretieren« (ebd., S. 99).
Für den lösungsfokussierten Ansatz besteht keinerlei Gewissheit über die Bedeutung von Wörtern und Begriffen. Daraus folgt, dass in der therapeutischen Konversation nur durch Kooperation ein gemeinsames Verständnis der jeweils verwendeten Begrifflichkeiten im Sinne eines »interaktionellen Konstruktivismus« erzielt werden kann. Es ist die Betrachtung der Sprache durch die Therapeutin, die Unterschiede in der Betrachtungsweise möglich macht und »arbeiten lässt«. Damit besteht lösungsfokussierte therapeutische Konversation im Herausarbeiten und Hervorheben von Unterschieden, von denen man jeden einsetzen kann, »um einen Unterschied zu machen, sodass der Klient sagen kann, sein Leben sei zufriedenstellender« (de Shazer 1991, S. 174).