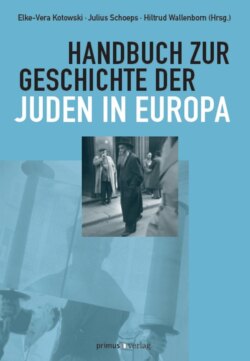Читать книгу Handbuch zur Geschichte der Juden in Europa - Группа авторов - Страница 49
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Tschechoslowakei seit 1918 Der rechtliche Status der Juden nach der Verfassung und dem Sprachengesetz von 1920
ОглавлениеDie Gründung der Ersten Tschechoslowakischen Republik im Jahr 1918 führte zu einer Stabilisierung der Situation der Juden, da ihnen zum ersten Mal legislative Sicherheiten gewährt wurden. Bereits vor der Gründung des tschechoslowakischen Staates hatten die Vertreter der böhmischen Zionisten im Wiener Parlament im Jahr 1917 mit den tschechischen Politikern über die künftige Regelung der jüdischen Angelegenheiten erfolgreich verhandelt. Auch der spätere tschechoslowakische Präsident Tomáš G. Masaryk versicherte noch vor Kriegsende im Namen des „Tschechoslowakischen Nationalrats“ in Paris in einer Botschaft an die amerikanischen Zionisten, daß die Juden im künftigen Staat gleiche Rechte wie die übrigen Bürger genießen würden und daß es ihnen zudem freistehen werde, in Palä stina eine jüdische Heimstätte aufzubauen.
Am 22. Oktober 1918 gründeten die nationalbewußten Juden Böhmens eine eigene politische Vertretung, den „Jüdischen Nationalrat“ mit dem Sitz in Prag, dem kurz darauf auch der „Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden“ beitrat. Auch die Juden in der Slowakei und in der Karpato-Ukraine, die durch das Abkommen von Trianon im Jahr 1920 der Tschechoslowakei zugeordnet wurde,1 gründeten eigene Verbände. In seinem Memorandum vom 28. Oktober 1918 forderte der „Nationalrat“ u.a. die Gewährleistung der nationalen und konfessionellen Selbstbestimmung sowie die völlige Gleichstellung der Juden vor dem Gesetz. Ferner warnte das Memorandum vor dem zunehmenden Antisemitismus, insbesondere in der Slowakei.
Der Präsident des „Jüdischen Nationalrats“ Ludvik Singer verhandelte bei der Friedenskonferenz in Paris mit dem tschechoslowakischen Außenminister Beneš über die Stellung der jüdischen Minderheit in der Tschechoslowakei. Diese Verhandlungen, die in Prag fortgesetzt wurden, führten schließlich zur Anerkennung der jüdischen Nationalität in der Verfassungsurkunde. Damit hatten Juden neben der Möglichkeit, sich als Angehörige der „israeli tischen Konfession“ zu bekennen, nun auch das Recht, sich der „jüdischen Nationalität“ zuzuordnen. Dieses Recht galt selbstverständlich auch für Personen, die selbst konfessionslos waren, aber jüdische Vorfahren besaßen. Die Verfassungsurkunde legte demnach nicht eindeutig fest, ob das Judentum als Konfession oder als Nationalität zu betrachten sei.
Während für die übrigen Volksgruppen die Sprache das ausschlaggebende Kriterium für die Zuordnung zu einer Nationalität war, war dies bei den Juden aufgrund ihrer sprach lichen Diversität nicht möglich. Juden hatten daher bei Volkszählungen die Wahl, entweder als Nationalität „jüdisch“ anzugeben oder sich derjenigen Nationalität zuzuordnen, der sie sprachlich angehörten, und „jüdisch“ bzw. „israelitisch“ unter der Rubrik „Konfession“ anzugeben. Bei den Volkszählungen von 1921 und 1930 ergaben sich daher folgende Zahlen2:
Die sprachliche Diversität der Juden in der Tschechoslowakai trug auch dazu bei, daß Jiddisch und Hebräisch nach dem Sprachengesetz von 1920 niemals den Status einer Amtssprache erhalten konnten. Noch nicht einmal in der Karpato-Ukraine und der Slowakei, wo noch viele Juden lebten, deren Muttersprache Jiddisch war, erreichten sie den Anteil von 20 % der Bevölkerung eines Amtsbezirks, der nach diesem Gesetz notwendig war, um eine Sprache in den Status einer Amtssprache zu erheben. Gleiches gilt für das tschechoslowakische Wechselgesetz von 1927. Letztlich hatte die Tatsache, daß die Juden in der Ersten Tschechoslowakischen Republik im Gegensatz zu den Verhältnissen in der alten Habsburgermonarchie nun als Nationalität anerkannt waren, also nur geringe praktische Auswirkungen. Die kulturelle und sprachliche Zersplitterung der jüdischen Gemeinschaft war zu stark, als daß sie sich in dem neuen Staat als gesonderte und einheitliche Gruppe hätte etablieren können. Darüber hinaus wollten die deutsch oder tschechisch sprechenden Juden auch meist als Angehörige dieser Nationalitäten gelten.
Im ganzen läßt sich sagen, daß die Tschechoslowakei, was die Gesetze anging, die den rechtlichen Status der Juden regelten, das liberalste Land unter den Nachfolgestaaten der Donaumonarchie war. Die von der Verfassung garantierte Gleichberechtigung wurde jedoch, ähnlich wie es bei der deutschen Minderheit der Fall war, in der politischen Praxis nicht immer voll umgesetzt. Die Durchführungsbestimmungen zu einzelnen Gesetzen zeigen, daß die schwerfällige tschechoslowakische Administration der gleichberechtigten Partizipation der Juden im Wege stand und so hinter den berechtigten Erwartungen, die in dieser Hinsicht an eine demokratische Regierung gestellt werden konnten, zurückblieb.