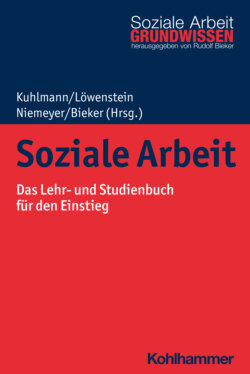Читать книгу Soziale Arbeit - Группа авторов - Страница 54
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Paternalismus
Оглавление»Paternalismus bedeutet per Definition in jedem Fall einen Eingriff in die Freiheit und Autonomie ohne Zustimmung des*der Betroffenen aus dem ausschließlichen oder vorrangigen Grund, das Wohlergehen der*des Betroffenen bzw. seiner*ihrer Interessen, Werte oder Eigentum zu verbessern bzw. zu erhalten« (Lindenberg & Lutz 2021, S. 74 im Anschluss an Dworkin 2017).
Das Wohl und das wohlverstandene Interesse der Person werden jedoch ausschließlich durch die Sozialfachkraft bestimmt. Die hilfebedürftige Person wird zu deren Handlungsobjekt und ihrer Eigenmächtigkeit beraubt. Auch wenn er die Rechte einer Person noch nicht im Rechtssinne beeinträchtigt, hat der dominant-autoritäre Handlungsstil bereits einen eingreifenden Charakter.
Dass Bevormundung und Dominanz in der Praxis durchaus eine Rolle spielen, zeigen die qualitativen Studien von Heiner (2010) zum beruflichen Selbstverständnis von Sozialfachkräften. Das »Dominanzmodell beruflichen Handelns« ist deutlich durch einseitig negative Haltungen gegenüber den Adressat*innen geprägt. In dieser Haltung erscheinen Adressat*innen als nicht entwicklungsfähig, nicht veränderungsbereit, perspektiv- und willenlos, aggressiv oder destruktiv. Liebenswerte Züge fehlen ihnen ebenso wie Einsichtsfähigkeit. Motivations-, Partizipations- oder Aushandlungsbemühungen erscheinen zweck- und sinnlos.
»Die nicht beeinflussbaren, nicht aushandelbaren, faktensetzenden Aktivitäten der Fachkräfte sind mit massiven Einschränkungen des Handlungsspielraums der Betroffenen verbunden und konstituieren eine Dominanzbeziehung – ohne dass die Fachkräfte ihre Machtposition (…) reflektieren« (Heiner 2010, S. 408).
Hilfe kann folglich die ideologische Formel dafür sein, Menschen, die sich in Obhut der Sozialen Arbeit befinden, durch fragwürdige Maßnahmen der Reglementierung rigider Anpassung zu unterwerfen (»Ich helfe Dir!«). Die von Zwang, Entmündigung und Entwürdigung bestimmte Geschichte der Unterbringung von Menschen mit Behinderung, psychisch Kranken und Kindern und Jugendlichen in Heimen ( Kap. 2) rechtfertigte sich stets mit der moralisch wertvollen Absicht des Helfens und machte sich damit umso schwieriger angreifbar.