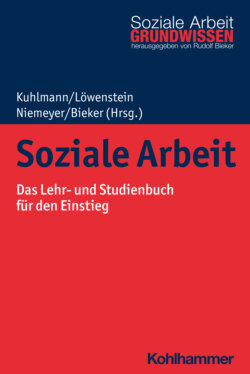Читать книгу Soziale Arbeit - Группа авторов - Страница 55
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Moralische Abwertung und Identitätsbeschädigung
ОглавлениеDie moralische Abwertung von Personen mit Hilfebedarf muss nicht in der von Heiner zuvor geschilderter Form auftreten. Schon der Kontakt zu einer Institution der Sozialen Arbeit schließt eine latente moralische Etikettierung ein.
»Eine Diagnose, ein polizeilicher Verdacht oder eine Identifizierung von Vernachlässigung in der Jugendhilfe ist immer eine bewertende Problemzuschreibung an die betroffene Person; es handelt sich nicht um eine rein technische Angelegenheit, sondern immer auch um ein (zumeist negatives) Werturteil über die Person. Bereits die Existenz der Institution und die mit ihr verbundene Lizenz, z. T. weitreichende Eingriffe in das Leben der Klientel vorzunehmen und Änderungen ihrer Ausstattung mit Ressourcen und ihres Status vorzunehmen, beinhaltet das moralische Urteil, dass damit problematische Situationen und Personen bearbeitet werden sollen. Die Kategorisierung und ihre moralische Bewertung sind in den Institutionen also nicht Gegenstand expliziter Entscheidungen durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern Bestandteil des institutionalisierten Doing Social Problems« (Groenemeyer 2018, S. 1506).
Die Adressierung durch Dienste der Sozialen Arbeit konfrontiert Menschen in der Regel mit der Zuschreibung von Hilfebedürftigkeit (jedenfalls so lange Hilfe als geeignete Problemlösung in Betracht kommt). Diese Zuschreibung ist – selbst wenn sie der Selbsteinschätzung betreffenden Person nicht grundsätzlich widerspricht – potenziell mit einer Belastung der personalen und sozialen Identität der Person verbunden. Sie schränkt die Möglichkeiten ein, sich als kompetente Person zu erleben, die mit ihrem Leben selbst zurechtkommt. Adressat*innen müssen anerkennen, dass sie aus behördlicher Sicht als überfordert oder unfähig gelten, selbst wenn die Sozialfachkräfte sorgsam darauf achten, negative Etikettierungen zu vermeiden. Als Hilfebedürftige müssen Adressat*innen Einblick in ihr Leben, die Wohnverhältnisse, ihre Beziehungen etc. geben. Es verwundert daher nicht, wenn Personen mit Hilfebedarf gegen das Vordringen in die Privatsphäre und gegen den Makel der Unfähigkeit innere Widerstände entwickeln und offenkundige Probleme nicht wahrhaben oder Dritten zuschreiben wollen.
Professionell ist ein Hilfebemühen in dieser Situation, wenn offene oder latente Widerstände gegen Hilfeangebote nicht vorschnell als »Ablehnung« und »mangelnde Kooperationsbereitschaft« gedeutet werden. Die mit dem Status einer hilfebedürftigen Person latent bedrohte Identität bedarf einer Vorgehensweise, die Überlegenheitsattitüden vermeidet, das Autonomiebedürfnis der Adressat*innen respektiert, ihnen Gelegenheit zur Aufwertung gibt und sie in ihrer Selbstwirksamkeit aktiv fördert (»Hilfe zur Selbsthilfe«).
»Der springende Punkt ist dabei, ob es gelingt, jenseits der stigmatisierenden Grundkonstellation ein Setting bereitzustellen, in dem Adressat_innen Ansprüche, eigensinnige Deutungen und Lösungsideen geltend machen können, ohne sich wiederum einseitigen oder entfremdenden Definitionen unterwerfen zu müssen« (Bitzan & Bolay 2017, S. 57).