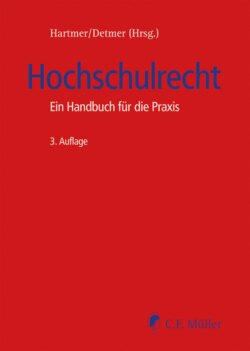Читать книгу Hochschulrecht - Группа авторов - Страница 51
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. Kapitel Typisierung von Hochschulen: Universitäten und Fachhochschulen › III. Ausdifferenzierung und Diversifizierung der deutschen Hochschullandschaft
III. Ausdifferenzierung und Diversifizierung der deutschen Hochschullandschaft
4
Abgesehen von dem vorgenannten Befund ist auch vor dem verfassungsrechtlichen Hintergrund ein Prozess zunehmender Ausdifferenzierung zu sehen, in dem sich das deutsche Hochschulsystem (auch) derzeit (wieder) befindet.[1] Vorangetrieben wird diese Ausdifferenzierung insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Forschungsleistung im Rahmen der Exzellenzinitiative, die auf die Ermittlung von Spitzenniveaus der Forschung gerichtet ist. So war bzw. ist es gerade das Ziel der dritten Förderlinie der beiden ersten Runden der Exzellenzinitiative („Zukunftskonzepte zum projektbezogenen Ausbau der universitären Spitzenforschung“), die Vielfalt der Organisationsmodelle universitärer Spitzenforschung sowie die funktionale Differenzierung der Universitäten in Deutschland zu erhöhen, um die Strategie- und Autonomiefähigkeit der Universitäten und die Leistungsfähigkeit des Wissenschaftssystems insgesamt zu steigern.[2] Exemplarisch stehen hierfür einerseits Fusionen wie das 2009 gegründete Karlsruher Institut für Technologie (KIT)[3], das aus dem Zusammenschluss des Forschungszentrums Karlsruhe (einer Großforschungseinrichtung der Helmholtz-Gemeinschaft) und der Universität Karlsruhe hervorgegangen ist[4] sowie die 2003 gegründete Universität Duisburg-Essen,[5] die aus dem Zusammenschluss der Gesamthochschulen Essen und Duisburg hervorgegangen ist. Aber auch die Fusion der Technischen Universität Cottbus und der Fachhochschule Lausitz zur „Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg“[6] ist hier zu nennen.[7] Zudem sind andere Zusammenarbeitsformen gefunden worden, um (in diesen Kooperationen) die Leistungen der Partner zu stärken und gezielt auszubauen sowie gemeinsam Forschungs- und Lehrschwerpunkte weiterzuentwickeln. Insoweit ist auf die 2007 gegründete Universitätsallianz Metropole Ruhr (UAMR)[8] zu verweisen, in der die Nachbaruniversitäten Bochum, Dortmund und Duisburg-Essen zwar näher zusammenrücken, aber eigenständige Universitäten bleiben sowie auf die 2009 ins Leben gerufene Hochschulallianz für angewandte Wissenschaften (HAWtech), in der sich die Fachhochschulen Aachen, Berlin, Darmstadt, Dresden, Esslingen und Karlsruhe überregional kooperativ zusammen geschlossen haben.[9] In Niedersachsen wurde 2015/16 die Niedersächsische Technische Hochschule (NTH), die 2009 als neuartige Kooperationsform dreier überwiegend technisch ausgerichteter Universitäten (Braunschweig, Clausthal und Hannover) gegründet wurde,[10] zunächst ausgesetzt und sodann aufgelöst.[11] Eine weitere Sonderform einer Hochschulkooperation ist der nach § 54a NHG vorgesehene gemeinsame Lenkungsausschuss der Universität Oldenburg sowie der Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth.[12]
5
Dem sind in der Vergangenheit bereits andere Ausdifferenzierungen und Diversifizierungen vorangegangen, die namentlich der technisch-gesellschaftlichen Entwicklung geschuldet waren. Repräsentierte zunächst die Universität das Hochschulsystem,[13] kamen im 19. Jahrhundert die Technischen Hochschulen hinzu, denen später die Bezeichnung „Universität“ verliehen wurde. In ihnen fanden zunächst die technisch-wissenschaftlichen Disziplinen eine Heimat. Abgesehen von anderen Einrichtungen wie den Pädagogischen Hochschulen und Kunsthochschulen kam in den 70iger Jahren des letzten Jahrhunderts als neuer Hochschultyp die Fachhochschule hinzu, die zum Ziel hatte, Studierende auf wissenschaftlicher Grundlage praxis- und berufsorientiert auszubilden und zu selbstständiger Tätigkeit im Beruf zu befähigen. Mit dieser sicherlich zentralen hochschulpolitischen Grundentscheidung der Nachkriegszeit wurde zwar ein neuer Hochschultyp kreiert, jedoch auch ein gewisser Wildwuchs von Bildungseinrichtungen in den Bundesländern (z.B. Höhere Technischen Lehranstalten, Höhere Fachschulen sowie staatliche Ingenieur-, Wirtschafts- und Sozialakademien bzw. -schulen) in einen einheitlichen Hochschultyp überführt. Die Fachhochschule konnte dieses auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland wichtige Feld allerdings nicht (allein) ausfüllen, wie das Entstehen der Berufsakademien zeigt. Letztere haben in Baden-Württemberg als sog. Duale Hochschule mittlerweile den Status einer staatlichen Hochschule erlangt,[14] die durch die Verbindung des Studiums an der Studienakademie mit der praxisorientierten Ausbildung in den beteiligten Ausbildungsstätten – ebenso wie die Fachhochschule – die Fähigkeit zur selbstständigen Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in der Berufspraxis vermitteln soll.[15] Jenseits dessen haben sich als eine weitere Hochschulform die sogenannten „Professional Schools“ mit universitärem Anspruch wie die „Hertie School of Governance“ und die „European School of Management and Technology“ entwickelt.[16] Diese Schools verbinden eine praxisorientierte Ausrichtung ihrer Studienangebote mit dem Selbstverständnis, universitätsadäquate Leistungen in Lehre und Forschung zu erbringen.[17]